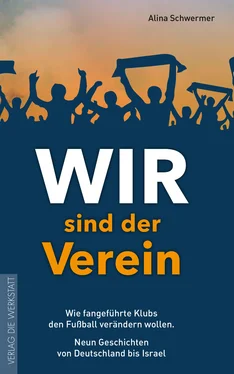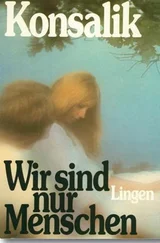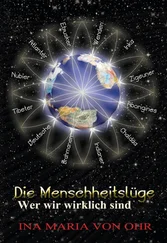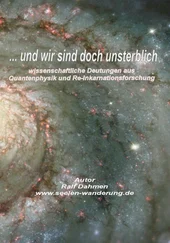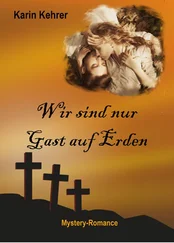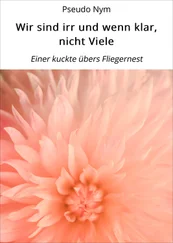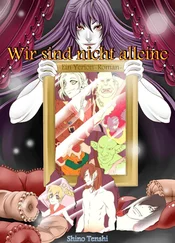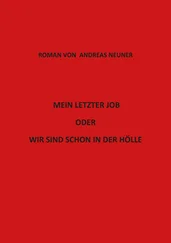Der AFC Wimbledon bringt diese neue, alte Art von Bezug. Jeder, der will, kann bei dem Fanverein einen Anteil kaufen und bekommt genau eine Stimme. Jeder Anteilshaber kann die Vereinsführung wählen oder bei wichtigen Themen auf den Generalversammlungen abstimmen, sofern er erwachsen und damit stimmberechtigt ist. Im Frühjahr 2017 wollen etwa 3.000 Menschen dem AFC Wimbledon so nahe sein, dass sie einen Anteil und damit eine Stimme erwerben. Rund 2.500 von ihnen sind stimmberechtigte Erwachsene.
Keine Experimente
„Egal, wie man es bemisst, der AFC Wimbledon hat Erfolg auf jeder Skala“, sagt Stuart Dykes vom Fanverein FC United of Manchester. Wimbledon ist der Che Guevara der Fanrevolte: eine Ikone, die überall hinpasst, auf das T-Shirt des Studenten, als abgeschabter Sticker in die Eckkneipe oder als sexy Poster in die Küche der Hausfrau. Und wenn das widersprüchlich wirkt, stört es niemanden. Der Fanverein schlüpft in jede Rüstung. Wimbledon punktet bei denen, die sich Fanrechte und faire Eintrittspreise wünschen, bei Anti-Kommerz-Nostalgikern und bei Erfolgsfans, die auf Siege mit einem kleinen Klub stehen. Der Verein lebt von dem Hype, und 2017 wirkt er weitgehend stabil. Er hält nichts von Experimenten.
Seit der Gründung sind beim AFC im Wesentlichen dieselben Personen in Führungspositionen. Zwar helfen viele Freiwillige im Alltag, doch die großen Entscheidungen liegen in den Händen von wenigen. Auch im guten Sozialismus muss es jemanden geben, der Entscheidungen trifft, glaubt Ivor Heller. Man darf hinterfragen, wie basisdemokratisch der AFC Wimbledon ist. Heller, der Idealist, beantwortet das pragmatisch: „Manche Fans glauben, dass Fanführung heißt, man müsste über jede Eintrittskarte am Spieltag abstimmen. Aber so kann man einen Verein nicht managen.“ Denn eines lernt die Bewegung bald: Die Fanbasis, die einen Verein tragen, ihn beflügeln und führen kann, kann ihn auch ins Schlingern bringen. Ort der größten Probleme ist ausgerechnet das wundersame Netzwerk, das alle zusammenbrachte: das Internet. „Wir empfehlen mittlerweile allen Fanvereinen, kein offizielles Fanforum zu führen“, sagt Antonia Hagemann von Supporters Direct Europe.
Das lernen sie bald etwa beim zweiten Popstar der Bewegung, dem 2005 gegründeten FC United of Manchester, der sich explizit gegen Kommerz richtet und politisch sein will. Denn im Netz tun viele Anhänger das, was Menschen gern im Internet tun: schimpfen, hassen, mobben. „In Manchester wurde im Fanforum extrem gegen Individuen gehetzt“, sagt Hagemann. „Es ging so weit, dass der Vorstand keine Entscheidungen mehr treffen konnte, weil in alles reingegrätscht wurde. Teilweise waren das Äußerungen, die auch juristisch relevant wurden.“ Und: „Wir können nur jedem raten, das Forum zuzumachen“, sagt Hagemann. Wenn Mitsprache heißt, dass jeder bei allem mitreden muss, gibt es ein Problem. Die Leute des AFC Wimbledon helfen 2005, den FC United of Manchester zu gründen. Aber inhaltlich liegen die beiden Vereine weit auseinander. Beim FCUM missionieren sie bewusst im Rest Europas, sie sehen sich als Wortführer einer Bewegung. Und verweigern sich dem, was sie als Kommerz empfinden. Beim AFC Wimbledon reden sie über Fanführung nur, wenn man sie fragt. Und es gibt wenig, was sie aus ideologischen Gründen nicht tun würden.
Die Grenzen der Basisdemokratie und Machtstreitereien
Der AFC Wimbledon lernt die Macht und die Grenzen von Basisdemokratie in den ersten, aufgeregten Wochen. Es ist der Sommer 2002, nur kurz vor der nächsten Saison. Und der Klub braucht dringend ein Spielfeld, eine Struktur, Sponsoren. Zur beginnenden Spielzeit soll der neue Verein den Ligabetrieb aufnehmen. Ivor Heller hat Angst um sein junges Baby. „Wenn wir es verpasst hätten, direkt zur nächsten Saison zu starten, wäre das Projekt gestorben“, sagt er. „Es wäre alles auseinandergedriftet.“ Er und Kris Stewart sind es vor allem, die in jenem Sommer die Dinge in die Hand nehmen. „Wir mussten hart zupacken“, so formuliert es Heller. Hart zupacken heißt auch: Dinge so zu machen, wie sie die beiden für richtig halten. „Wenn wir alles mit dem Trust Board abgestimmt hätten, hätten wir es nie geschafft“, sagt Heller heute. „Man kann nicht jeden Tag ein Meeting abhalten.“
Damit machen sich die beiden nicht überall Freunde. Im neuen Klub gibt es Machtstreitigkeiten in den ersten Wochen. Dass zwei Kumpels vieles allein entscheiden, enttäuscht manche in ihren Vorstellungen von einem fangeführten Verein. „Einige Leute haben geglaubt, sie sollten mehr Einfluss haben. Aber ihr Einfluss hätte alles nur verlangsamt.“ Sie diskutieren. Und dann? Machen sie eben irgendwann. Und als die Sache läuft und der AFC Wimbledon mit Spielfeld, Sponsor und allem Brimborium pünktlich in die erste Saison startet, flaut der Ärger ab. Die Rolle der Fanbasis ändert sich. Zu den Generalversammlungen, die mittlerweile dreimal im Jahr stattfinden, kommen 60 bis 70 Leute. Bei den besser besuchten Versammlungen sind es um die 100. In einem Klub, wo theoretisch 2.500 Menschen abstimmen könnten, ist das eine kleine Zahl. „Wir geben uns Mühe, interessante Themen auszusuchen, damit mehr Leute kommen“, sagt Erik Samuelson. „Vielleicht denken sie, dass schon alles super läuft, oder vielleicht interessiert es sie nicht. Jedenfalls lassen sie uns auf der Führungsebene meistens einfach machen.“
Kritik kommt schon ab und an. „Es gibt manche Anhänger, die sagen: Wir haben den Verein nicht gegründet, damit dies oder das passiert. Aber dabei haben sie den Verein überhaupt nicht gegründet. Der Verein wurde von vier Leuten gegründet, die einen Fußballklub haben wollten, und wir wollten einfach Fußball gucken.“ Das Wort Amateur empfindet Erik Samuelson als Beleidigung; professionell soll es sein, ambitioniert. Und erfolgreich. Der AFC Wimbledon ist ein Fanverein mit so wandelbarem Antlitz, dass er jedes Ideal verkörpern kann und keines.
Der FC Chelsea der unteren Ligen
In der Geschäftsstelle des AFC Wimbledon steht ein weißes Board im Sekretariat. Darauf stehen mit wasserlöslichem Edding die Namen der Freiwilligen, die unentgeltlich für den Verein arbeiten, inklusive Anwesenheitszeiten. Es ist eine Liste von der Oberkante bis zur Unterkante der Tafel. Das sind nur die Leute in der Geschäftsstelle. Wimbledon wird bis heute von Hunderten freiwilliger Helfer getragen. Sie packen Dauerkarten in Briefumschläge, und dann kommt der Trainer vorbei und redet zehn Minuten mit ihnen. Das kriegen sie nicht bei anderen Vereinen. Das ist ihr Lohn. Sie kommen dem Klub nahe und fühlen sich als Teil davon. Es ist ein mächtiger Bonus für Fanvereine und einer, den Kritiker unterschätzt haben: Nähe. Wertschätzung. Bis heute geht Erik Samuelson vor jedem Heimspiel zu Fuß ums Stadion über den Parkplatz. Wer Kritik oder Wünsche hat, kann ihn ansprechen; wer Ärger loswerden will, auch. „Ich denke, das nimmt vielen Problemen den Wind aus den Segeln“, sagt Samuelson. „Unsere Fans sind unglaublich geduldig. Sie wissen, dass wir ihnen zuhören. Und sie wissen auch: Wenn sie mehr Erfolg wollen, dann müssen sie eben mehr zahlen, weil wir keinen reichen Besitzer haben.“
Wer sich respektiert und geachtet fühlt, gibt Achtung zurück. Und opfert sich auf. Die Liebe der Anhänger ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Wimbledon: Sie zahlen oft mehr, als sie müssten. Und erfahren dafür ein Gemeinschaftsgefühl und eine Dankbarkeit, die es in vielen Klubs der Premier League nicht gibt. „Fans im Fanverein haben das Gefühl, dass man sie ernst nimmt“, sagt Jim Keoghan. „Natürlich führen nicht alle Fans den Verein, aber wenn sie nicht zufrieden sind, können sie was unternehmen.“ Eine kleine englische Studie, die Keoghan in seinem Buch zitiert, verglich die Zufriedenheit von Anhängern bei Fanvereinen mit der bei konventionell geführten Klubs. Die Fans fühlten sich involvierter, glücklicher, ernst genommener und verbundener mit dem Verein. Gerade in den unteren Ligen, wo das Geld vor allem aus dem Ticketverkauf kommt, ist das ein enormer Vorteil. In der Combined Counties League, in der der Verein 2002 neu startet, liegt der Zuschauerschnitt damals bei 30 bis 50 Fans. Wimbledon bringt 4.600 Anhänger zum ersten Spiel mit.
Читать дальше