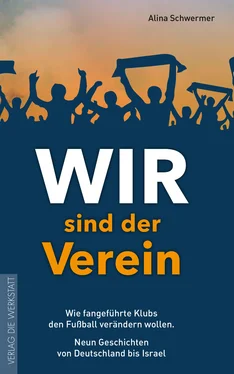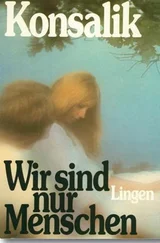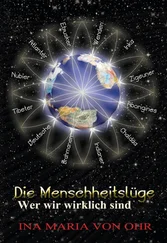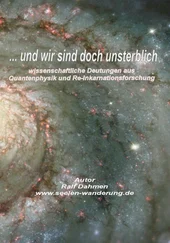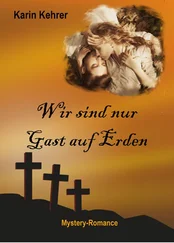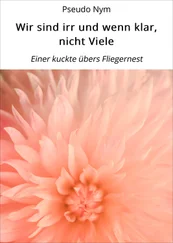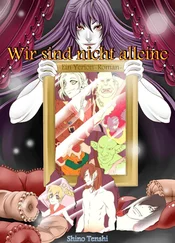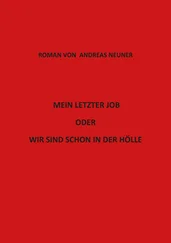Jetzt steht er auf der anderen Seite, ein Pragmatiker, der sich nicht Revolutionär nennen will und nicht viel von Ideologie hält, aber einiges von Moral. „Unser Verein war ein Weg, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen“, sagt Erik Samuelson. „Damit die Anzugträger – und ich war einer von ihnen – nicht noch mal kommen und uns den Verein wegnehmen. Das ist einfach falsch. Ich habe das sehr starke Gefühl, dass wir recht haben und sie etwas Falsches tun.“ Er trägt nicht mehr gern Anzug. Höchstens zu Auswärtsspielen zieht er einen an, wenn es sein muss. „Dann fühlt es sich wie Arbeit an“, sagt er. „Den Rest zähle ich nicht als Arbeit.“
Erik Samuelson ist ein Teil der Bodenständigkeit des neuen Fanvereins, wenn auch auf andere Weise als Ivor Heller. Wo Heller temperamentvoll und ideologisch und laut ist, ist Samuelson leise und nachdenklich. Immer mit einer Spur von selbstironischem, distanziertem Amüsement. Er ist ein Intellektueller aus Sunderland, Ivor Heller ein Mann mitten aus der Londoner Fanszene. „Wir sind völlig verschiedene Menschen“, sagt Heller. Und doch führen sie seit fünfzehn Jahren gemeinsam den Klub; Samuelson aktuell als Geschäftsführer, Heller als Finanzdirektor. Fragt man Heller, hat der AFC Wimbledon „eine sehr sozialistische Atmosphäre“. Er mag den Geschmack von Revolution und Aufruhr, die Widerborstigkeit. Auch Samuelson mag die Widerborstigkeit; aber auf seine eigene, bürgerliche Art. „Meine Art von Revolte ist es, das zu tun, was ich hier tue. Ich bin niemand, der auf Demos läuft oder Flugblätter verteilt.“ Er klingt, als fände er das völlig abwegig. Zu Hellers Worten wie Punk-Fußball oder Sozialismus schüttelt er lächelnd den Kopf. „Wir sind doch kein Punk. Ich führe den Verein sehr kommerziell. Wir sind kein soziales Experiment. Auch wenn einige Fans vielleicht glauben, wir wären das.“ Dann überlegt er kurz. „Vielleicht sind wir es doch. Aber jedenfalls war das nicht die ursprüngliche Absicht.“
Der AFC Wimbledon entsteht aus der Not einer verlorenen Liebe, nicht aus Anti-Establishment. Aber natürlich ist die Außenwirkung auch ein Stück weit kalkuliert. „Den Leuten gefällt unsere Geschichte vom Kampf des kleinen Mannes gegen die Maschine“, gibt Samuelson freimütig zu. Im kleinen Stadion in Süd-London, das den Namen eines Sponsors trägt, haben sich Pragmatismus und Idealismus verflochten. Manchmal so sehr, dass nicht klar ist, ob sie die Verflechtung spüren. „Wenn man uns mit manchen anderen Fanvereinen vergleicht, dann, ja, sind wir weniger ideologisch“, sagt Erik Samuelson.
Der AFC Wimbledon findet seine Balance mit leichtfüßiger Intuition. Und es ist der innere Strang dieses Vereins, dass hier so unterschiedliche Leute wie Erik Samuelson und Ivor Heller zusammenkommen, ihre Fähigkeiten zusammentragen und beide ihren Sinn finden in einer unterschiedlichen Projektion. Obwohl sie beide etwas völlig Unterschiedliches sehen. Aber beide werden von dem Glauben getragen, dass dieses Projekt die Erfüllung all ihrer Träume ist.
„Ich will einfach nur Fußball gucken.“
2002 ist der Verein ein Blankopapier. Eine endlose Chance, ein Freibrief auf Neustart. Der alte Verein zieht nach Milton Keynes um, und aus dem Verlust wächst das unfreiwillige Privileg, ganz von vorn beginnen zu können. Ohne verkorkste Finanzen, ohne Altlasten, ohne schlechte Verträge – und ohne einen konkurrierenden Mutterverein. Von den rund 12.000 Wimbledon-Anhängern wandert etwa ein Drittel mit zum neuen Klub. All das sind Dinge, die den neuen Verein groß machen werden, bevor sie es selbst ahnen. Der AFC Wimbledon im Jahr 2002 ist ein Projekt auferstanden aus Ruinen; aus den Ruinen von Plough Lane.
Einer von Samuelsons Klienten reißt damals die Tribünen des alten Stadions ab. Er fragt ihn, ob er nicht die Fans holen wolle, damit die sich von ihrem Stadion verabschieden können. Samuelson will. Die Anhänger kommen in Scharen. Sie nehmen sich Stücke von den Tribünen mit. Samuelsons Sohn, damals zwölf Jahre alt, steht im kniehohen Gras. „Ich wollte immer im Mittelkreis der Plough Lane stehen“, sagt er. „Aber ich hätte nie gedacht, dass es unter solchen Umständen passiert.“ Und Erik Samuelson, bis dahin eher stiller Beobachter, fühlt, dass er etwas tun will. Noch bevor von einem neuen Verein die Rede ist, analysiert er, der Wirtschaftsprüfer, auf einer Website die Bilanzen des FC Wimbledon. Er macht es gut, bekommt Aufmerksamkeit. Und rutscht in den Zirkel der politisierten Fans. Seine Geschichte, Rekrutierung via Internet, Aktivist innerhalb von ein paar Wochen – sie ist nicht selten. In den frühen 2000ern paaren sich die finanzielle Not vieler englischer Vereine und die selbstbewusstere Fankultur mit einem dritten Faktor: technischem Fortschritt.
Ivor Heller glaubt, erst das Internet habe die ganze Bewegung möglich gemacht. „Ohne das Internet hätte es keine Fanvereine gegeben“, sagt er. „Plötzlich konnte man miteinander kommunizieren. Man konnte Ratschläge von anderen annehmen und diskutieren. Und man hat gemerkt, dass man in seiner Verzweiflung nicht allein ist.“ In den alten Zeiten, erinnert sich Ivor Heller, ist er nie bei einem anderen Fan zu Hause gewesen. Er sieht die Jungs bei den Spielen, und das ist es. Sie treffen sich im Stadion, sie gehen nachher zusammen saufen, und dann geht man eben irgendwann nach Hause. An diesem Abend oder am nächsten Morgen. Und danach? Führt jeder sein eigenes Leben, eine Parallelwelt in vier Wänden. Die Woche und das Wochenende, das sind unterschiedliche Welten für Ivor Heller. „Fans waren nicht vernetzt. Man hätte niemanden zu Hause angerufen und gefragt: Gehst du morgen zum Spiel?“ Er lacht. „Natürlich geht jeder zum Spiel.“
Mit Foren und Fanblogs und Kommentarfunktionen aber ändert sich der Rahmen. „Das Internet wurde wie ein Kleber“, sagt Heller, „der die Leute zusammengebracht hat.“ Menschen wie Samuelson und Heller, die aus völlig unterschiedlichen Welten stammen, finden im Fall Wimbledon zueinander wie in einer goldenen Prophezeiung von Schwarmintelligenz. Heller geht bei den Protesten in vorderster Reihe; Samuelson, der kokettiert, er sei für so was „viel zu sehr Mittelschicht“, bleibt zu Hause und arbeitet Pläne aus.
Als im Mai 2002 der Umzug des FC Wimbledon nach Milton Keynes beschlossene Sache ist, fügen sich technische Entwicklung, neue Fanorganisation und Krisensituation zu einer Dynamik, die die Beteiligten selbst überrollt. Die aufgeputschten Anhänger diskutieren auf einer Sitzung. Hellers Freund Kris Stewart dreht damals die Stimmung mit einem Satz, der heute zur Vereinsfolklore gehört: „Ich will einfach nur Fußball gucken.“ „War das nicht eine großartige Idee?“, fragt Erik Samuelson. „Der Satz wurde für uns wie ein Mantra. Wir waren alle überzeugt davon.“ Ein Protestverein ohne Ideologie, ohne politische Diskussionen. Einfach Fußball. „Und wir haben keine Sekunde geglaubt, dass wir scheitern könnten. Nie.“
Den Mut und den Glauben bewahren sie, zumindest in der eigenen Erinnerung, gegen Widerstände. „Viele haben anfangs geglaubt, dass wir uns selbst zerfleischen würden“, sagt Erik Samuelson. „Sie dachten, dass Fans nur dazu da seien, die Stadiontribünen zu putzen. Wir haben ihnen metaphorisch beide Mittelfinger gezeigt.“ Er hat sichtlich Spaß daran, unerwartet einen derben Ausdruck einzustreuen. Der AFC Wimbledon gegen das Establishment, da ist es jetzt doch. Natürlich sind das nur zwei Drittel der Wahrheit: Manche mögen zweifeln, aber jeder liebt die Erzählung von den rebellischen Fans und der Neugründung gegen das böse Milton Keynes.
Der AFC Wimbledon weiß, wie man eine Geschichte erzählt. Seine Protagonisten sind talentierte Erzähler; das erste Team wird medienwirksam gecastet. „Wir hatten bessere PR als viele andere Fanvereine“, sagt Ivor Heller geradeheraus. Und: „Wir haben uns nie Grenzen gesetzt.“ Das Sendungsbewusstsein trifft auf einen Zeitgeist, der auf ein Wimbledon gewartet hat. Die Ernüchterung von der Premier League, zehn Jahre nachdem die großen Geldschleusen aufgingen, ist spürbar geworden. Die billigste Jahreskarte beim FC Liverpool kostete 1990 sechzig Pfund für eine komplette Saison. 2017 kostet sie 685 Pfund. „Selbst Vereine wie Liverpool sind von der lokalen Community abgeschnitten“, sagt Autor Jim Keoghan. „Sie haben Fans auf der ganzen Welt, aber die Leute vor Ort können sich keine Tickets mehr leisten. Man könnte diesen Verein nehmen und irgendwo anders hin verpflanzen, und es würde das Geschäft nicht schädigen. Und daran ist etwas falsch. Vereine sollten in der Gemeinschaft verwurzelt sein, sie sollten einen Bezug zu den Menschen vor Ort haben.“
Читать дальше