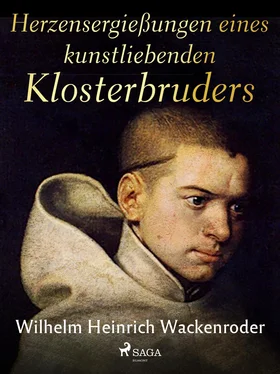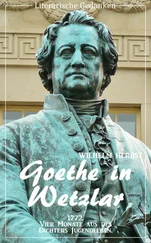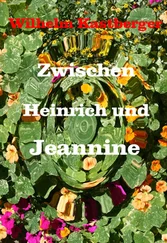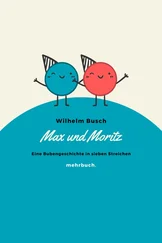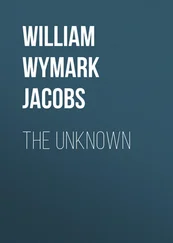Wilhelm Heinrich Wackenroder - Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders
Здесь есть возможность читать онлайн «Wilhelm Heinrich Wackenroder - Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Erstaunlicher mag es dem nicht historisch Denkenden erscheinen, daß Wackenroder an einer anderen Kunst vorüberging, die er allerdings aus lebendigstem Erlebnis kannte: dem fränkischen Barock, der Kunst des süddeutschen Katholizismus. Wackenroder hat Bamberg und Bayreuth gesehen, das Schloß zu Pommersfelden mit dem auch damals berühmten Treppenhaus, das freilich auch seine Reisenotizen „herrlich“ nennen, und Kloster Banz bei Bamberg: das heißt vornehmlich Werke der Barockarchitektenfamilie Dientzenhofer, Er, der norddeutsche Protestant, hat auch die geistige Atmosphäre kennengelernt, in und aus der diese Bauten leben, das katholische Volksleben Süddeutschlands. In seinen Reiseberichten finden wir ausführliche Schilderungen dieser ihm so neuen und sichtlich fremden Welt, etwa der augensinnlichen Buntheit einer Prozession oder eines Hochamts im Bamberger Dom. Es ist müßig, nach katholisierenden Neigungen bei Wackenroder zu suchen oder gar mutmaßen zu wollen, ob er bei längerer Lebensdauer die Schar der romantischen Konvertiten vermehrt haben würde. Die unbefangene, schlichte Frömmigkeit des Klosterbruders ist nicht an konfessionelle Grenzen gebunden, und den „Brief eines jungen deutschen Malers in Rom an seinen Freund in Nürnberg“, eines Jünglings, der ähnlich wie Schillers Mortimer unter dem überwältigenden Eindruck der sinnlichen Pracht und Gewalt des katholischen Gottesdienstes zum Papsttum übertritt, hat wieder der beweglichere Tieck geschrieben. So reich die Anregungen im Frankenlande flossen: das Wesen der Barockarchitektur bleibt Wackenroder ebenso fremd wie die Denkmäler romanischer oder gotischer Plastik, die ihm in Bamberg oder Nürnberg begegnen. Gewissenhaft notieren die Tagebücher wie anderes so auch bautechnische Einzelheiten, aber es bleiben aufgezeichnete „Merkwürdigkeiten“ des Bildungsreisenden, die nicht zum seelischen Erlebnis anverwandelt werden, und der hymnische Ton, den wir aus den „Herzensergießungen“ kennen, klingt in den Selbstzeugnissen fast nur einmal auf, als der Dichter vor dem lieblichen Wunder der Madonna zu Pommersfelden steht, die seine Zeit noch dem geliebten Raffael zuschrieb.
Den Geschichtskundigen wird solches scheinbare Versagen nicht überraschen. Es ist die Blindheit einer ganzen Epoche, eine Tatsache von geistesgeschichtlicher Notwendigkeit. Die Entdeckung der Barockkunst ist ein viel jüngeres Ereignis. Erinnern wir uns, daß noch Jacob Burckhardt, dem niemand Mangel an anschauender Kraft vorwerfen wird, in ihr lange Zeit nichts zu sehen vermochte als einen verwilderten Dialekt der Renaissance. Erst in Burckhardts Spätzeit macht sich eine leise Umwertung bemerkbar, aber die volle kunst- und auch dichtungsgeschichtliche Würdigung — und nicht selten nun Überwertung — des Barocks ist erst eine Tat der letzten Jahrzehnte.
Daß diese süddeutsche, katholische Luft für den Dichter dennoch von größter Bedeutung war, hat Richard Benz gezeigt. Sie lehrte ihn das Verständnis für eine gewachsene und ursprüngliche Kultur, in der noch Leben, Kunst und Religion verschmolzen und eins waren und aus deren Mutterboden die Kunst mit allen Wurzeln Nahrung sog. An der Kunst des Barocks und Rokokos — trotz vereinzelter Worte der Anerkennung und selbst Bewunderung — vorüberzugehen, war Wackenroders Zeitschicksal; dennoch sind die „Herzensergießungen“ auch insofern eine Frucht des süddeutschen Aufenthalts, als sie dies Erlebnis eines geschlossenen kulturellen Ganzen auf die Zeit und die Künstler der italienischen und deutschen Renaissance übertragen.
Endlich erscheint es merkwürdig, daß ein romantisches Herzthema so ganz in diesen Aufsätzen zurücktritt: die Landschaft, die bei den Malern Runge und Friedrich zum Ausdruck ihrer religiösen Gefühle wurde und die aus der romantischen Dichtung, Wissenschaft und Philosophie nicht wegzudenken ist. Wackenroder scheint, ähnlich wie etwa Hoffmann, kein tieferes Naturgefühl besessen zu haben, und erst in Tiecks Roman „Sternbald“ ist von einer symbolischen und religiösen Landschaftsmalerei die Rede.
Die zweite Macht, die das kleine Buch beschwört, ist die Musik. Wackenroder hat eine ziemlich gründliche musikalische Ausbildung genossen. Er wurde von Fasch, dem Begründer der Berliner Singakademie, unterrichtet und hat später auch bei Goethes Altersfreund Zelter Kompositionsstudien getrieben, er verkehrte zusammen mit Tieck in dem musikfrohen Hause des damaligen Berliner Opernkapellmeisters Johann Friedrich Reichardt, der als Liederkomponist namentlich Goethescher Texte bekannt wurde, er hat schließlich in Göttingen bei. dem dortigen akademischen Musikdirektor und Musikhistoriker Johann Nikolaus Forkel, dessen etwas späteres Buch über Johann Sebastian Bach (1802) auch ein Zeugnis romantischen Geistes ist, seine musikgeschichtlichen Kenntnisse erweitert. So darf er uns im alten, guten Sinne als Kenner und Liebhaber gelten.
Auch die Musikanschauung Wackenroders ist wie seine Auffassung der bildenden Kunst bestimmt durch eine antirationalistisch-gefühlshafte Einstellung, die, historisch gesehen, wieder im Gegensatz zu der überwiegend das Handwerkliche und Technische betreffenden Musikkritik vor 1800 steht. Stärker noch als in den Betrachtungen zur bildenden Kunst wird hier ein autobiographisches Element sichtbar. Das schmerzlich-süße Leben des Joseph Berglinger, sein Leiden an der Kunst und für die Kunst, sein zerstörender Zwiespalt und sein früher Tod, ist die Geschichte von Wackenroders eigener Seele und sein eigenes, erahntes Schicksal. Er hat wie sein Held unter dem Generationsgegensatz zum Vater gelitten, und Berglingers Urkonflikt zwischen heiliger Kunst und profaner Weltwirklichkeit ist der seine.
Dies ist der Ausgangspunkt für seine Musikanschauung: auch die Tonkunst ist göttliche Eingebung und heilige Sprache, die, rätselvoll und unerklärlich, das in Worten Unsagbare auszudrücken vermag. Nur sie ist unmittellbare Aussprache des Gefühls. Das menschliche Wort kann die Vorgänge in der Seele nur benennen und über sie reden: die Musik ist die Empfindung selbst, sie allein hat die Kraft, den Strom in den Tiefen des menschlichen Gemüts unmittelbar zu erfassen. „Die Sprache zählt und nennt und beschreibt seine Verwandlungen in fremdem Stoff; — die Tonkunst strömt uns ihn selber vor. Sie greift beherzt in die geheimnisvolle Harfe, schlagt in der dunkeln Welt bestimmte dunkle Wunderzeichen in bestimmter Folge an — und die Saiten unsers Herzens erklingen, und wir verstehen ihren Klang.“
Aber die Musik ist Wackenroder nicht nur Sprache der menschlichen Seele und ihrer Schmerzen und Freuden, sie ist zugleich Ursprache, Urlaut der Natur. „Alle tausendfältigen lieblichen Melodien, welche die mannigfaltigsten Regungen in uns hervorbringen, sind sie nicht aus dem einzigen, wundervollen Dreiklang entsprossen, den die Natur von Ewigkeit her gegründet hat?“ Von dieser Geistermusik der Natur hat auch E. T. A. Hoffmann oft gesprochen, es ist romantischer Glaube, und das musikalische Gegenstück zu Wackenroders Worten ist das Rheingold-Vorspiel des Spätromantikers Richard Wagner, wo alles Leben der Töne aus dem Urlaut des Wassers, dem wogenden Es-dur-Dreiklang des Eingangs, aufsteigt. Die Landschaft hat ihre eigene, geheimnisvolle Stimme, die der begnadete Mensch wecken und erlösen kann, und die Welt fängt an zu singen, wie Eichendorffs Verse es aussprechen, wenn er das Zauberwort kennt. Deutete doch die Romantik selbst die Töne der vom Menschen aus Holz oder Metall, den Stoffen der Natur, geschaffenen Instrumente so als Naturlaut, entbundene und erlöste Stimmen der Schöpfung.
Mehr noch als jeder andere Künstler ist für Wackenroder-Berglinger der Musiker ein von Gott Geheiligter und Berufener und seine Kunst Gottesdienst. Noch nie zuvor war das psychologische Problem des Künstlers so tief erfaßt worden wie in Wackenroders Musikaufsätzen: eine spezifisch romantische Fragestellung. Die überwältigende Wirkung der Tonkunst auf die Seele ist das Hauptthema, das Hören und innerliche Verarbeiten der Tonfluten, das Leben mit und in jener Musik, von der Berglinger sagt, daß sie ihn innerlich erschlaffe und verzehre — das gleiche Geständnis kehrt in Wackenroders Briefen an Tieck wieder —, aber auch, daß sie ihn von der Welt scheide und wie auf Flügeln zum Himmel erhebe. Von dieser überirdischen Macht erzählt das den „Phantasien“ eingefügte „Märchen von einem nackten Heiligen“, der, ein Spiegelbild romantischer Künstlertragik, auf Erden gequält und zerrissen wie Sankt Antonius in seinen Versuchungen, durch die Gewalt der Musik erlöst wird und zum Himmel auffährt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.