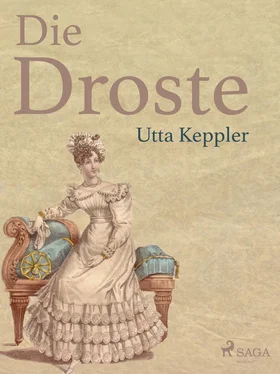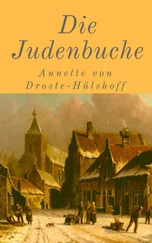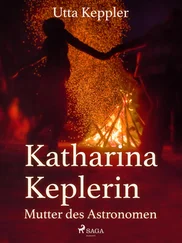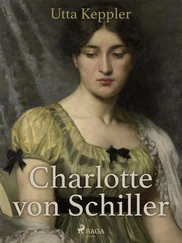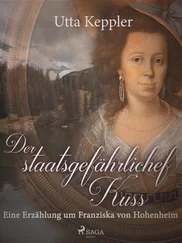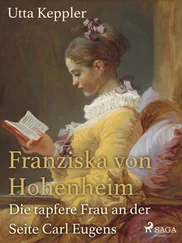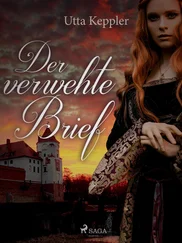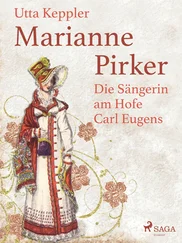Annettes »Dichtereien« sind für sie scharfsichtige Spiegelungen der Wirklichkeit, keine Deutungen, nur Abbilder; und die lassen sich auch mit hübschen Aquarellen leisten, wie sie Jenny fertigt, mit feingekräuseltem Baumgewebe und exakten Perspektiven von Mauern und Türmen.
Am Vorhandenen, Gegebenen durfte ein Mädchen aus ihrem Kreis zustimmend teilhaben, nicht ergreifend, eingreifend, gestaltend, schöpferisch.
Aber endlich entdeckt Frau von Hülshoff, trotz aller vorsichtigen Scheu der Tochter, in Jennys Nähkasten ein Gedicht. Es ist nur ein Vers, kurz und vielleicht das Fragment eines langen Poems, das sie der lieben Schwester anvertraut hat, und Frau von Droste fühlt sich nicht sehr wohl dabei, ihn zu lesen – aber doch verpflichtet, es zu tun – Annette – ach, dieses bedrückende seltsame Kind!
Fesseln will man uns am eig’nen Herde,
Uns’re Sehnsucht nennt man Wahn und Traum,
Und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde,
Hat doch für die ganze Schöpfung Raum!
Das tut nach Schiller: Versmaß und Rhythmus, auch der Gedanke ist schillerisch, denkt die Mama. Und seltsam männlich empfunden, das krasse realistische »kleine Klümpchen Erde« …
Sie haben bei ihren Leseabenden auch den »Don Carlos« gelesen – »Sire, geben Sie Gedankenfreiheit« – und sind nicht so sehr der »Gedanken« wegen als vielmehr des riesenhaften, im Staatsganzen verderblichen Wortes »Gedanken freiheit« ein wenig erschrocken. Man sollte nicht so weit gehen mit der Eigenmächtigkeit – und Annette, das Mädchen, schon gar nicht.
Aber es hat schon mancherlei Aufsehen gemacht, daß ihre Tochter, die sonst sonderlich, ja widerborstig schien, von belesenen Leuten wegen ihrer Reimerei bewundert wurde; und da man das nicht ungeprüft verwerfen und auch nicht kritiklos gutheißen konnte, fiel der Therese ein, den Professor Sprickmann beizuziehen, einen bekannten Literaten, der mit der Fürstin Gallitzin, höchster Dame des literarischen Münster, und sogar mit einigen ehemaligen Hainbündlern, halbverblühten Romantikern und Balladendichtern, verbunden war.
Sprickmann, Anton Matthias, wohnte auf dem Krummen Timpen, dem Drosteschen Stadthaus gegenüber. Der würde, wenn er auch wohl das »Fesseln« in Annettes Vers nicht guthieß und nicht ernst nahm – das war tröstlich –, doch einen Ausweg wissen aus dem Irrsal, in dem sich die Tochter offensichtlich verfangen hatte, und das – erkannte Therese – konnte nicht ohne das Ventil des Dichterischen geschehen, sonst würde Annette kaum auf seine Lenkung eingehen.
Am Anfang des Jahres 1812, Annette war fünfzehnjährig, kam man bei einer Teevisite mit Sprickmann zusammen. Es war ein alter Herr mit rötlichem Gesicht, jugendlich aufmerksamen Augen, einem kleinen, schmalen Mund und einer auffallend hohen Stirn unter zurückgekämmten weißen Haaren.
Annette hatte ihn hie und da auf der Straße gesehen, und da er ihr nicht vorgestellt war, nicht gewagt, ihn auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt war sie sehr gespannt, ihn kennenzulernen.
Sie wurde unter Anleitung der Mama besonders sorgsam angezogen, und als sie sich im Spiegel betrachtete, lachte sie: dieser Aufbau von unten nach oben, auf breiter Basis mit vielerlei steifen Volants, Tüll und Gaze, in schmalem Dreieck nach oben getürmt bis zur hochgegürteten Taille mit den Schleifen zwischen Schinkenärmeln, und darüber, krönend, das winzige Kapotthütchen, das beim Tee nicht abgenommen wurde, zwischen den seitlich gebauschten Locken.
Aufgeputzt wie ein Paradepferd, nein, ein Zirkusgäulchen, dachte sie, fehlen nur noch die Glöckchen. –
Nun, der Professor saß behaglich zwischen dem rauschenden, aufgebauschten Damenflor und ließ gelassen Mißtrauen und Neugier um sich herum aufzüngeln, als Annette mit der Mama hereinkam.
Vorstellung, Knickse, Annette ist blaß, verlegen, besinnt sich dann, von der Mama nach vorn geschoben, und reicht dem alten Herrn die Hand, der sie aufschauend nimmt. Er sagt freundlich: »Fräulein von Droste – ich habe davon gehört, daß Sie dichten.«
Das klingt reichlich unverbindlich, und die Mama, die mißmutig und ungeduldig dabeisitzt, fällt ein:
»Wir haben einiges derart mitgebracht.«
Annette hätte sich am liebsten in den Boden verkrochen, so peinlich ließ sich alles an.
Aber sie sagte »ja« und bat dann sehr leise, zuerst und vielleicht überhaupt etwas auf dem Clavichord vortragen zu dürfen – alles falle ihr da leichter.
Man wunderte sich, die Mama war ärgerlich, aber Sprickmann nickte heftig: Da die Baroneß Gedichte schreibe, wisse sie wohl selber, daß Musik und Lyrik enge Verwandte seien, und auch die griechische Sappho habe ja die Leier geschlagen. Also bitte!
Annette schaute ratlos zur Mama hinüber, da sie weder Noten bei sich hatte noch das Instrument kannte; aber endlich setzte sie sich vor den unbekannten Kasten, der ihr beinah feindselig seine weißen Tastenzähne entgegenbleckte. Sie strich darüber, um sie sich bekannt und vielleicht doch gefügig zu machen, und schlug einen Ton an, dann einen Akkord.
Daß ein paar Damen amüsiert und gelangweilt-spöttisch hinter den Fächern lächelten, merkte sie nicht. Aber jetzt schien das tote Ding da vor ihr doch aufzuwachen, sich ihren Fingern anzuschmiegen und bereitwillig das in Tönen von sich zu geben, was Annette von ihm wollte.
Das tat wahrhaftig anders als die gewohnten gewöhnlichen Stückchen; es ließ sich leise, fast ängstlich an, zeichnete kleine dünne Arabesken wie Filigran oder Eisblumen am Fenster, und fuhr dann in lauten, wilden Bögen über die Hörer hin, rhythmisch, gewiß, in große Gruppen geordnet, tönend wie Wellen, regenbrausend, windpfeifend, und versickerte mit einem zierlichen Gegenornament, im hohen Diskant, wie ihn das Chlavichord sonst gar nicht hergegeben hatte.
Danach saß Annette, die gefalteten Hände zwischen den Knien, mit gesenktem Kopf auf ihrem Stühlchen, schwindlig vor ungeheurer Anspannung, bis Sprickmann aufstand und laut händeklatschend hinter sie trat, so daß sie entsetzt zusammenfuhr.
Jetzt fühlten sich auch die übrigen Gäste veranlaßt, mitzutun, man schlug die behandschuhten Händchen gegeneinander, die Herren taten ähnliches, murmelten beifällig, einer verneigte sich vor der Frau von Hülshoff und gratulierte ihr.
Als dann der Professor doch nach den Versen fragte, sagte Annette mit einer rauhen Stimme, gleichförmig, wie angelernt, sie werde ihm etwas schicken …
Was sie da gespielt hatte, war ihr einfach so eingefallen – einfach? Das freilich nicht – sie hatte oft gespielt im engeren Kreis, und oft genug auch aufgeschrieben, was sie komponiert hatte; Notenlinien waren ihr früh zugebracht, früh die Harmonielehre beigebracht worden – der Vater komponierte, die Schwester auch, sie sang, und in den altadeligen Häusern war es üblich und beinah zwanghafte Sitte, daß man – und vor allem die Töchter – malte, schrieb, reimte, musizierte – mehr oder weniger begabt, nie überragend.
Denn auch in die wasserverschlossenen, begrenzten und beengten Sitze sickerten Gedanken und Gefühle ein, die in der geistigen Welt schwelten, schwangen und strömten; Annette spürte das wie Luft und Wasser um sich und in sich, es forderte sie und griff nach ihr, aufgeregte und überhitzte Empfindungen, Schwärmereien, die in ihrem Alter lagen, und die sich als eine manchmal unbändige Treibhausluft auch in den Strebungen der Dichter, der Künstler, im Stil der Freundschaften bewegten – seltsames Gegeneinander von schwärmendem Vaterlandsgefühl und Fremdenhaß gegen den korsischen Eroberer, und darüber edelste religiöse Begeisterung und Versinken in einer oft nebulösen Mystik, Sehnsucht nach einer Heldenvergangenheit und zugleich nach der Unio Mystica.
Freundschaften, glühende Briefe und Reime, gefühlsschwere Musik und solch jugendlich beschwingte und übersteigerte Luft wehten auch in die streng katholisch bestimmte Welt der Annette hinein: Es war nichts Krankes oder Abartiges, aber das Schöpferische in ihr dehnte sich glücklich bewegt, und sie verehrte, liebte demütig und manchmal kritiklos kluge Frauen, musisch regsame Männer, in denen sich aus dem Zug zur verklärten Vergangenheit gelehrtes Forschen und wissenschaftliche Akribie entwickelten.
Читать дальше