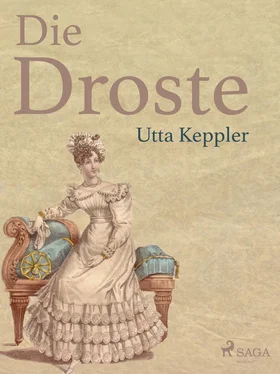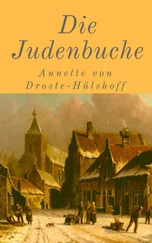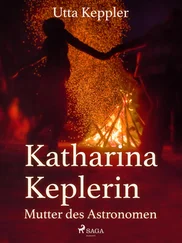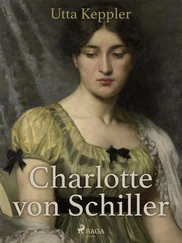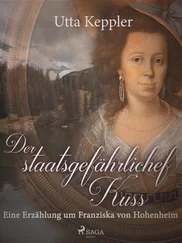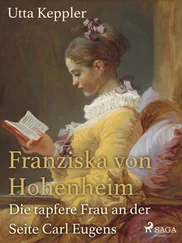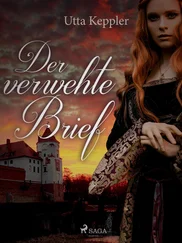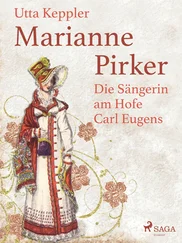Bin ich nun hier auf der alten Meersburg, am Gitter und seh’ auf den nebligen süddeutschen See? Oder bin ich das Kind im Wasserschloß, in Hülshoff oder Rüschhaus, das man ein bißchen schonen muß, weil ihm die Aufregungen der Zeitläufte schaden könnten? Oder bin ich beides zugleich? Das ist mein Fluch und mein Segen, sagt sich die hinschwindende, schwache Frau, die da sitzt oder ab und zu geht zwischen Zimmer und Balkon, zwischen nebelhafter Feuchte und warmem, holzduftendem Gehäus und Einschlupf: so war es immer, das Dazwischensein, wechselndes Spiel, tragisches Spiel, kein vergnügliches, zwischen scharfsichtig registrierter Düsternis, schattenhafter Ungreifbarkeit und dem gesicherten, sichernden, uralten und so wohlbekannten Bannkreis, dessen Töne und Gerüche sie fast nicht mehr erträgt …
Annette liegt endlich in ihrem schmalen Bett, sinnt und träumt ein wenig vor sich hin, beobachtet den Mondstreif an der Decke, hört irgendeinen Nachtvogel fern gedehnt rufen, sieht das Biegen und Sichverschränken der Schattenzweige am Fenster – und endlich kann sie schlafen.
In ihren Schlummer schleicht sich vieles hinein, was früher war; sie klettert wieder als Zehnjährige auf den höchsten Punkt, den sie sich in der Wasserburg vorstellen kann, bis zu den Dachsparren des Turmes hinauf, die knarrende, steile, in der Hitze nach staubigem Holz duftende Treppe und bis zum Boden, wo das kleine runde Fenster hinausweist zu den Firsten ringsum, zu den Dohlenwohnungen und Krähenanflügen – und da irgendwo, unter einem Dachsparren, versteckt sie hastig etwas Goldenes: in Goldpapier gewickelt, ihr erstes Gedicht.
Sie spürt träumend und schauend einen unbändigen Stolz, keine Eitelkeit, aber Gewißheit: Sie hat gedichtet.
Und wie das mit Träumen ist – es bleibt ihr beim Erwachen ein Bild, eine Grundstimmung, eine Empfindung: begnadet, erwählt, bestanden.
Weiß Gott, bestanden? Hat sie denn getan, was ihr aufgegeben war? Mühsam richtet sie sich hoch, mit steifen, schmerzenden Gliedern, feuchter Schweiß dunstet den Rücken hinauf, die Augen sind noch eingeschleiert, trüb der Blick; es dämmert durch die Gardinen, sie hört Vogelschreie von drunten über dem Wasser.
Langsam steht sie auf, wäscht sich in der kleinen Porzellanschüssel – der Krug ist nur halbvoll, das Wasser kalt – so will sie vollends wach werden.
Sie zieht sich umständlich an – die vielerlei Unter- und Drüberhüllen sind lächerlich, die Tournure, die Schals – und zum Haareflechten kommt das Mädchen, das ihr ein Tuch umlegt und vorsichtig die angegrauten Strähnen kämmt und bürstet; sie reden kaum miteinander, der Morgen ist bleischwer.
Ich trage so viel Schicksal mit mir herum – was für ein großtönendes Wort – Geschick, Geschicktes …
»… solange noch das ew’ge Licht / Auf mich mit Liebesaugen blickt …« Das hat sie leise vor sich hingesagt, und das Mädchen hält einen Augenblick ein, es meint, sie bete.
Es war auch ein Trost, was sie sich da vorsprach, gegen den immer unterschwellig pochenden Vorwurf, sie habe nicht genug getan: der Mama nicht genügt, dem großen Anspruch ihrer Begabung, dem Leben.
Jetzt schaut sie hinaus in das aufsteigende Helle, über dem leise flutenden Element, dem gefurchten Wasserbett, sieht am Himmelsrand das Rote wachsen, das blitzende Gelb, in Streifen aus Ocker und Cadmium, Grün dazwischen, längsgedehnt über dem diesigen Grau. Da schwingen sich die Vögel in runden Bögen, als wollten sie ein lang geübtes Ornament tanzend aufzeigen, während vor ihnen, hinter ihnen und rings um sie herum die glühenden, blitzenden, schimmernden Lichtfunken springen, mit denen das große Wasser die Sonne grüßt. »Das ew’ge Licht« – da brennt es: Sonne, strahlende Königin, Bild und Thronsitz Gottes, mit dem Annette redet, graue Dohle, die sie ist, und doch sein Kind, sein gnadenvoll betautes Geschöpf.
Sie war wahrhaftig nicht immer »gnadenvoll betaut« gewesen, man hatte sie verächtlich die »Spillerige« genannt, weil sie mager, ungeschickt, unachtsam, tapsig und ungraziös genug war, um bei den Aufenthalten im »Krummen Timpen«, dem Münsterschen Stadthaus, keinen Ball ohne »kleines Debakel« zu überstehen, ohne Anstoßen oder Auffallen; und das westfälische Wort meinte auch ihre schmächtige Gestalt und das schmale, fast hagere Gesicht.
Die Mama sah ihr sorgenvoll nach, wenn man sie mühsam mit Schleifchen und Pölsterchen herausgeputzt zum Tanz mitnahm, obwohl sie mit den großen blauen »seetiefen« Augen hübscher war als Jenny …
»Gnadenvoll betaut« – das wußte eigentlich nur sie selber, und oft genug war sie sich dessen nicht sicher.
Das spürte sogar die Mama und forderte an den Leseabenden, wo man sang und musizierte, ihre Mitarbeit und Vorführung und machte sie damit manchmal verzweifelt und verstört und widerspenstig; nur wenn man sie bat, mit ihren Versen herauszutreten aus der verstockten Schüchternheit, riß es sie hin: Dann wurde sie nach den ersten Zeilen, die sie leise und stockend las, auf einmal ein anderes Geschöpf, glühend, sprudelnd, begeistert und sicher, und las im Fluß und Klang, als spräche ein anderes Wesen aus ihr. Nachher saß sie dann wie ausgeleert und erschöpft in der Sesselecke.
Im »Krummen Timpen« ist sie nicht so gern wie im Wasserschloß, obwohl es da trockener, wärmer, eigentlich behaglicher ist als draußen. Aber es ist »Stadt«, Häuser, von denen das Hülshoffsche eins der imposantesten ist, wo man Wagen vorbeikarren, -trappeln, -schleifen hört – Geräusche, keine Töne; Töne hat der Baum im Wind, die Blätter, die sprechen, die Zweige, mit denen jeder Baum anders reden will, und in denen kleine Vögel die Triller setzen zu einem leise gemurmelten Continuo, hüpfende schlüpfende Vögel, die über ihr die Blattkronen in ständiger Bewegung halten.
Und von unten, neben ihr, das glucksende Wasser, das still wartende, in dunklen Grüntönen und Braunschatten, auf dessen Fläche die Kreise aufbrechen, Rundbogen und konzentrische Bewegung, wenn ein schwarzer Fisch sein winziges Maul durch den Spiegel steckt oder eine Fliege auf dem Tümpel aufsetzt.
Die Mama betreibt freilich das andere, das Menschenwesen, das Gesellschaftsspiel und Formgetändel, andere Schönheiten, die Annette manchmal als Flitterkram sieht.
Jenny macht alles gutwillig und vergnügt mit, das umständliche Ankleiden mit geschnürter Taille, angesteckter Spitze, aufgetürmter Frisur und angenähten Seidenblumen.
Mitunter amüsiert es sie selber auch, die ernste Annette, die manchmal unmotiviert grell lacht, die immer irgendwo anders ist in Gedanken und Empfindung, andere Maßstäbe setzt, und die Leute um sich herum spüren läßt, daß sie sich eigentlich langweilt.
Dann sieht Frau von Droste zu ihr hinüber mit einem scharfen Blick aus sehr dunklen Augen, sie sagt nichts, schließt einen Augenblick die Lider, das Kind versteht …: Haltung, Würde, Benehmen, das alte Geschlecht, ein Adelsfräulein, die nötige erhoffte Heirat – alles in Rahmen und Schranke – jahrhundertelang erprobt und damit geheiligt. Die Mama nimmt dann nach solchen Abenden, genau beobachtend, das seltsame und eigentlich anstößige Talent des »Kindes« doch ernster und nicht nur als peinliche Absurdität.
Annette spürt das wohl, die vornehme Gerechtigkeit ihrer Mutter, den noblen Sinn, der keinem Unrecht tun will, wie die Freiin auch den Anvertrauten, Inst- und Dienstleuten, Flüchtigen und Armen als Verantwortliche gegenübersteht. Noblesse oblige – Adel verpflichtet.
Annette sieht das nicht bewußt, es ist ihr eingewachsen, wie es seit Jahrhunderten die Berechtigung bedeutet, über Land und Güter und Wälder und Weiden zu gebieten – Annette achtet das, verehrt die Mutter dafür, fühlt sich zugehörig und aufgehoben, sogar gehoben im Kreis einer erwählten Gesellschaft, der sie – von Gott – eingefügt worden ist. Nur: die Noblesse der herrscherlichen Mutter ist eine Duldung, fast widerwillige Langmut, hinter der die Zuversicht steht, das alles möge nur ein Übergang sein und »sich auswachsen«.
Читать дальше