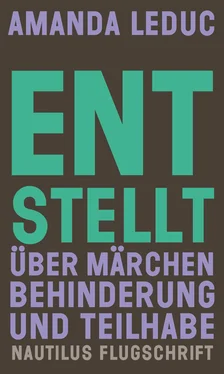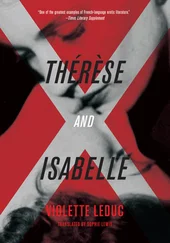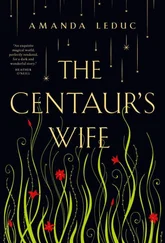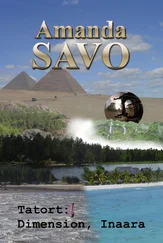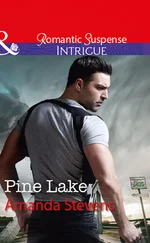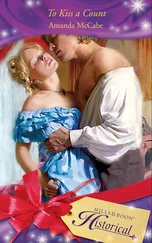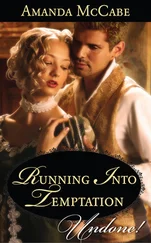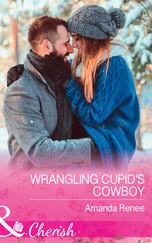Es ist ungerecht, dass behinderte Menschen eine Extrawurst bekommen. Es ist ungerecht, dass behinderte Menschen bessere Parkplätze und Ermäßigungen bekommen, dass sie ihre Begleithunde mit ins Restaurant nehmen dürfen. Es ist ungerecht, dass behinderte Menschen zu Hause bleiben können, während die anderen arbeiten müssen! )
Die Gegenüberstellung von medizinischem und sozialem Modell von Behinderung funktioniert oft auch im Sinne der Dichotomie glücklich/unglücklich, wobei die Entscheidung, welches Modell für das Happy End steht, Ansichtssache ist: Für Befürworter*innen des medizinischen Modells ist ein Leben mit Behinderung unglücklich, weil die Medizin Abhilfe schaffen könnte; Befürworter*innen des sozialen Modells betrachten die Aussicht auf Heilung als unglücklich, weil es die Gesellschaft nicht nur von der Verantwortung entbindet, die Umgebung insgesamt zu verbessern, und stattdessen dem Individuum die Pflicht zur Veränderung auferlegt, sondern auch, weil sie die körperlichen Unterschiede und die damit einhergehenden Erinnerungen auslöscht, die die Welterfahrung von behinderten Menschen oft prägen.
Wer wäre ich, zum Beispiel, wenn ich nicht mit der Zyste im Gehirn geboren worden wäre? Meine Erfahrungen im Krankenhaus, die Operationen, mein Leben mit Rollstuhl und Gehhilfen, mein Hinken und das damit zusammenhängende Mobbing – all das hat mich geprägt. Ohne die Zyste hätte ich heute ein anderes Leben. Ich wäre nicht die, die ich heute bin.
In Disability Theory entwickelt Siebers eine Theorie, die er complex embodiment (komplexe Verkörperung) nennt, wonach Elemente sowohl des medizinischen als auch des sozialen Modells den Weg des Körpers durch die Welt lenken. »Die Theorie der komplexen Verkörperung«, schreibt er, »schärft das Bewusstsein dafür, wie behindernde Umgebungen die gelebten Körpererfahrungen behinderter Menschen beeinflussen, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass einige mit Behinderung einhergehende Faktoren, etwa chronische Schmerzen, sekundäre gesundheitliche Folgen und Altern, vom Körper herrühren.«
Tatsächlich ist es möglich, sowohl von der Gesellschaft als auch durch Schmerzen behindert zu werden, sowohl mit dem vorherrschenden Ableismus als auch mit der Einzigartigkeit des eigenen Körpers und seinen Herausforderungen zu ringen. Behinderung und Nichtbehinderung sind bloß einzelne Punkte im enormen Spektrum menschlicher Vielfalt, und überhaupt auf der Welt zu sein, bedeutet, irgendwo auf diesem Spektrum zu sein – in irgendeiner Weise, Form oder Gestalt.
Analog zu diesem Spektrum von Behinderung ist ein entsprechendes Spektrum von Glück denkbar, auf dem Glück und Unglück, wie Behinderung und Nichtbehinderung, nicht in statischer Form existieren, sondern als dehnbare, veränderliche Eigenschaften. So wie es möglich ist, von Nichtbehinderung zu Behinderung zu gelangen – und durch medizinische und soziale Innovationen auch in die umgekehrte Richtung und wieder zurück –, ist es möglich (und tatsächlich sogar wahrscheinlicher), von Glück zu Unglück und wieder zurück zu gelangen, und das immer wieder im Laufe des Lebens.
Das dürfen wir nur nicht der Prinzessin erzählen. Was bleibt von ihr, wenn sie nicht ihren Prinzen heiraten kann?
In dem Grimm-Märchen ›Das Mädchen ohne Hände‹ besucht der Teufel in Gestalt eines alten Mannes einen Müller und verspricht ihm Reichtümer, wenn er ihm überlässt, was sich hinter seiner Mühle befindet. Der Müller denkt, der Teufel meine einen alten Apfelbaum, und willigt freudig in den Handel ein. Er geht nach Hause, wo seine Frau überglücklich ist über die Juwelen und das Geld, das plötzlich aus allen Schränken quillt, und erst da entdeckt er die Wahrheit: Als er den Handel mit dem Teufel schloss, stand auf der Rückseite der Mühle seine Tochter, wunderschön und fromm.
Nach drei Jahren kommt der Teufel zurück, um das Mädchen zu holen. Zuerst zieht sie einen Kreis um sich und reinigt sich mit Wasser, so dass er nicht zu ihr gelangen kann; als der Teufel darauf wütend den Vater anweist, das Wasser aus dem Haus zu schaffen, weint sie auf ihre Hände und reinigt sie mit ihren Tränen.
»Hack ihr die Hände ab!«, befiehlt der Teufel, und der verängstigte Vater tut, was er verlangt.
Doch das Mädchen weint auf ihre Stümpfe, so dass sie wieder rein sind und der Teufel sich geschlagen geben muss. Der Vater, nun ein reicher Mann, verspricht, sich für den Rest ihres Lebens um die Tochter zu kümmern, doch sie will nicht bleiben. Sie bittet den Vater, ihr ihre abgetrennten Hände auf den Rücken zu binden, und liefert sich der Gnade der Welt aus.
Als sie zu einem königlichen Garten gelangt, fällt sie hungrig auf die Knie und fleht laut zu Gott. Da erscheint ein Engel, der sie in den Garten lässt und ihr Früchte vom Baum bringt. Doch sie wird entdeckt und der Engel verschwindet. Die Wachen halten sie für eine Diebin und werfen sie in den Kerker.
Sie wird vom König gerettet, der sich in sie verliebt. Zur Hochzeit schenkt er ihr ein Paar silberne Hände, die sie statt ihrer echten Hände benutzen lernt. Doch der Teufel, immer noch wütend über seinen vereitelten Plan, ist noch nicht am Ende. Ein Jahr nach der Hochzeit zieht der König in den Krieg und das Mädchen, das nun eine Königin ist, gebiert einen Sohn. Der Teufel fängt den Boten ab, der die freudige Nachricht dem König überbringen soll, und gibt ihm eine falsche Botschaft mit, der zufolge die Königin einen Wechselbalg zur Welt gebracht hat. Als der König die falsche Nachricht liest, ist er verzweifelt, doch da er seine Frau immer noch liebt, schickt er den Boten mit der Nachricht zurück, dass seine Frau und sein Kind geschützt werden müssen.
Doch der Teufel schiebt dem Boten wieder einen gefälschten Erlass unter, der besagt, dass die Königin und das Kind getötet werden sollen. Die alte Mutter des Königs verhilft den beiden zur Flucht aus dem Schloss, und das Mädchen ohne Hände irrt erneut durch die Welt, diesmal mit ihrem Kind.
Sie gelangen zu einer Hütte im Wald, wo ein Engel erscheint und der Königin sagt, dass sie hier unbehelligt bleiben kann. Vierzehn Jahre leben sie dort, bis der König – der sieben Jahre im Krieg war und dann, nachdem er von der Tücke des Teufels erfuhr, weitere sieben Jahre die Wälder nach seiner Familie durchsuchte – sie endlich wiederfindet. Sie kehren zurück ins Schloss und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
Die Hände der Königin sind zwischenzeitlich nachgewachsen, so wie Hände im Märchen es eben tun, wenn man nur genug betet.
Wechselbalg ist an sich ein interessanter Begriff, der schon immer untrennbar mit Zauberei verbunden war. Im irischen Volksglauben hielt man Wechselbälger für Kinder von Feen, die mit gesunden Menschenkindern vertauscht worden waren. Feenkinder galten als kränklich und man ging davon aus, dass sie nicht lange leben würden. Familien setzten deshalb ihre »Wechselbälger« draußen in der Kälte zum Sterben aus, in der Überzeugung, sie hätten ihr eigentliches Kind für immer verloren.
Dem Glauben nach vertauschten die Feen die Kinder aus verschiedenen Gründen: damit sie ihnen Gesellschaft leisten oder sie bedienen, oder auch, um sich an den Menschen zu rächen. Gewöhnlich kam der Verdacht, dass ein Kind ein Wechselbalg ist, gleich nach der Geburt auf; in einigen Fällen aber auch erst Jahre später. 1827 ertränkte eine Irin einen ihr anvertrauten drei Jahre alten Jungen im Fluss Flesk, weil er weder sprechen noch laufen konnte und sie »ihm den Wechselbalg austreiben« wollte; 1895 wurde die Irin Bridget Cleary von ihrem Ehemann und anderen Verwandten nach einer kurzen Krankheit ermordet, wobei der Ehemann sich auf die später berüchtigte »Feen-Verteidigung« berief.
Bezeichnenderweise hing der Wechselbalg-Verdacht direkt damit zusammen, ob ein Kind bei der Geburt sichtbare Anzeichen von Behinderungen aufwies oder in seiner späteren Entwicklung ein Verhalten zeigte, das zu jener Zeit als befremdlich galt. So hielt man im 19. Jahrhundert autistische Kinder für Feenkinder: Die Vorstellung, dass Feen viel Zeit mit repetitiven Aufgaben verbringen – etwa dem Zählen von Goldmünzen –, verweist auf dokumentierte Aspekte autistischen Verhaltens. (Wenn es keine weltliche Erklärung gibt, muss es gewiss eine magische Erklärung geben.)
Читать дальше