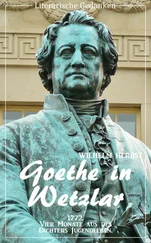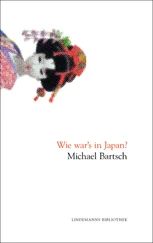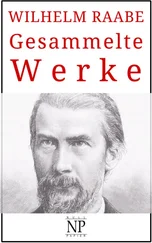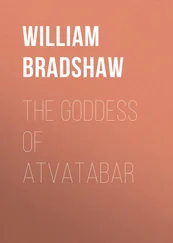Als sich Meckel zu einem für so ein junges Mädchen noch unüblichen Handkuss über dessen schlanke Finger beugte, sagte es mit einer überraschend rauchigen und erwachsenen Stimme: »Ich bin mir also durch die Ehre Ihres Handkusses sicher, lieber Herr weltberühmter Professor, dass Sie heute noch nicht vom Urin der Toten genippt haben. Übrigens – tun Sie’s oder tun Sie’s nicht?«
Die Röte, die Meckel da überflogen hatte, war vielleicht eher ein Glänzen aus einer bei ihm so nicht gekannten Fröhlichkeit und einem sehr tiefen, wohlwollenden Erkanntsein. »Mein Vater nippte, Demoiselle«, sagte er. »Und daran starb er wohl auch. Ich aber sehe hier einen ausschlaggebenden Grund vor mir, mein Leben zu schonen. Mögen Sie, mit der Erlaubnis Ihres verehrten Herrn Vaters, vielleicht einmal meine Wesen aus der Ewigkeit sehen?«
Die Demoiselle erstrahlte und hielt sich sogleich, wie wir es noch so oft sehen sollten, die Hand vor den Mund, als wenn ihr bewusst sei, dass solch ein strahlendes Lächeln kein Mann überstehen würde. Meckel, nach einem zustimmenden Nicken des Obersten von Kleist, reichte ihr seinen Arm.
»Sie haben doch nicht etwa auch Engel eingeweckt – oder darf man bei Ihnen schöne neue Sorten von Flaschenteufeln bewundern?«
»Nun ja, Demoiselle«, hörte man Meckel noch im Abgang mit der schönsten Beute, die er je gemacht, am Arm, »ich will es mir ja nicht mit Himmel und Hölle gleichzeitig verderben und werde Sie vielleicht enttäuschen – allerdings sind meine Wesen wirklich ewig, denn da sie nie gelebt haben, können sie auch nicht gestorben sein.«
»Aber Sie«, hörten wir Friederike damals noch, »Sie erscheinen mir als ganz schön lebendig – obwohl sie Leichenprofessor sind!«
Friederike, deine Tante, mein lieber Heinrich, zählte damals erst siebzehn Lenze, während ich, dein damals ebenfalls von ihr betörter Vater, auch nur einen Monat älter als sie gewesen bin. Ihre merkwürdige Krankheit übrigens, von der ihr Vater sprach, war eine große Liebe zu einem griechischen Studenten gewesen, die der Oberst aus vielerlei Gründen nicht gestatten wollte, die aber vor allem aus einem anderen Grunde zu Ende gegangen ist. Diesen Studenten habe ich in flagranti, wenn auch aus Versehen, in einer peinlichen Situation mit einem anderen Studenten ertappt. Immerhin fand ich es sehr empörend, dass da ein Mann einen anderen küsste – war dem etwa ein wenig Neid beigemischt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch an der Schwelle des Todes nicht.
Es ist noch etwas zu dem Griechen zu sagen. Er hieß Apostopoulos Arsaky, ist ein weltweit geachteter Biologe vor allem auf dem Gebiet der Fische geworden und Meckels bester Schüler, er hat ihn einmal sogar auf einer längeren Forschungsreise begleitet.
Friederike und der immer noch sehr glänzende Fritz kehrten nach fast schon skandalös langer Zeit aus den Tiefen des Riesenhauses zurück. Ich weiß noch, was sie gerade zu Meckel sagte: »Angst vor Toten habe ich also gar nicht, nur mein feines Näschen mag ihren Geruch nicht besonders.« Und Meckel daraufhin: »Das Näsgen sieht auch hübsch aus mit Wattebäuschlein darin. Außerdem helfen drei Theile Kochsalz, anderthalb Theile Braunstein und darüber gegossen zwei Theile concentrierter Schwefelsäure.«
Ich, mein Sohn, war der Erste, der gewusst hat, was kommen wird. Ich war so eifersüchtig wie nie zuvor und nie wieder. Ich hätte meinen Bruder am liebsten in der von ihm zuletzt genannten Substanz aufgelöst!
Ich fühlte mich Fritz gegenüber nur all zu oft wie angesichts unseres Präparats des ungeheuren Schattenzwillings an der Uteruswand.
Was ist da zu sehen?
Ein scheinbares Zwillingskind, das seinen Widerpart an der Uteruswand erdrückt hat. Es scheint, als habe hier der Normalfall das abweichende Andere regelgerecht plattgemacht – platt wie ein Stück Papier. Dabei ist diese ungeheure Kraftanstrengung von genau diesem selber ausgegangen.
Der papierflache Zwilling mit seinem Schmiereffekt sämtlicher wichtiger Organe an der bereits prallvoll besetzten Uteruswand ist vielleicht nicht ein Zeugnis von der allgemeinen Freundlichkeit des Lebens – aber vor allen Dingen ist er ein Gegenbeweis davon, dass das Leben nichtig sei.
Und dieses Mal? Mitte des Octobers von 1806? Ich hatte gedacht, dass auch einer wie Meckel sich hochgeehrt fühlen und dabei ganz normal erröten müsste, wenn ein Kaiser, und kein österreichischer oder russischer, sondern der Cäsar einer ganzen Epoque derart bei ihm sich ankündigte. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es für Meckel längst nicht entschieden war, wer denn in diesem Falle der eigentliche Cäsar wäre – Gast oder Gastgeber.
Irgendwann zwischen 1804 und 1806, als er in Paris im Jardin des Plantes bei Georges Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire und Lamarck weilte, um sich diesen Größten ihres Faches als gleichrangig zu erweisen, muss dein Onkel Fritz eine Begegnung mit dem dort ein und aus gehenden Wissenschaftsfreund Napoleon gehabt haben. Bis weit nach dem Kriegs-October von 1806 hatte er mir davon nichts gesagt, später deutete er es allenfalls nur an. Irgendetwas war jedenfalls geschehen, sei es in der Wirklichkeit oder in Meckels wirklichkeitsträchtigem und -mächtigem Hirn, das ihn bestimmt hat, selber in einem hierarchischen System der Menschheit der berechtigte Mann dafür zu sein, auf einem Pergament zu schreiben, das von einer erhabenen goldenen Biene geziert wird, jedenfalls mehr als der gewalttätige Ägyptenforscher Bonaparte.
Du wirst gleich erfahren, mein Sohn, wie messerscharf dein Onkel noch am Tag nach der Entgegennahme des kaiserlichen Schreibens darauf reagiert hat, allerdings ganz heimlich. Ich glaube, meinen Bruder halbwegs zu kennen, bei all seinen Geheimnissen. Seine Selbstüberhebung ist einfach nur grandios – und irgendwie berechtigt. Das fängt bei unserem Adelstitel an, den wir alle, außer deinem Onkel, recht gern gebrauchen. Sowie jemand in der Anrede Meckel gegenüber auch nur zu einem »von Hemsbach« ansetzt, wird er verbal scharf geschnitten mit seinem »Ich bin nur Meckel!« Stolzer könnte sich der Kaiser von China nicht darbieten. Doch ist dies auch als ein Gemeinmachen, als Leutseligkeit gedeutet worden. Genau dann erlebt man aber Meckel meist in seiner eisigen Höhe und Abgewandtheit von jeglicher zwischenmenschlicher Stallwärme. Andererseits gibt es wohl niemanden auf dieser Welt, der wie Meckel aus heiterstem Himmel in platonische Dialoge geraten kann, die kein Außenstehender begreift. Es kann ein alter, kranker, nicht eben intelligibler Landstreicher sein wie der, der den vierfüßigen Hahn Dante im Riesenhaus abgegeben hat, der genau in Meckel denjenigen findet, dem etwas anzuvertrauen oder mit dem etwas durchzusprechen ist, das den Anschein hat, zu den wesentlichen Geheimnissen des Lebens zu rechnen. Meckel muss auf eine solche Weise auch dem grandios weltweiten Landstreicher Bonaparte in Paris begegnet sein. Wenn aber dem so gewesen sein könnte, wie hätte der Korse Meckel zu einer Schachfigur auf seinem Machtbrett auch nur denken können, ohne dass dieser nicht schon an einen ganz realen Gegenzug gedacht hätte?
Wer weiß, vielleicht gehörten ja schon die beiden Meckel’schen Steinadler von 1806 dazu. Dein Onkel hatte sie für viel Geld – allein ihre Transportation kostete ein halbes Vermögen – aus dem Berner Oberland kommen lassen. Dort war der Laborbiologe und bei Gelegenheit leidenschaftliche Feldbiologe Meckel im Winter selbigen Jahres auch dem Geheimnis des Winterschlafes der Alpenmurmeltiere um einiges nähergekommen. Zwei Kutschen jedenfalls fuhren im Spätsommer-Frühherbst 1806 in das Riesenhaus ein. In einer kreischte es markerschütternd, in der anderen randalierte der Teufel. Die beiden Kutschen blieben noch drei Tage kreischend und randalierend stehen in unserem düsteren Hof. Dann waren die Käfige links und rechts des Riesenhauses am Fuße der Meckel’schen Riesen fertig.
Читать дальше