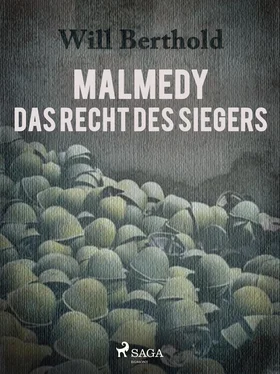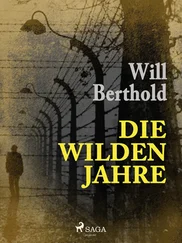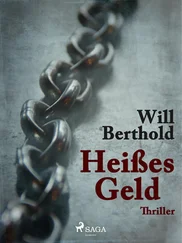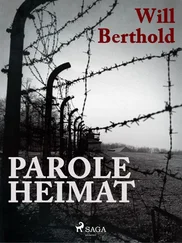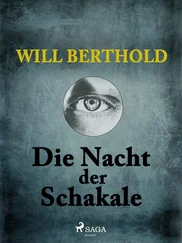1 ...6 7 8 10 11 12 ...32 Klausen kletterte aus seinem Panzer, betrachtete die beiden brennenden Jeeps.
„Sie Esel“, sagte er dann zu dem Fähnrich des Panzerspähwagens.
„Jawohl, Obersturmführer“, erwiderte der Mann stramm.
„Können Sie nicht vorsichtiger schießen? Da verbrennen mindestens achtzig Liter Benzin.“
Der Fähnrich machte ein dumm-stolzes Gesicht. Klausen kletterte ächzend in seinen Panzer zurück. Das olivgrüne Häuflein der angebratenen Amis übersah er. Dann fielen sie ihm wieder ein. Er stieg aus seinem Turmluk und wies mit dem Daumen über die Schulter nach hinten.
Die GIs hielten die Hände auf dem Kopf und trotteten zurück. Dort kam die eigentliche Vorhut, das Gros. Sollten die sehen, was sie mit den Amis machten. Erst, wenn er den feindlichen Widerstand nicht mehr brechen konnte, durfte er stehenbleiben … oder mußte es, weil er kein Benzin mehr hatte.
Der Richtschütze Wieblich sah die charakteristischen Bewegungen seines Kompaniechefs.
„Könn wa nich machen, Obersturmführer.“ Seine Ohrläppchen waren rot vor Ärger und Enttäuschung.
„Schnauze, Wieblich“, erwiderte Klausen trocken.
„Ick will Ihnen ja nur Ärjer ersparen, Obersturmführer“, antwortete Wieblich.
„Schnauze, Wieblich!“
Der Richtschütze stammte noch aus den besseren Tagen der SS. Er hatte mitgeholfen, seiner Einheit den Namen „Lötlampen-Division“ zu verschaffen. Des Führers Garde hatte sich in Rußland die Zeit damit vertrieben, mit Lötlampen Dörfer in Brand zu setzen und die Zivilbevölkerung auszuräuchern.
„Det war praktisch.“ Wieblich schwärmte noch oft davon. Die Wieblichs waren in der Minderheit. Aber die Minderheit war groß genug, um den Ruf eines ganzen Volkes zu vernichten.
Die Panzereinheit erreichte ein Dorf, passierte einen Weiher. Die Sicherungsposten fielen im Maschinengewehrfeuer, bevor sich noch begriffen, daß der Feind anrückte.
„Genau ins offne Maul“, stellte Wieblich zufrieden fest.
Sie waren bester Laune. Es klappte alles so nach Maß, daß sie eine der hinteren Panzerbesatzungen auf der verlassenen Dorfstraße zum Hühnerfang kommandierten.
Am Ortsende vor der Scheune tauchten wieder drei Amis auf.
Feuerstoß! Daneben.
Zwei der drei liefen querfeldein. Feuerstoß!
„Den hat’s erwischt!“ sagte der Richtschütze.
Der zweite entkam. Der dritte stand noch wie angewurzelt, verschwand in einem Graben. Wieblich merkte sich genau die Stelle. Saalbeck fuhr auf sie zu.
In diesem Moment erhob sich Werner Eckstadt, in Unterhosen, und hielt die Arme in die Höhe.
Wieblich schwenkte den Turm, zielte. Er ließ sich Zeit beim Maßnehmen;
„Laß ihn“, sagte der Panzerkommandant per Sprechfunk zu seinem Richtschützen. „Der hat durchgedreht. Der kommt ja auf Socken.“
Wieblich knurrte unwillig.
Aber dieses Knurren rettete Werner Eckstadt zunächst das Leben …
So oft hat Werner Eckstadt seiner Schwester Vera in einem kurzen Drei-Tage-Urlaub von den Ereignissen in der Nähe von Stavelot, südlich Malmedy, erzählt, daß sie jede Einzelheit kennt, daß sie schon nicht mehr nach Worten zu suchen braucht, wenn sie sie wiedergibt. Sie trägt ein rotes Kleid mit freien Schultern. Eine schwere, goldene Kette, ein Geschenk ihrer verstorbenen Mutter, glitzert an ihrem Hals. Der CIC-Leutnant Tebster hat sie in einen Soldaten-Club mitgenommen. Eine Flasche Vat 69 steht am Tisch. Der schlaksige Leutnant gießt beständig ein.
Die Musik spielt vorzüglich. Eine deutsche Tanzkapelle, die sich rasch auf Hot umgestellt hat. Das Licht ist angenehm gedämpft. Nicht so gedämpft sind die Stimmen einiger Damen, die auf ihre amerikanischen Begleiter einsprechen … Damen wenigstens, wenn man sehr höflich ist.
„Gut, daß Sie nicht so sind wie die da“, sagt Tebster.
„Schlimme Erfahrungen?“
„Es geht.“
„Was machen Sie bei der CIC?“
„Ich entnazifiziere.“
„Macht Ihnen das Spaß?“
„Ein Scheißgeschäft“, erwidert der Leutnant. „Ich bin nur da, weil meine Mutter Deutsche war, und ich deutsch spreche.“
Vera nickt. Das Licht spiegelt sich auf ihren blanken, weißen Schultern. Sie sieht bezaubernd aus, so, daß die Männer sie wohlgefällig und die Frauen sie mißgünstig betrachten.
„Wollen wir tanzen?“ fragt Tebster.
„Einen Moment, Leutnant. Eine Frage noch: Ihre Mutter war Deutsche?“
„Ja.“
„Meine war Engländerin“, erwidert sie.
„Deswegen können wir doch tanzen.“
„Noch einen Augenblick, Leutnant. Sie kennen die Geschichte mit meinem Bruder?“
„Ja, aber was soll das?“
„Ich will Sie erpressen“, entgegnet Vera. „Wenn Sie ihm helfen, tanzen wir. Wenn Sie ihm nicht helfen, gehe ich sofort nach Hause.“
„Sie sind ein Biest.“
Vera nickt. Plötzlich weint sie. Tebster starrt sie betroffen an. Langsam begreift er, was los ist. Langsam sieht er ein, warum sie sich so nett hergerichtet hat, warum sie mit ihm ausging. Er begreift die endlose Qual, die hinter dieser lächelnden Fassade stecken muß, die Verzweiflung, den Mut, das Opfer, lächelnd zu tanzen, während der Bruder mit einem Fuß bereits im Grabe steht.
Der schlaksige Leutnant steht auf. Den Kaugummi hat er längst weggelegt. Die Gleichgültigkeit auch. Etwas macht ihn weich, rührt ihn fast, den wetterfesten Burschen, der bei Brest mitten in eine Flakstellung gesprungen ist, sie eroberte und mit vier Kameraden drei Tage lang verteidigte, als einziger Überlebender zuletzt.
„Der Teufel soll mich holen“, sagte er, „ich bring Ihren Bruder ’raus.“
Er hilft ihr in den Mantel.
„Verlassen Sie sich darauf.“
Vera nickt.
„Ich wollte nicht weinen … Sie sind jetzt schon der zweite, der mir helfen will.“
„Doppelt genäht hält besser“, erwidert Tebster leichthin.
Und wenn ich zehn brauchte, denkt Vera, ich muß Werner retten.
Er ist unschuldig.
Er darf nicht sterben.
Ich allein bin sein einziger, winziger, letzter Ausweg.
Wenn ich es bin …
In der ersten Minute begreift der schlaksige Leutnant Henry F. Morris gar nichts. Er starrt auf die am Boden herumliegenden Schriftstücke, die aufgebrochenen Schränke, die umgestülpten Schubladen, die herausgerissenen Schreibtischfächer … die wahllos verstreuten Innereien seines Office. Der Assistent des Colonel Evans holt mechanisch eine Zigarette aus seinem Etui, setzt sich und überlegt.
Gestern abend war er mit Vera verabredet. Aber das blonde, hübsche Mädchen versetzte ihn. Er begriff es widerwillig, ging in seine Stammkneipe und ließ sich mit Whisky vollaufen. Sein Wagen sprang nicht an, und er mußte zu Fuß nach Hause gehen. Er verschlief den Wecker und stand mit zwei Stunden Verspätung auf. Er erhob sich auf Raten, er betrachtete durch das Fenster den verschlafenen Morgen. Der Tag war müde und grau wie das Gesicht einer alternden Frau. Und der schlanke, gutgeratene Leutnant aus Texas hatte Kopfschmerzen.
Und jetzt, in seinem Büro, erlebt Henry F. Morris erst die schlimmste Überraschung …
Allmählich begreift er, was vorgefallen ist. Einbrecher! Er bückt sich, sammelt die Schriftstücke, ordnet sie. Er schüttelt seine Benommenheit ab, vergißt die Kopfschmerzen und erfaßt blitzschnell, auf was es die nächtlichen Besucher abgesehen hatten.
Akten sind verschwunden.
Genauer gesagt: Dossiers über den Fall Malmedy.
Ganz genau gesagt: die Unterlagen über den deutschen Gefreiten Werner Eckstadt.
Vera, denkt der Leutnant. Das steckt also dahinter. Zuerst verabredet sie sich mit ihm, um sicherzugehen, daß er sich nicht im Büro aufhielt. Während er auf sie wartete, drang sie oder gedungene Leute in das Office ein. In ihrer Verzweiflung ist ihr alles zuzutrauen! Und sie hat keine Geduld, obwohl sie weiß, daß sich Colonel Evans des Falles angenommen hat … angenommen hatte wenigstens, denn wenn der Oberst erfährt, was hier vorgefallen ist, wird er keine Lust mehr haben, die Sache weiter zu verfolgen.
Читать дальше