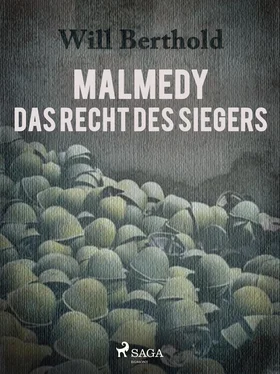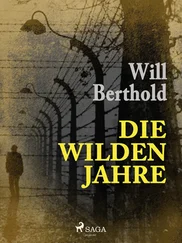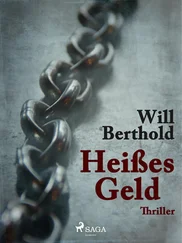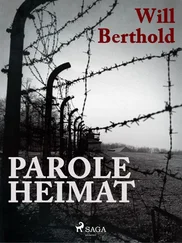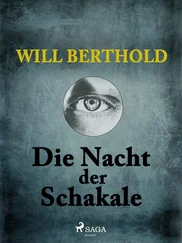Vera brachte Heinz an den Zug. Sie war nicht die einzige Begleiterin eines Soldaten, aber sicher die glücklichste und die traurigste. Es gibt nichts Häßlicheres, nichts Gemeineres, nichts Trostloseres während eines Krieges als die Bahnhöfe, als das Nebeneinander von Abschied und Begrüßung. Hier steht eine überglückliche Mutter und umarmt ihren einzigen Sohn, und daneben sieht eine Frau ihrem Mann nach, dessen Kopf am Fenster immer kleiner wird, ein dunkler Punkt zuletzt. Und den sie nie mehr sehen wird, nie mehr, nie mehr …
„Komm bald wieder“, sagt Vera.
„Gewiß“, erwiderte er, „der Krieg ist ja bald aus.“ Ein Kloß würgte in seinem Hals.
„Wie lange dauert er noch?“ fragte sie.
„Nicht mehr lange.“
Der Stationsvorsteher pfiff gedankenlos. Beide zuckten zusammen. Und die Lokomotive heulte zurück. Es klang wie das Wimmern eines Hundes, dem man versehentlich auf den Schwanz tritt.
Dann zerriß die Panzermine den Leutnant.
Der „Panther“ legte sich auf die Seite und begrub vier Mann, darunter Heinz, den Kommandanten.
„Für Führer, Volk und Vaterland“, stand auf dem Waschzettel, den der Kreisleiter Vera in das Haus brachte, zusammen mit patriotischen Phrasen, unsteten Blicken und ungeduldigem Füßescharren.
Vera hält das Bild von Heinz in der Hand. Er sieht sie mit seinen offenen Augen an, mit Augen, die jetzt gebrochen sind, die nie mehr den Glanz und das Elend dieser Welt sehen können …
Was von der Liebe übrigblieb, vegetierte unter einer Fotografie in einer Wandvase, deren Blumen regelmäßig gewechselt werden.
Vera steht auf, wischt sich mit der Hand über die Stirn, als ob sie dadurch die Erinnerung bannen könnte. Sie denkt verbissen: es ist gut, daß ich Sorgen habe. Es ist gut, daß ich um Werners Leben kämpfen muß. Wenigstens denke ich dann nicht an Heinz. Vielleicht kann man doch einmal vergessen.
Vielleicht …
Ach so, ich muß ja noch Tebster und Morris meine neue Adresse geben.
Die Stimme des Leutnants Tebster klingt frisch und ausgeschlafen.
„Hello!“ ruft er krähend in die Muschel. „How do you do?“
Vera gibt dem CIC-Offizier ihre neue Anschrift. Sie ist jetzt Untermieterin in einer angeschlagenen Wohnung in der Innenstadt.
„Ich bin arbeitslos“, fügt Vera hinzu.
„Macht nichts“, erwidert Tebster. „… Ich beschaffe Ihnen einen neuen Job.“
Damals rollte die Ardennenoffensive weiter. Die Panzer rasselten mit ihren Ketten auf dem steinhart gefrorenen Boden der Straße, ihre Umrisse wuchsen ins Riesenhafte. Die Sondermeldungen jagten sich im Rundfunk. Oft zwei und drei am Tage. Müde, abgehetzte Menschen blieben stehen und horchten ungläubig auf die triumphierende Stimme aus dem Äther. Immer wieder hatte Goebbels vom Tage der Vergeltung gesprochen und von Wunderwaffen gefaselt. War die Stunde gekommen? Sollten die Alliierten aus Belgien, aus Frankreich hinausgejagt werden? Zeichnete sich ein zweites Dünkirchen ab? Die Fortschritte Rundstedts schienen in diesen ersten Tagen so überraschend, so unglaublich, so riesig, daß viele wieder daran zu glauben begannen.
Aber kaum waren die Fanfaren der letzten Sondermeldungen ausgeklungen, da kam die Wende … und die Offensive brach zusammen. Jetzt hatten die Kämpfe ihren Höhepunkt erreicht. Der Tod kassierte seine fetten Zinsen auf beiden Seiten. Die Panzer der deutschen Vorhut waren durchgebrochen. Das Gros Rundstedts schloß dicht zur Hauptkampflinie auf. Häuser, Sträucher, Bäume, Gräben, Hügel und Bäche wurden zur Front … und diese blutende, blitzende, donnernde, brennende Front verwandelte sich für Tausende junger Männer in zweierlei Uniformen zu Gräbern.
Und inmitten dieser Hölle stand Werner Eckstadt, schrie, bangte, zitterte und lief um sein Leben.
„Nicht schießen! Ich bin Deutscher. Nicht schießen! Wartet!“ Seine Stimme war heiser, seine Lungen schmerzten.
Der vordere Panzer stoppte. Werner Eckstadt gefror das Blut in den Adern. Panzer schießen nur, wenn sie halten! Er stolperte schreiend vorwärts, den Panzern entgegen, die Augen vom Entsetzen geweitet, den Mund voll Dreck und Schnee …
Das Turmluk des vorderen Tigers öffnete sich. Von dem auftauchenden Kopf sah Werner Eckstadt nur die FT-Haube. Ein Arm fuchtelte herum und winkte ihn heran.
Werner Eckstadt taumelte auf den Panzer zu.
„Ich bin Deutscher“, rief er noch einmal.
Klausen sah ihm entgegen. Er lachte kalt.
„Mann, Mann“, sagte er gemütlich von seinem Panzerturm herab, „Deutscher bist du? Das fällt euch auch bloß ein, wenn ihr Bauchweh habt. Bist wohl Deutsch-Ami, was?“
„Nein, Obersturmführer“, entgegnete Werner, der jetzt die Rangabzeichen erkannt hatte, „ich bin deutscher Soldat … SS-Rottenführer Eckstadt meldet sich versprengt.“
„Na?“ Klausen turnte langsam von seinem Turm herunter. In seiner Hand hielt er die entsicherte 08-Pistole.
Wieblich, der Richtkanonier, stieg hinter ihm aus.
„Na“, wiederholte Klausen, „jetzt denk dir mal eine gute Geschichte aus. Aber fix, mein Junge!“
Werner Eckstadt schüttelte den Kopf.
„Keine Geschichte, Obersturmführer. Ich gehöre zum ,Sonderkommando Sennelager‘. Wir sind heute nacht mit dem Fallschirm hinter der HKL abgesetzt worden. In amerikanischer Uniform. Geheimeinsatz. Sollten Verwirrung stiften …“
Obersturmführer Klausen pfiff leise durch die Zähne. Er sah Eckstadt scharf an. Irgendwo hatte er gehört, daß es so etwas gab.
„Und wie wollen Sie das beweisen?“ fragte er.
Bevor Werner noch etwas erwidern konnte, packte ihn Wieblich am Arm, streifte den Ärmel seines Unterhemdes hoch und hob den Arm in die Höhe. Der Richtschütze dachte praktisch wie immer. Wenn der Mann nicht log, mußte er den Blutgruppenstempel der SS, das Brandmal für Hitlers Leibeigene, haben.
„Det Ding hat er“, sagte Wieblich verdrießlich. Für ihn bestand der Krieg aus einfachen, klaren Dingen: Angreifen und Menschen totschlagen. Mit den Problemen dieser Offensive kam er nicht mehr mit. „Der hat sich sicher gleich dünne jemacht!“ ergänzte der Richtschütze seine Betrachtungen.
„Und wie kommen Sie denn in die Unterhosen?“ fragte der Obersturmführer.
„Hat ne Schnucke jefunden“, knurrte Wieblich.
„Und wo sind denn Ihre Kameraden?“ meinte der Obersturmführer lauernd.
Werner Eckstadt riß sich gewaltsam zusammen. Wie hatte er damals geflucht, als man die Blutgruppe in seinen Arm ritzte. Diese elende, gedankenlose, allmächtige Bürokratie mußte ihn jetzt retten!
„Obersturmführer, sind Sie schon einmal nachts mit dem Fallschirm abgesprungen? Ich bin in einen Teich gefallen. Die ganze Uniform war versaut. Ich wäre doch mit dem klitschnassen Zeug keine drei Schritte weit gekommen! In diesem Zustand kann man nicht Ami spielen. Ich wollte meine Klamotten erst mal trocken kriegen. Ich fand eine Scheune …“
Werner sprach hastig. Er redete sich den Kloß der Angst heraus, der ihm in der Kehle saß.
„Nu’ sabber’ nich so ville!“ entgegnete Wieblich.
Der Obersturmführer lächelte.
„Na, ist schon gut. Melden muß ich Sie natürlich. Aber jetzt steigen Sie erst mal ein. Ihr kalter Arsch wird sich bei uns schnell aufwärmen.“
Als Werner Eckstadt in den Panzer kletterte, merkte er erst, wie seine Knie schlackerten.
Im Augenblick war er aus allem heraus. Aber er sollte den Tiger noch verfluchen …
Die anderen, die mit Werner Eckstadt abgesprungen waren, hatte der Wind abgetrieben. Nur Obersturmführer Friedberg und Unterscharführer Roettger blieben zusammen. Sie landeten an einem Waldrand. Den Obersturmführer erwischte beim Aufkommen noch eine der letzten Tannen und schürfte ihm die Haut im Gesicht auf.
Sie vergruben ihre Fallschirme, schwiegen und lauschten in die Nacht. Sie warteten auf Haubach, auf Seyfried und auf Eckstadt. Nach einer halben Stunde sagte der Obersturmführer:
Читать дальше