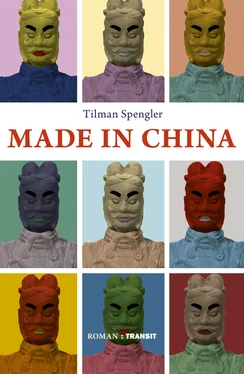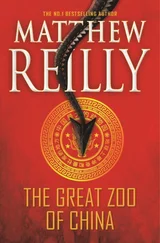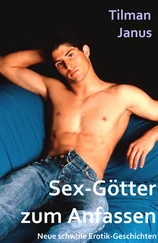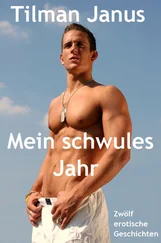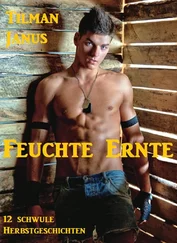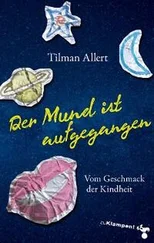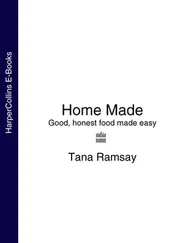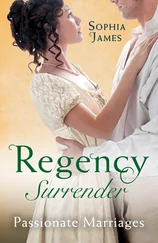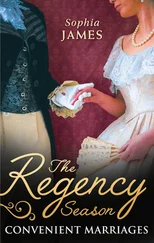Das russische Wort »Täubchen« hatte ihn so heftig getroffen wie ein plötzlicher Zahnschmerz. Zwirn ist bei seiner Muttersprache sehr empfindlich, er mag als Mann nicht »Täubchen« genannt werden, das verletzt seinen Stolz. »Täubchen« nannte ihn zum letzten Mal eine längst verstorbene Großtante, die für Kinder noch Gewänder aus der »guten Zeit« aufbewahrte. Diese Kleider sahen alle aus wie Mädchenkleider, waren es vielleicht sogar, und Zwirn erinnert sich mit Schrecken an eine braunstichige Photographie, die ihn mit langen, bis auf die Schultern herabfallenden Locken zeigt.
»Nein«, antwortet Zwirn grummelig, ohne auf den Grund seiner plötzlichen Verstimmung einzugehen, »ich kann mich beim besten Willen nur an Einzelheiten erinnern, deren Fehlen, also deren Abwesenheit mir aufgefallen ist. Also die fehlende Uniform des jungen Mannes, die ich schon erwähnte. Was mir im Nachhinein auch noch merkwürdig vorkommt, ist, dass er nicht nach Knoblauch gerochen hat. Jeder riecht in dieser Stadt nach Knoblauch, Junge wie Alte, Frauen wie Männer, aber dieser Verkäufer roch eben ausdrücklich nicht nach Knoblauch. Das fällt mir aber erst jetzt ein. Und dann noch ein Drittes: Der kleine Kerl war oder ist bei all seiner Unscheinbarkeit von einer umwerfenden Höflichkeit. Vorbildliches Benehmen, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Höflichkeit?«, fragt die Kollegin, die mit einem energischen Griff der rechten Hand einen Stift und ein quadratisches Notizheft aus der linken Brusttasche ihrer Bluse gezogen hat. »Was genau soll das heißen? Kleinbürgerliche Manieren? Ein Duckmäuser?« Ihre hellrote Zunge gleitet zweimal flink über die Spitze des Schreibgerätes. Ihre Knie hält sie unter dem Rock eng gegeneinandergepresst. Zwirn ist kurz irritiert, einmal, weil das Hervorziehen des Notizheftes gleich zwei Knöpfe der Bluse geöffnet hat, zum anderen, weil der Einband des Heftes einen Schwarm von Goldfischen zeigt, der ihn zu bitteren Rückschlüssen auf den Geschmack der Besitzerin zwingt. Am meisten verstört ihn jedoch, dass dieses Gespräch merklich eine andere Richtung zu nehmen scheint. Vertraulich, ja, fürsorglich hat es begonnen, jetzt durchweht ein wahrnehmbarer Hauch von Schwefel das Geschehen. Für eine Unterhaltung unter Kollegen verwenden die Beteiligten nur in besonderen Fällen schriftliche Notizen.
»Höflichkeit ist in sozialistischen Ämtern oder Kaufhäusern so außergewöhnlich abwesend, dass ihr Erscheinen auffällt wie sonst nur ein Ladendiebstahl«, fährt Zwirn fort, der beschlossen hat, das kleine Heft der Kollegin einfach nicht zu beachten. »Gut, es kommt natürlich auch zu Ladendiebstählen, die nicht bemerkt werden, wie das ja auch bei einem Anfall von Höflichkeit passieren kann, aber das ist selten. Ich will damit auch nur sagen: Man müsste einmal an einer Theorie der auffälligen Abwesenheit arbeiten. Gerade in der Kunstgeschichte ist man doch mehr damit beschäftigt, das schreiend Vorhandene zu erfassen als das schreiend Fehlende.«
»Interessant«, sagt die Kollegin, ohne aufzublicken, züngelt noch einmal kurz über die Spitze ihres Stiftes und schreibt dann schnell weiter. Eine chinesische Zigarettenlänge später klappt sie das Büchlein zusammen, lässt es zurück in die Tasche der Bluse gleiten und schließt gelassen auch wieder deren zwei Knöpfe.
»Man müsste also, behauptest du, zur vollständigen Erfassung einer Person, eines Vorfalls oder eines Objektes eine spezielle Liste von auffälligen und unauffälligen Abwesenheiten anlegen«, fasst sie jetzt ihre Gedanken und das für eine höhere Instanz später zu verschriftlichende Ergebnis ihrer Unterhaltung zusammen, »für mich ist das wirklich interessant.«
Zwirn hat seit langem eine fast körperliche Abwehr entwickelt, sobald das in jeder Sprache dieser Welt dümmliche Wort »interessant« fällt. Das gilt auch jetzt, wo es aus dem Munde einer weiblichen Person kommt, die gerade mit einem Stift und der Knopfleiste ihrer Bluse gespielt hat. Andererseits ist Zwirns Geschlechtsleben seit dem unglücklichen Ausgang seiner Affäre mit Ritotschka in Peking auf Träume und wild neu zusammengefügte Wunschbilder angewiesen.
Daher lässt er sich nicht einmal von dem Wort »interessant« davon abhalten, sich mit der Kollegin zum Abendessen zu verabreden. Der Abend beginnt, wie es sich gehört, in der Abteilung der Kantine, die für privilegierte Gäste reserviert ist. Heute Abend sind sie dort allein, sieht man einmal von der Bedienung ab, die sie nur unauffällig beobachtet.
Am nächsten Morgen taucht das Wort »interessant« gleich mehrfach wieder auf, diesmal im Bericht der Kollegin aus dem Bereich der Ming-Forschung, die übrigens in russischer Umschrift mit Vornamen Lili heißt.
Es könnte »interessant« sein, schreibt Lili in einem ersten Bericht an die zuständige Stelle ihrer Organisation, sogar »sehr interessant«, dem Hinweis des »ausländischen Gastes« nachzugehen, dass auch eine Systematik des »Nicht-Vorkommens« von erheblicher Bedeutung für das Erkennen einer allgemeinen oder einer besonderen Gefährdungslage wäre. So könne sie jetzt ein annähernd exaktes Bild, praktisch ein Negativ und ein Positiv, des Kollegen aus der Sowjetunion anfertigen. Eben nicht nur, um ein paar Beispiele zu nennen, über die Gerichte bei Tisch, die er bevorzugte, sondern genauso über solche, bei deren Aufnahme er ausgesprochenen Ekel gezeigt habe, wie etwa der sehr speziell zubereiteten sauren Kamelhufsuppe. Oder bei der Auswahl der Getränke, da sei die süße Limonade stets unberührt geblieben. Interessant sei auch der Wortgebrauch des Ausländers, also die Ausdrücke, die er benutzt – oder eben auf keinen Fall verwendet. Mehr dazu finde sich in ihrem nächsten Bericht mit wörtlichen Übersetzungen aus der Fremdsprache.
»Am Morgen nach dem Abendessen haben wir gemeinsam Pingpong gespielt«, hält sie in einem weiteren Absatz fest. »Zwirn spielt nicht zur körperlichen Ertüchtigung, er spielt, um zu gewinnen. Beim Zählen der eigenen Punkte entwickelt er zu seinem Vorteil neue Zahlenfolgen, durch die sich der Stand des Gegners automatisch verringert.«
Zu seinen positiven Merkmalen, so steht es in ihrem Bericht, müsse die Fähigkeit des Fremden gezählt werden, auch mit unbekannten Herausforderungen fertig zu werden. Eine von unserer Partei abweichende politische Festlegung sei auch bei Themen nicht erkennbar, in denen es zwischen den Standpunkten der sowjetischen und der eigenen Führung zu Differenzen gekommen sei. »Der kluge Fisch bewegt sich mit dem Wasser«, habe er als die gültige und wahrhaftige Deutung der Lehren des Großen Vorsitzenden bezeichnet.
In Fragen der bildenden Kunst habe sich der Russe ausdrücklich zum sozialistischen Realismus bekannt, weil dieser von jeher das Ausdrucksmittel der Arbeiterklasse sei. Kunst bedeute ja seit ihrer Entstehung die Unterscheidung zwischen »wahr« und »falsch«.
Im letzten Absatz kommt Lili auch noch auf die Kleidungsstücke des Leo Zwirn zu sprechen, genauer: auf jene, die er sofort und solche, die er überhaupt nicht abstreift. Hier sind ihr die graugestreiften Socken der zu observierenden Person aufgefallen, doch nach kurzem Nachdenken schüttelt sie heftig den Kopf, sodass ihr langer, seidenschwarzer Zopf leicht ins Pendeln kommt. Sie greift zur Schere, schneidet die Passage aus dem Bericht und verbrennt den Papierstreifen sorgfältig mit der Glut ihrer Zigarette im Aschenbecher. Zwar dürfen auch winzige Details wie etwa graugestreifte Socken, das hat Lili in der Schulung gelernt, nicht unterschlagen werden. Dennoch: Als Berichterstatterin darf man sich als aufmerksam und verantwortlich, aber keineswegs als übereifrig zu erkennen geben. Das gilt auch für das Private.
Kommissar Wu, der Stählerne Wu, hat den Bericht von Lili dreimal sorgfältig gelesen und verpasst dem Dokument den obligaten Stempelabdruck, bevor er es dem Gesamtdossier über Zwirn hinzufügt. In einer Pappschachtel liegen bereits das Protokoll der Untersuchung von Zwirns Gepäck und seit gestern die schriftliche Analyse zu den toxikologischen Befunden über die Medikamente aus dem kleinen Lederkoffer.
Читать дальше