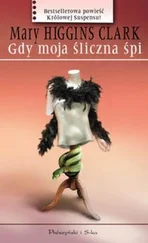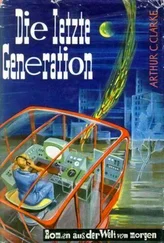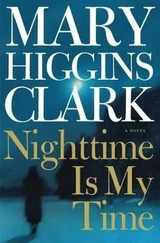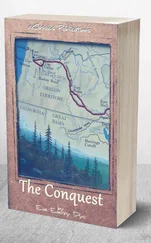Wenn ich erst das Funkgerät reparieren würde, hätte ich wenigstens Musik für die restlichen Aufgaben. Also montiere ich das kaputte Gerät ab und verkable das Ersatzteil vorsichtig neu – schön auf die Farben achten, dann Stoßverbinder und Schrumpffolie. Nachdem ich das Gerät zurück in die Wandhalterung geschraubt habe, stelle ich den Strom wieder an und drücke die Power-Taste.
Nichts. Nicht mal ein Flackern.
»Aaaaaargh!« Ich verdrehe die Augen, drücke immer wieder auf die Power-Taste – vielleicht springt das Ding wundersamerweise ja doch noch an. Irgendwann gebe ich auf, zücke stattdessen Kopfhörer und meinen iPod, und weiter gehts.
Das Positionslicht ist wohl die nächst einfachste Aufgabe. Ich klaube mein Werkzeug zusammen, schnappe mir die Leiter und laufe zum Bug, um die Leuchte auseinanderzunehmen. Ich säubere die Verkabelung, wechsle die Birne, will sie austesten. Sie brennt für einen Augenblick und geht wieder aus. Tief durchatmen. Ich bin leicht verzweifelt. Und zusehends wütend. Ich sehe nach, ob es irgendwo einen Kurzschluss gegeben hat, kann aber nichts Auffälliges finden. Kurzerhand räume ich ein Plätzchen frei und lasse mich zwischen Werkzeug, Ausrüstung und Vorräten nieder. Das ganze Zeug scheint mich höhnisch anzusehen und sagen zu wollen: »Jetzt aber los!«
Schweiß läuft mir übers Gesicht. Es ist dermaßen schwül, dass ich fast das Gefühl habe, ich müsste die Atemluft schlucken. Moskitos sirren mir um die Ohren. Ich fühle mich einfach nur elend. Alles ist komisch ohne Shannon. Ich weiß nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll.
Surfen! Beim Surfen ging es mir immer gleich besser! Ich schnappe mir mein türkisfarbenes Twin Fin und meine Surftasche, klettere die Leiter hinunter, überquere den Fluss und laufe zur Bushaltestelle ein Stück die Straße runter.
Die Wellen sind etwa brusthoch, hier und da höher, und rollen ein paar Kilometer südlich von hier über die Spitze einer Sandbank. Der Wind geht leicht auflandig, trotzdem ist das um Welten besser, als weiter an der Swell herumzuwerkeln.
Eine runzlige alte Tica mit einem breiten Lächeln im Gesicht, die an der Straße grüne Mangos verkauft, signalisiert mir, dass ich meine Tasche bei ihr lassen kann. Ich kaufe ihr eine Mango ab, und wir unterhalten uns eine Weile. Dann der in Costa Rica übliche Gruß »¡Pura vida!« , und ich sprinte über den heißen schwarzen Sand, paddle durch suppig braunes Wasser und bin ganz allein im Mündungsbereich. Ein paar kleinere Drops und Turns, und mein Stimmungstief ist überwunden – nur zwischen den Sets sitzt mir die To-do-Liste im Nacken und fühlt sich an wie ein schlimmer Kater.
Als ich ein paar Stündchen später an der Straße zurücklaufe, hoffe ich auf einen Bus oder ein Taxi, das mich zurückbringen kann. Ein paar Kerle pfeifen mir aus ihren Trucks hinterher, andere fahren einfach vorbei: Familien auf Sonntagsausflug. Ich laufe weiter in Richtung Werft, nehme das Board mal in die eine, mal in die andere Hand, um die Blutzirkulation in Gang zu halten. Vor mir an der Straße parkt ein einsamer Traktor. Ein schwarzer Tico Mitte vierzig sitzt auf dem Fahrersitz.
»Was läufst du denn hier lang?«, ruft er mir im unüberhörbar karibischem Zungenschlag und mit einem Augenzwinkern zu.
»Bin auf dem Heimweg«, sage ich. »Und was sitzt du hier in diesem Traktor?« Ich setze mich kurz in den Schatten des Gefährts.
»Ich passe darauf auf. Bis sechs Uhr. Ich bin Charlie, und du?«
»Liz.«
»Allein unterwegs?«
»Ja.«
»Verheiratet?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Keine Ahnung, vielleicht noch nicht den Richtigen getroffen.«
»Hör mal, Mädchen, du suchst dir besser schleunigst einen Ehemann, sonst wirst du noch alt, und keiner schaut dich mehr an«, sagt er, kichert und bleckt sein lückenhaftes Gebiss. »Willst du mich heiraten?«
»Nee, aber danke, Charlie.«
»Ach, liegt ja bloß daran, dass ich alt und hässlich bin.« Er wirft den Kopf in den Nacken und lacht lauthals. Ich muss ebenfalls lachen.
»Danke, Charlie«, sage ich und stehe auf. »Das hab ich jetzt gebraucht.«
»Mädchen, du musst lernen, immer weiterzulachen! Anders überlebt man doch nicht!«
Ich schüttle ihm zum Abschied die schwielige Hand und mache mich auf den Rückweg. Weiterlachen. Immer weiterlachen.
Ich wache mit Bauchschmerzen auf und wälze mich aus dem Bett, doch noch ehe ich es bis zur Reling schaffe, muss ich mich auf dem Achterdeck übergeben. Ich muss mir einen Bazillus eingefangen haben, als ich im verschmutzten Wasser surfen war. Ich greife zur Medikamententasche, bin aber zu kraftlos, um durch das Durcheinander aus Tütchen und vereinzelten Tabletten zu wühlen. Nachts in meiner Koje habe ich Schweißausbrüche und Schüttelfrost, und zwischen den Übelkeitsanfällen alle sieben Minuten schießt mir Charlies Rat durch den Kopf. Tags darauf schleppe ich mich zu einem Münztelefon in der Nähe des Hafenbüros und rufe zu Hause an.
»Hallo? Dad?« Mir versagt die Stimme.
»Hallo, Liebes! Was ist los?«
Beim Klang seiner Stimme bin ich sofort ein bisschen ruhiger. »Ich hab mir irgendwas eingefangen, und die ganzen Arbeiten …« Ich breche in Tränen aus. »Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll, Dad. Ich kann das alles nicht!«
»Na, dann komm ich doch vorbei«, erwidert er beschwingt. »Hier ist nächste Woche sowieso nicht viel los. Ich nehme den nächstbesten Flieger.«
Ein Lichtblick! »Echt jetzt?«
»Klar. Und Bonusmeilen habe ich auch noch genug. Das wird cool.«
Mit einem Mal ist der düstere Hinterhof wieder bunt. Tags darauf fühle ich mich auch schon besser, nehme den Bus zum nächsten Schrottplatz, um dort nach einer Kupferplatte zu suchen, die wir als Basis für die Erdungsplatte nehmen können. Anschließend fahre ich in die Stadt, um weitere Besorgungen zu machen. Neben dem Surfen gibt es nichts, was ich lieber tue, als mit Dad zusammenzuarbeiten – wenn er nicht gerade ein bisschen zu »gut geölt« ist.
Dad ist, was Bier angeht, ein bisschen überenthusiastisch. Allerdings redet er nicht gern darüber. Wann immer ich ihn darauf anspreche, wechselt er sofort das Thema. Seit er beruflich so viel unterwegs ist, will ihn bei den seltenen Gelegenheiten, da er zu Hause ist, auch niemand sonst darauf ansprechen. Er hat uns finanziell immer den Rücken freigehalten, auch wenn seine unternehmerischen Vorstöße auf dem Gebiet der Krebsdiagnostik nicht immer erfolgreich waren. Da brauchte er Alkohol, um zu entspannen, und der berühmte »Elefant im Raum« wurde in unserer Familie quasi zum Dauergast. An einigen Tagen waren es nur fünf, sechs Bier, an anderen ganze achtzehn. An solchen Abenden haben er und Mom sich oft gestritten, dann trank auch sie ein paar Bierchen, wahrscheinlich um mit seinem Suff klarzukommen. Für mich war all das aus der Distanz wesentlich leichter zu ertragen.
Trotz des langen Flugs und der zweistündigen Fahrt aus der Hauptstadt blitzen Dads Augen, als er drei Tage später in der Werft aus dem Taxi steigt. Ich falle ihm um den Hals und schlage vor, dass wir erst mal Sightseeing machen und an den Strand gehen, bevor wir mit den Arbeiten loslegen.
»Aber wir haben doch nur fünf Tage, Schätzchen. Was steht ganz oben auf deiner Liste?« Vorfreudig reibt er sich die Hände. Dad liebt es, mit den Händen zu arbeiten, und stürzt sich mit Begeisterung kopfüber in jedes Projekt. Ich selbst gehe gewisse Dinge lieber erst theoretisch an, insofern stimmt bei uns das Gleichgewicht aus Planung und Umsetzung.
Die folgenden fünf Tage verbringen wir von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bei der Arbeit. Er erzählt, wie er früher als Kind in Los Angeles mit seinem Grandpa Dawe zu Klempnereinsätzen und Umbauarbeiten in Wohnhäusern gefahren ist und sich so diverse handwerkliche Fertigkeiten angeeignet hat. Außer Handwerks-Allrounder und großartigem Vater ist er überdies Freigeist, Künstler, jemand, der Risiken eingeht und visionär denkt. Er ist unendlich großzügig, engagiert und, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, unaufhaltsam – ein echter Wilder, der sich fantastisch artikulieren kann, der spontan ist und aus dem Alltäglichen etwas Besonderes macht. Nur gibt er ungern nach, und wenn er frustriert ist, platzt ihm schon mal der Kragen, und er wird jähzornig und ausfällig. Leider habe ich diese Neigung von ihm geerbt.
Читать дальше