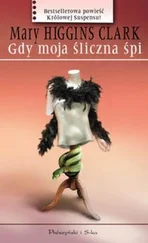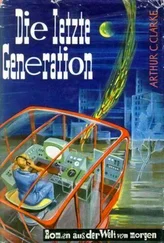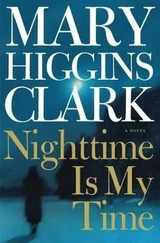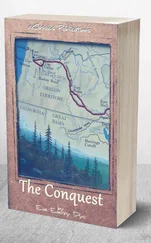Am Tag vor meiner Abreise schlafe ich im Haus meiner Eltern statt an Bord der Swell. Mir graut vor dem Sonnenaufgang. Das war’s jetzt – alle übrigen Arbeiten und Anschaffungen werden unterwegs gemacht. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Meine Crew steht bereit. Das Boot ist mit Proviant, Diesel und Wasser beladen. Eine kleine Delegation aus Freunden und Familie wirft die Leinen los, und ich steuere die Swell vorbei an denselben Docks, an denen ich einst auf einer winzigen Jolle segeln gelernt habe .
Über der Bergsilhouette im Osten taucht nach und nach ein orangefarbener Schimmer auf, während die Swell weiter nach Süden fährt. Mark steckt gegen halb sieben den Kopf aus der Kajüte, Shannon kurze Zeit später. Wir schwelgen in Erinnerungen an die achthundert Seemeilen, die wir mittlerweile zurückgelegt haben.
Als die Sonne am späten Morgen aufgeht, ist die Luft sogar erstmals halbwegs warm. Erleichtert schälen wir uns aus den stinkenden Jacken und Stiefeln und ziehen die Mützen ab, die wir seit achtzehn Tagen tragen. Sobald das steinerne Tor – das Wahrzeichen an der Südspitze der Baja-Halbinsel – in Sicht kommt, johlen wir und klatschen uns ab, holen die Segel ein und stoßen einander ins offene Meer für eine Ehrenrunde im Wasser.
Ich erzähle ihnen lieber nicht, wie erleichtert ich bin, dass wir es bis hierher geschafft haben, und wie sehr mir ihre Gesellschaft und Unterstützung auf dieser ersten anstrengenden Etappe geholfen haben. Ich bin mir sicher, dass sie es sowieso wissen.
Ich manövriere die Swell an dem Aufgebot aus Fischer- und Ausflugsbooten vorbei, die aus dem Hafen von Cabo San Lucas hinausströmen, und steuere die Bootstankstelle an. Mark und Shannon springen mit den Leinen an Land. Der diensthabende Señor sieht Mark an.
»¿Quieres diesel, amigo?« Er fragt, ob wir Diesel brauchen.
»Pregunta a la capitana« – »Fragen Sie die Kapitänin«, antwortet Mark und zeigt auf mich.
Der Mann sieht erst mich an, dann wieder Mark.
»¿Ella?« – »Die da?«, fragt er, um ganz sicherzugehen, und Mark nickt. »¿Capitana?« , spricht er daraufhin mich an.
»Sí, señor« , antworte ich – und zwar zum ersten Mal, ohne mit der Wimper zu zucken. »Diesel. Llena el depósito, por favor.« Einmal volltanken, bitte.
1.580 Seemeilen geschafft


DER TRAUM WIRD WAHR
Oh, Mexiko!
Shannon späht die Wellen aus. »Da!« Sie drückt mir das Fernglas in die Hand und zeigt in die entsprechende Richtung.
Die Wellen brechen entlang einer mit Palmen bewachsenen Landspitze vor staubig braunen Hügeln: Es ist der erste knackige Südschwell der Saison. Wir springen vor Freude in die Luft. Auf der Suche nach dem nächsten geschützten Ankerplatz, an dem das Boot bedenkenlos liegen bleiben kann, segeln wir ein Stück südwärts. Gegen Sonnenuntergang steuere ich eine kleine Bucht hinter einem Wellenbrecher an, während Shannon die Segel einholt. Es war eine lange, heiße Passage mit diversen Komplikationen.
Als die Sonne am folgenden Morgen aufgeht, schaufeln wir Porridge in uns hinein und stopfen dann eilig Sonnencreme und Wechselwäsche in unsere wasserdichten Taschen. Das Dingi lassen wir diesmal an Deck und paddeln auf unseren Boards an den Strand, an dem es von Schwimmern und Sonnenanbetern nur so wimmelt.
Keuchend arbeiten wir uns hoch bis zur Hauptstraße. Kaum dass wir dort ankommen, fährt ein Dorito-Wagen rechts ran. Ein Mann mittleren Alters mit Schnauzer steckt den Kopf durchs Fenster und erkundigt sich, wo wir hinwollen. »¿A dónde vas?«
»Al norte« , antworte ich – in Richtung Norden. Wir wollen zu der Stelle, die wir tags zuvor entdeckt haben.
»Vamos« , sagt er und stellt sich vor: »Me llamo Armando.«
Armando wirft unsere Boards zwischen kistenweise Dorito-Chips, und sofort weiß ich wieder, was ich an den Mexikanern so schätze: ihre Warmherzigkeit und Großzügigkeit. Ich bin froh, dass Mom damals während unserer Mexikoreise darauf bestanden hat, dass wir Kinder Spanisch lernten. Nach einem kurzen Tankstopp fährt unser fröhlicher Begleiter sogar einen Umweg und eine längere Schotterpiste entlang, um uns ans Ziel zu bringen. Noch während wir an einer kleinen Ansammlung aus Palapas und aufgeständerten Bungalows vorbeiholpern, zeigt er uns ein laminiertes Foto seiner Kinder. Er hält bloß einen Katzensprung von den tosenden, übermannshohen Lefthandern entfernt.
» ¡Gracias, Armando! «, rufen wir ihm nach, als er wendet. Vor einer nahe gelegenen Kneipe drehen sich Surfer nach uns um. Sie sind neugierig, wer da aus dem Truck gestiegen ist. Leicht nervös laufen wir auf sie zu.
Ein Landsmann von uns springt mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf. »Hallo, Mädels! Ich bin Pablo. Wo kommt ihr denn gerade her?«
»Wir haben ein Stück die Küste runter geankert«, erkläre ich. »Sind gestern hier vorbeigesegelt.«
»Oh, dann haben wir euch gesehen. Schönes Boot. ¡Bienvenidos! «, heißt er uns willkommen. Er grinst, ist zappelig wie ein kleines Kind. Mit den meisten anderen mürrischen Auslands-US-Amerikanern, die ich auf früheren Surftrips kennengelernt habe, hat er nichts gemein. Ich würde mich gern noch länger mit ihm unterhalten, aber es fällt mir schwer, mich auf ein Gespräch zu konzentrieren, während direkt vor meiner Nase die Wellen hereindonnern.
»Weißt du vielleicht, wo wir unsere Taschen sicher verstauen können, während wir surfen gehen?«, frage ich ihn.
Er weist uns den Weg zur Rückseite des Hauses eines Bekannten ganz in der Nähe und gibt uns noch ein paar Tipps mit auf den Weg: »Lauft bis zur Spitze der Landzunge. Dort mündet der Fluss ins Meer – da springt ihr rein. Sobald ihr draußen seid, sucht euch einen Orientierungspunkt an Land, weil die Strömung recht ordentlich ist. Die meisten treiben zu weit ins Tiefe, aber wenn ihr ein bisschen aufpasst, habt ihr die Sets ganz für euch allein. Dann mal viel Spaß!«
Ich klebe förmlich an seinen Lippen und bin froh, dass wir einen neuen Compadre gefunden haben.
Shannon und ich verbringen den kompletten Vormittag draußen im Wasser. Wir können nicht anders – da sind wir wie Mücken in einem Raum voller leicht bekleideter Gringos. Erst Stunden später trudeln wir mit schweren Gliedern und einem breiten Grinsen im Gesicht zurück ans Ufer. Pablo spendiert uns zwei geeiste Bananen-Mango- Licuados – eine Art Smoothie –, und wir legen uns im Schatten der Kneipen- Palapa in den Sand. Auf der Suche nach einsamen Surfspots kam Pablo 1979 mit dreiundzwanzig erstmals hierher. Während sein Reisepartner wieder heimkehrte, blieb er, verliebte sich in das wilde Mexiko und hat seither gelernt, »wie man Mexikaner wird«.
Ich habe das leckere Getränk noch nicht fertig getrunken, als die Wellen an der Innenseite der Sandbank meinen Blick erneut anziehen. Ich scharre schon wieder mit den Hufen und versuche, mir einzureden, dass ich erst noch ein bisschen Schatten und Erholung brauche, aber als die nächste menschenleere Welle über die Sandbank rollt, kann ich nicht anders, trage sofort frische Sonnencreme auf, schnappe mir mein Board und sprinte zurück zur Landzunge.
In mir toben die Freude und die Experimentierlust – ich liebe das Surfen, die Wärme, die Freiheit dieses neuen Lebens! Jede noch so kleine Verbesserung meiner Surftechnik ist ein Triumph. Shannon macht vom Strand aus Fotos. Ich trainiere meinen Backside Stand, Bottom Turns auf der brechenden Lip, Cutties und Drops mit der Hand am Board.
Читать дальше