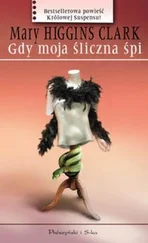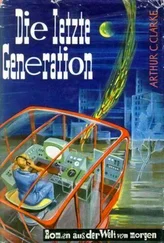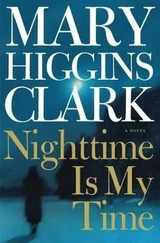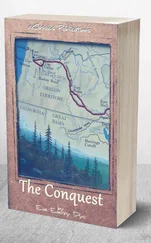Draußen auf dem Gehweg genießen wir die schmelzende Köstlichkeit. Ein paar Kinder spielen in der Nähe auf der Straße ein Ballspiel. Eine Pelota fliegt in unsere Richtung, und ein zuckersüßes, pummeliges Mädchen rennt ihrem Ball hinterher. Dann bleibt sie wie angewurzelt stehen, starrt Shannons Eistüte an und bedeutet ihr, dass sie mal probieren will. Shannon gibt nach und drückt ihr das Eis in die Hand.
Die kleine Gordita , das »Pummelchen«, wie wir sie nennen, hat das restliche Eis kaum verputzt, als ein breit grinsender Junge angerannt kommt und ein leicht schiefes Rad schlägt. Ich drücke ihm mein Eis in die Hand, stehe auf und schlage ebenfalls ein Rad. Dann wirft das Mädchen Shannon den Ball zu, und Shannon wirft ihn weiter zu mir. Im Handumdrehen schwirrt die ganze Straße nur so von umherfliegenden Pelotas , fuchtelnden braunen Armen, freundlichen Remplern, Zwischenspurts, Tanzschritten und ungebändigten Schreien. Es ist, als wäre die Pausenklingel ertönt und als wären Shannon und ich auf den Schulhof zurückkatapultiert worden.
Nach einem guten Stündchen, in dem wir Touristen ausgewichen sind, Kinder herumgewirbelt und Pelotas geworfen haben, erhasche ich einen Blick auf Shannon, die in einem unförmigen Kreis von Kindern tanzt und begeistert ein Lied singt. Ich bin mir nicht sicher, wer gerade mehr Spaß hat – wir oder sie? Doch im Gegensatz zu ihnen geht uns allmählich die Puste aus. Wir brauchen einen Fluchtplan.
»Eis für alle?«, schlage ich vor – mit Barrys Großzügigkeit und der meines Vaters im Hinterkopf –, und Shannon nickt.
Auch die Mütter, die in der Nähe sitzen, ihre Handarbeiten verkaufen und das Spektakel verfolgt haben, geben ihren Segen. Wir scheuchen die Kinder in den Eisladen, und im Handumdrehen verdoppelt sich ihre Zahl, weil noch andere entlang der Straße mitbekommen haben, was hier gleich passiert. Selbst Juanito Chiquito – der sicher keine zwei Jahre alt ist – wird von seiner Schwester hochgehoben, damit er sich eine Eissorte aussuchen kann. Einer nach dem anderen paradiert mit seiner kalten Leckerei wieder nach draußen. Snaggs und ich gönnen uns eine zweite Portion und setzen uns wieder auf den Gehweg, wo alles angefangen hat – und um uns herum eine Horde neuer Freunde, die an ihrem Eis schlecken, lachen und auf- und abspringen. Gordita sitzt eng zu meiner Linken und taucht ihr Löffelchen mal in ihre eigene, mal in meine Eiskugel.
Mit dem Messer in der Hand beuge ich mich über den drallen, mittelgroßen Thunfisch, den wir unterwegs gefangen haben. Die Swell liegt erstmals seit Monaten an einem Dock, und es ist schön, zur Abwechslung richtig Platz zu haben, um einen Fisch auszunehmen.
Als ich gerade den ersten Schnitt setzen will, schlendert ein schlaksiger Gringo Mitte vierzig auf mich zu und lehnt sich lässig an eine Lagerkiste.
»Stattlich«, sagt er.
»Danke.« Ich blicke nicht einmal auf. Auf Zuschauer habe ich gerade keine Lust, doch er hat den Wink wohl nicht verstanden und fängt an, ausführlich von einem Angelerlebnis zu erzählen. Ich habs kapiert, amigo , denke ich mir, du bist der Größte, und jetzt lass mich in Ruhe meinen Fisch zerlegen!
Er redet und redet, ich verdrehe die Augen und will das erste Filet herausschneiden. Ich war bis drei Uhr nachts wach und hab gegen eine Strömung von drei Knoten und einen wütenden Bienenschwarm angekämpft, um hier anzukommen. Ich bin hundemüde, hungrig und nicht in der Stimmung, mit ihm zu palavern.
Mein Messer ist nicht scharf genug, und meine Ungeduld macht es nicht besser. Ich massakriere das erste Filet, hacke es regelrecht vom Skelett – und natürlich geht auch die Haut nicht vom Fleisch ab.
»Weißt du«, sagt er und unterbricht die Schilderung irgendeines Sturms.
Ich weiß genau, was gleich kommt.
»Wenn du erst das Filet rundherum zuschneidest und das Fleisch vorerst am Knochen lässt, kriegst du die Haut leichter ab.«
Trotzdem ziehe und zerre ich missmutig weiter – und er fährt fort, als wäre nichts gewesen.
»Also, meine Eltern waren ja keine Segler …«
Ich versuche – vergebens –, ihn auszublenden, drehe den Fisch um und mache mich über die andere Hälfte her. Trotz meiner schlechten Laune beschließe ich, es mit seiner Technik zu probieren. Ich schneide zuerst am Rückgrat entlang, dann vom Kopf runter zum Bauch und so weiter – einmal um das Filet herum.
»Perfekt«, sagt er, »und jetzt vom Kopf her die Haut abziehen.«
Sie geht am Stück ab.
»Läuft doch.« Er grinst und geht endlich weiter.
Schlagartig ist mein Ärger verflogen, und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich war ihm gegenüber abweisend und respektlos und habe ihn nicht mal richtig angesehen. Ich zerlege das zweite Filet und renne ihm nach.
»Hier.« Ich drücke ihm das frisch zugeschnittene Stück Thunfisch in die Hand. »Danke für den Tipp!«
Es ist drei Uhr nachts. In völliger Dunkelheit sitze ich im Bug; meine Lifeline ist am Mast befestigt, und ich fühle mich mit ihm verbunden wie durch eine Nabelschnur. Der Mond ist verschwunden, und ich kann auch den Horizont nicht erkennen, orientiere mich aber halbwegs am gleichmäßigen Schwappen der ruhigen See entlang des Rumpfs. In der Dunkelheit blitzen immer wieder flackernde Sterne und Planeten auf, auch an Land brennt hier und da Licht, und in unserem Kielwasser wirbeln breite Biolumineszenzbänder. Ich kann mich daran gar nicht sattsehen. Irgendwas an dieser Szenerie erweckt in mir die Frage nach den Mysterien des Lebens.
Was zur Hölle machen wir hier eigentlich – hier draußen an diesem winzigen Punkt in der Weite? Worum geht es wirklich im Leben?
Das Großsegel flappt in der leichten ablandigen Brise, erschlafft und füllt sich erneut. Der warme, trockene Wind trägt Staubwirbel und immer wieder Flocken verbrannten Mülls von der guatemaltekischen Küste heran. Ich kneife die Augen zusammen und halte nach den Leuchten anderer Schiffe Ausschau. Antworten auf meine Fragen habe ich nicht, aber immerhin das vage Gefühl, als wäre ich genau dort, wo ich hingehöre.
Zum Glück haben wir in Puerto Escondido unseren Landsmann Pablo wiedergetroffen, den wir ein Stück nördlich von hier kennengelernt hatten und der uns überredete, unsere Shortboards gegen die längsten Boards einzutauschen, die wir dabeihätten, die Leashes zu lockern und so die Holddowns im wilden Beach Break zu verkürzen. Er bot Shannon sogar sein Big-Wave-Board an. Dank seiner Hinweise legten wir ein paar unvergessliche Rides hin, auch wenn ich ein wenig enttäuscht war, keine einzige Tube hinzukriegen. Als die Wellen uns zu hoch wurden, trommelten wir ein paar mexikanische Surferinnern zusammen, holten meine Freundin Katie ab, die auf Besuch war, und segelten zu einem abgelegenen Surfspot weit jenseits der Stadt. Wir genossen diese gemeinsame Zeit sehr, allerdings standen mir im Angesicht dieser starken Frauen insgeheim sofort wieder meine eigenen Schwächen vor Augen.
Hier weckt die einsame, dunkle Nacht meine innersten Gespenster. Ich hab sie weit von mir weggeschoben, solange ich mich erinnern kann, und immer einen guten Grund gefunden, um mich nicht mit ihnen auseinanderzusetzen. Beispielsweise habe ich mich nie hübsch genug oder begehrenswert gefühlt; und auch mit den hässlichen Seiten meines Charakters hab ich zu kämpfen: Ich kann fürchterlich geizig sein, ungeduldig und egozentrisch. Ich bin wahnsinnig empfindlich, richte meine Reaktion nach dem Verhalten anderer aus und fälle gern vorschnell Urteile. Hier und da habe ich depressive Phasen, dann dreht sich alles nur noch um mein Unwohlsein, und die Welt um mich herum wird unerträglich.
Читать дальше