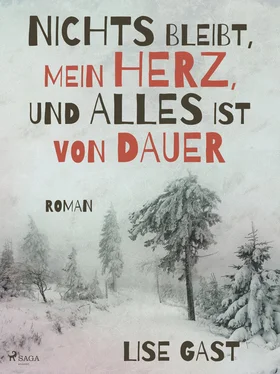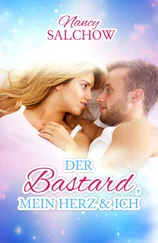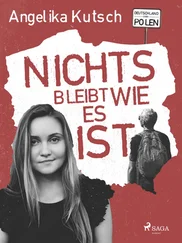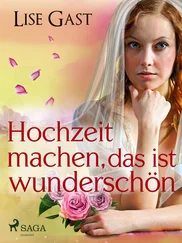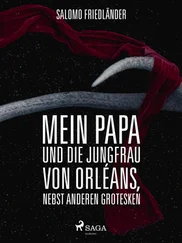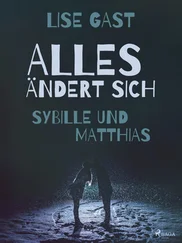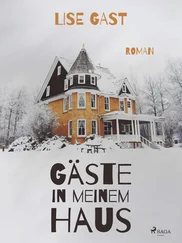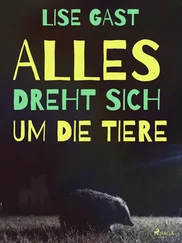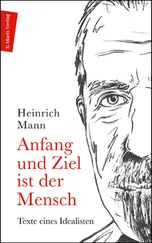Die Mutter erholte sich langsam, Regine pflegte sie treu. Es waren zwei Dienstmädchen im Haus und der Kutscher für die schwere Arbeit, trotzdem war die Siebzehnjährige überfordert. Sie schlief in dem Zimmer neben der elterlichen Schlafstube, und manchmal, wenn der Vater nachts von einem Patientenbesuch heimkam, saß sie in ihrem Bett, hatte ihr Kopfkissen in den Armen und wiegte es wie ein Steckkissen, wobei sie »Pschpsch« machte. Nebenan schlief Friederike tief und fest.
Mutter konnte nicht stillen. So mußte Regine für die Babyflaschen sorgen, mit denen die Kleine gefüttert wurde, mußte Windeln wechseln und Badewasser holen, sich um das Essen kümmern und den Vater beruhigen, wenn er aus dem Mariannenhaus kam. Er hielt früh Sprechstunde daheim, ging dann ins Krankenhaus und kam zu unregelmäßigen Zeiten zurück, verlangte aber, daß das Essen sofort auf den Tisch komme.
»Regine, sei so gut und mach ein bißchen Unruhe«, pflegte Mutter dann zu sagen, und so lief Regine ein und aus, klappte mit der Tür, wedelte das weiße Tischtuch über den Tisch, klirrte mit dem Porzellan und klapperte mit dem Besteck. Dann war Vater zufrieden, denn ›es tat sich was‹, und er verschwand mit der Zeitung in die Sprechstube, bis zu Tisch gerufen wurde.
Solange Mutter lag, ging dies alles nicht ganz ohne Schwierigkeiten über die Bühne. Regine mußte treppauf, treppab laufen, die schöngeschwungene Treppe, die nach oben führte, mit den flachen Stufen und dem glatten Geländer. Die Enkel machten es sich später leicht, sie rutschten das Geländer hinunter, lachend vor Wonne, im Reit- und Damenreitsitz, hui, um die Kurve und unten geschickt abspringend. Regine, die lange Röcke und ›erwachsene‹ Kleider trug, hätte diese Möglichkeit weit von sich gewiesen. So etwas tat man nicht. Sie lief und lief, wurde blaß und dünn dabei und atmete auf, als die Mutter wieder in der Eßstube auf ihrem Platz saß, auf dem Podest am Fenster, im Lehnstuhl, majestätisch und freundlich. Es war wie ein Wunder: sobald sie dort saß, lief alles wie am Schnürchen. Jedes Dienstmädchen wurde von ihr angelernt, sie selbst war eine hervorragende Köchin, und ein Mädchen, das nicht begriff, worauf es ankam, blieb nicht lange. Die aber, die der Frau Rat die Kniffe abguckten, blieben lange und verließen das Haus erst, um zu heiraten, als rundum ausgebildete Hausfrauen.
Die Mutter verstand viel von Pilzen. Oft brachten Patienten Pilze mit, oft auch der Kutscher. Mutter putzte sie immer selbst. Auf der Straße vom Dorf zur Neiße hin kam man am Pilzwald vorbei – der Wald hieß wirklich so. Auf den Wiesen vor dem Wald gab es im Frühling große Mengen von Schneeglöckchen, und die Schulkinder gingen um diese Zeit gern ›ei de Schniegleckla‹ und brachten der Frau Rat riesige Sträuße. Sie verließen das Doktorhaus nie ohne ein Stückchen Schokolade oder eine Handvoll Bonbons. Die Mutter schenkte ja so gern.
In diesem Doktorhaus wuchs Friederike heran. Der Vater verwöhnte sie maßlos, die Mutter erzog sie streng. Sie hing an beiden. Zu einem Vertreter, einem jungen Arzt, der kam, als Vater Urlaub machte, sagte sie einmal: »Hat dich dein Vater auch so lieb wie meiner mich?«
»Ich denke doch«, sagte der junge Mann.
»Küßt er dir auch immer die Hand, wenn du ungezogen warst?«
»Nein«, sagte der junge Kollege etwas konsterniert.
»Aber meiner!« triumphierte Friederike.
Das war so: War sie ungezogen, maulte sie oder war gar frech, so fürchtete der Vater, daß sie krank sei. Er fühlte ihr den Puls und küßte dann das kleine dicke Patschhändchen: »Ist gesund!«
Mit den Vertretern, die kamen, während der Vater Urlaub machte, hatte die Mutter allerlei Schwierigkeiten. Der eine brachte seine Familie mit, Frau und mehrere kleine Kinder; er verlangte, daß in der Eßstube ein Sandhaufen aufgeschüttet werde, damit die Kinder bei Regenwetter dort spielen könnten. Einer war Morphinist. Einer nahm sich das Leben, er erschoß sich auf dem Weg zum Krankenhaus. Aber auch damals bat Mutter ihren Mann nicht heimzukommen, sondern stand alles alleine durch.
Sie selbst machte Urlaub in Bad Gastein; sie nahm Friederike mit, während Regine sie zu Hause vertrat. Doch vorher reiste sie nach Wien, um ihren Bruder Eugen zu besuchen. Als Adjutant des Kaisers war er beim Kaisermanöver in Österreich. Ein Bild, das in der Familie erhalten blieb, zeigte die beiden Kaiser, den deutschen und den österreichischen, und Onkel Eugen lachend auf dem ›Schlachtfeld‹. Sie waren zu Fuß durch das Biwak gegangen. Von einem der Lagerfeuer hatte ein Soldat ihnen zugerufen: »Kommt doch, ihr drei, und setzt euch zu uns, hier ist’s warm!« Natürlich ohne zu ahnen, wen er da aufforderte.
Im selben Jahr, ein paar Wochen nach dem Wiedersehen, starb Onkel Eugen. Die Mutter fuhr mit Friederike sofort nach Wien zur Beerdigung.
Das war ein großes und unvergeßliches Ereignis. Am meisten imponierte der kleinen Friederike, daß des Onkels Reitpferd, mit einer schwarzen Schabracke bedeckt, vor dem Sarg hergeführt wurde. Dahinter kam der Wagen, von vier Rappen gezogen. Oben auf dem Sarg lagen des Onkels Orden. Ein langer, langer Leichenzug folgte. Der Onkel war Generalmajor gewesen. Seine Frau und seine beiden Töchter, Eugenia, genannt Genia, und Christel, folgten in einer schwarzverhangenen Kutsche, in der folgenden saßen Mutter und Friederike. Nach dem Begräbnis fand ein großer Empfang statt.
Friederike war durch die vielen Menschen, die so ernst blickten – die meisten Damen weinten –, verwirrt und eingeschüchtert und wich nicht von der Hand ihrer Mutter. Später, als sie mit Mutters Schwägerin und deren Töchtern zusammensaß und die Mutter von Bad Gastein erzählte, brach Friederike plötzlich in lautes Weinen aus. Sie wollte heim. Sie hatte Sehnsucht nach ihrem ›Feadel‹, so hieß das hölzerne Schaukelpferd auf gut schlesisch. Ihre Mutter versuchte sie zu trösten, schließlich versprach sie heimzufahren und verzichtete auf den Rest der Kur. Sie sah sich reich belohnt, als sie heimkamen und Friederike, getröstet und zufrieden, sogleich ihr Pferdchen suchte, es fand, umarmte und selig küßte.
»Ihr hättet es mitnehmen sollen«, sagte Vater tadelnd. Mutter lachte gerührt über das Töchterchen und über ihren Mann.
Nun saß sie mit ihrer feinen Strickerei am gewohnten Platz, die Welt war wieder in Ordnung. Auch Regine konnte wieder aufatmen. Und schon erschien die Gustel, die Botenfrau des Dorfes, um sich Aufträge zu holen.
Die Gustel kam jeden Tag. Die Mutter mochte sie sehr gern, denn die Botenfrau war ein Original, wenn auch ein ungewaschenes. Kinder, Enkel und Urenkel wuchsen mit dem tadelnden Ruf ihrer Mütter auf: »Wie die Gustel!«, wenn sie einmal sehr schmutzig heimkamen.
Die Gustel besaß einen kleinen Planwagen, den ein Hund zog. Diese jeweiligen Hunde – die Gustel blieb Botenfrau ihr Leben lang – hießen immer Waldi, sie nannte sie zärtlich ›Walderla‹. Sie hatten ihre Hütte im Hof des Doktorhauses, wurden auch dort gefüttert. Gustel liebte ihre Walderlas sehr, brachte sie aber nie mit ins Haus.
Jeden Tag zog sie mit ihrem Hundewagen und den Aufträgen aus dem Dorf nach dem neun Kilometer entfernten Frankenstein und kaufte dort ein. Aufträge bekam sie immer. Einmal sollte sie für die Tochter des Generaldirektors einen Brautschleier mitbringen. Als sie wiederkam, fand sich das Wertstück nicht mehr. Sie schwor darauf, es besorgt zu haben. Ein paar Tage später erschien ein anderer ihrer ›Kunden‹ und brachte ihr ein schwärzliches, zusammengeballtes Etwas, das er aus seinem Stiefel herausgeholt hatte, weil es ihn so drückte. Es war der Schleier.
Für die Frau Rat mußte sie allerlei besorgen, auch manche Sachen auf Vorrat. Da sie so gern schenkte, hielt sie sich immer ein paar Spielsachen für kranke Kinder. Da gab es Puppen und Soldaten, Bilderbücher und andere Herrlichkeiten, die in der Truhe warteten. Manchmal durfte Friederike das aussuchen, was ein weinendes Kind bekommen sollte. Das war ein Ehrenamt.
Читать дальше