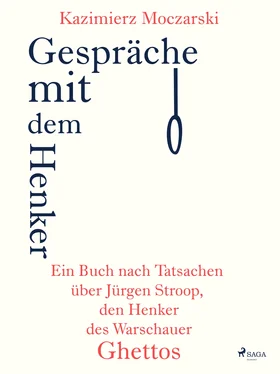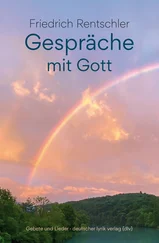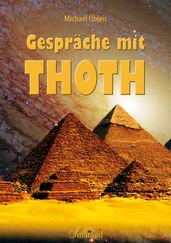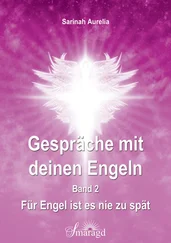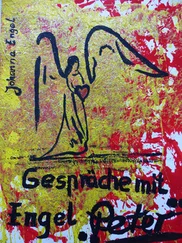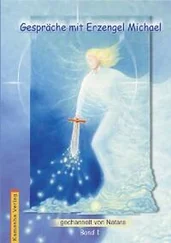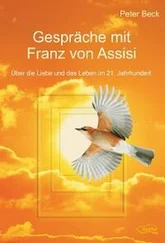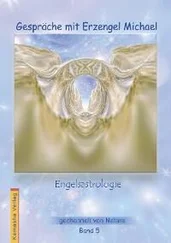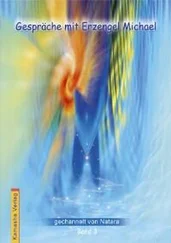Im März 1956 enthüllte Chruschtschow auf dem berühmten XX. Parteitag der KPdSU die Verbrechen Stalins. Das »Tauwetter« begann. Moczarskis Anwälte betrieben die Wiederaufnahme des Verfahrens. Moczarski wurde auf freien Fuß gesetzt.
Doch er war überzeugt: Dies durfte nicht das Ende sein. Er verlangte, endlich freigesprochen zu werden und forderte selbstverständliche menschliche Gerechtigkeit. Im Dezember 1956 fand in Warschau ein neuer Prozess statt, der eine öffentliche und offizielle Rehabilitierung zum Ziel hatte. »In diesem Saal bin nicht ich der Angeklagte – ich selbst klage an ...« Das Gericht entschied am 11. Dezember 1956, dass alle voraufgegangenen Urteile im Fall Moczarskis nicht rechtens waren, dass ihre Verhängung auf Grund von falschen Beschuldigungen erfolgte, dass Moczarski während der jahrelangen Haft unmenschlichen Folterungen ausgesetzt worden war, und dass er als ein Opfer stalinistischer Tyrannei zu gelten habe.
Kazimierz Moczarski wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen; in der Urteilsbegründung unterstrich das Gericht, dass seine Flaltung höchsten Respekt und volle Anerkennung verdiene.
Von 1957 arbeitete Moczarski als Journalist in Warschau; viel Zeit und Energie widmete er den sozialen Problemen, vor allem dem Kampf gegen Alkoholismus. Im Jahre 1971 begann er, die »Gespräche mit dem Henker« niederzuschreiben. Das Manuskript erschien in Fortsetzungen in der Breslauer literarischen Monatszeitschrift »Odra« (Die Oder) und fand sofort lebhafte Beachtung.
Doch zu dieser Zeit war das nachstalinistische »Tauwetter« in den kommunistischen Ländern längst wieder totalitären Tendenzen gewichen, in Polen wuchs abermals die Allmacht der geheimen Polizei. Das Jahr 1956, als die Gerechtigkeit ihren Sieg feierte und die vom Stalinismus Verfolgten endlich freier atmen konnten, gehörte der Vergangenheit an.
Kazimierz Moczarski starb im Herbst 1975. Damals wartete das beim Verlag PIW in Warschau hinterlegte Manuskript der »Gespräche mit dem Henker« auf eine Entscheidung der Behörden.
Freunde des Verstorbenen, die sich zum Teil gar nicht persönlich kannten, taten alles Erdenkliche, um den »Gesprächen mit dem Henker«, diesem einzigartigen historischen Dokument, den Weg zum Leser zu ebnen. Jene Menschen verband die Überzeugung, dass der Tod nicht zum Schlusspunkt für dieses ungewöhnliche Schicksal werden durfte.
Zwei Probleme sind mit dem Buch Moczarskis verknüpft: Das eine betrifft den Inhalt und die Bedeutung des Werkes, das andere wird von der Person des Autors, seiner Haltung, seinem Charakter und seinen Überzeugungen bestimmt.
Dieses Buch beschreibt die dunkelste Lebensphase eines Menschen. Und doch wird es von der ersten bis zur letzten Seite von der Leuchtkraft einer erstaunlichen Persönlichkeit überstrahlt. Für das geschundene, kranke Europa, für die Menschen unserer Tage könnten die »Gespräche mit dem Henker« einen Weg zur Menschlichkeit weisen.
Heinrich Böll spricht in seiner Einleitung zum »Archipel Gulag« von der »göttlichen Bitterkeit Solschenizyns«. Im Falle Moczarskis muss man von der Unantastbarkeit und Tragik eines Menschenschicksals in den Zwängen eines totalitären Machtapparates sprechen.
Der Leser sollte sich dessen bewusst sein, dass das Schicksal von Kazimierz Moczarski in der Mitte unseres Jahrhunderts keinen Ausnahmefall bildet. In Kategorien eines historischen Objektivismus gedacht, war sein Leben sogar recht typisch. Moczarski gehörte zu der Vielzahl von Polen, denen nichts erspart wurde. Die Größe und das Außergewöhnliche dieses Menschen beruhen auf der Haltung, mit der er sein Schicksal annahm, es trug und besiegte.
Als im September 1939 der Krieg ausbrach, war Moczarski Jurist und Journalist. Wahrscheinlich unterschied er sich damals überhaupt nicht von seinen Mitbürgern, denn in jener Welt, die keine schweren Heimsuchungen kannte, lebte man jahrelang dahin, ohne eine Ahnung von der Existenz der Hölle zu haben.
Sicherlich war Moczarski schon damals ein aufrechter Mann mit klar umrissenen Ansichten. Er gehörte in Warschau zu den Gründern des Demokratischen Klubs, einer seit 1937 bestehenden betont fortschrittlichen, überparteilichen Organisation.
Schon in jenen Jahren stand er den Idealen des Sozialismus nahe, obwohl er niemals ein Marxist wurde. Er hatte überhaupt ein sehr skeptisches Verhältnis zur Theorie und vertraute mehr den praktischen Erfahrungen. Sicherlich besaß er schon vor dem Krieg feste Grundsätze und hasste jegliche Verschwommenheit. Er war unabhängig in seinem Denken, was jedoch damals keine ungewöhnliche Tugend war.
Hier stellt sich die Frage: Was versteht man unter einer moralischen Ordnung? Moczarski musste sein Gewissen in Anfechtungen stählen, von denen ein gegenwärtig im Westen lebender Mensch keine Vorstellung haben kann. Geholfen hat ihm das Festhalten an bestimmten Grundsätzen des Humanismus, seine persönliche Würde und sein ausgeprägtes Ehrgefühl. Irgendwann schrieb ich, wahrscheinlich unter dem Einfluss meiner Freundschaft mit dem Verfasser dieses Buches, dass man »ein Gewissen weder kaufen noch verkaufen, es auch nicht auf den Staat, die Nation, eine Klasse übertragen kann – oder wir hören auf, als Menschen zu existieren«. Diese Formulierung könnte gemischte Gefühle hervorrufen, unter Lesern, die gewohnt sind, mit einem ruhigen, zeitweilig eingeschläferten Gewissen zu leben, weil das Schicksal ihnen große Prüfungen erspart hat. Meine Stimme, wie auch Moczarskis Buch, hat einen fremden und fernen Klang, und man sollte wohl keine andere Reaktion erwarten als ein etwas melancholisches, höfliches und nicht sehr dauerhaftes Mitgefühl, das ein ausgeglichenes Gemüt angesichts einer weit entfernt stattgefundenen Katastrophe überkommt.
Hier aber handelt es sich nicht um ein Unglück, sondern um Heldentum. Wahrscheinlich stellt Heldentum für eine wohlgeordnete westliche Welt eine noch ferner liegende Erfahrung dar als ein Unglück. Denn ein Unglück kann jedem passieren, das ist menschlich. Aber Heldentum?
Kehren wir zum Verfasser dieses Buches zurück.
Moczarski macht den Septemberkrieg 1939 als Reserveoffizier an vorderster Front mit, und er geht unmittelbar nach der Zerschlagung Polens durch die Kriegsmaschinerie Hitlers in den Untergrund. Er kämpft dort tapfer und unerschrocken. Wegen seines Mutes und seiner Charakterfestigkeit werden ihm besonders schwierige und delikate Aufgaben übertragen: Innerhalb des »Führungsstabes des Zivilen Kampfes«, der von der Vertretung der Exilregierung ins Leben gerufen worden war, um den Widerstand der Bevölkerung zu organisieren und zu leiten, leitet er die Untersuchungen gegen Kollaborateure. Man kann sich vorstellen, wie schwierig diese Tätigkeit war. Unter tiefster Geheimhaltung sammelt er Material, das den Staatlichen Polnischen Gerichten, Teil der konspirativen Verwaltung des Untergrunds, als Grundlage für die Durchführung von Prozessen dient. In Moczarskis Händen ruht das Schicksal vieler Menschen. Er muss Ankläger und Verteidiger zugleich sein, denn die Verdächtigen hatten ja von den gegen sie geführten Untersuchungen keine Ahnung. Er muss diese Menschen unter Wahrung aller Regeln der Konspiration beobachten, Informationen über sie sammeln, die möglichst objektiv sein mussten. Stets ist er sich dessen bewusst, dass dem Verdächtigen das Todesurteil droht, denn so lautete die Strafe für Verrat am eigenen Volk.
Wie viel Selbstdisziplin und Verantwortungsgefühl, welch ein waches Gewissen gehörten dazu, in einer Atmosphäre ständiger Bedrohung sein Leben aufs Spiel zu setzen, um die Wahrheit über Menschen zu erfahren, auf denen nicht nur der Vorwurf der Schande, sondern auch die Anklage der Kollaboration mit Mördern lastete.
Читать дальше