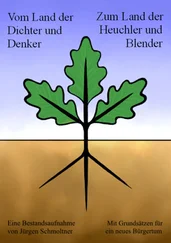»Sie sicherten sich die Schürfrechte, wurden enorm reich und lösten einen Diamantenrausch in der Kolonie aus. Diamanten, die wurden auf den Knien eingesammelt, in Marmeladengläsern«, sagte Ludwig, und es klang nach Ekel, nicht nach Freude. »Diamanten, die liebte man dort nicht, man hasste sie. Oder vergötterte sie. Viele Männer blieben. Nissen nicht.«
Den Rest wusste ich aus der Schule und von meiner Mutter. Sönke Nissen bezahlte den neuen Deich und bekam das Recht, dem Koog seinen Namen zu geben, sowie sieben Höfe samt fruchtbarstem Land.
Er brachte ein Stück seiner neuen Heimat zurück in die alte. Er ließ sieben Gutshäuser im Stil der Farmen Namibias bauen, weiß und breit, und gab den Höfen Namen von Bahnstationen aus Deutsch-Südwest, die ihm soviel Glück gebracht hatten. Und da sind sie, wie Perlen auf einer Schnur, wie Stationen einer weiteren Bahn, die er gebaut haben könnte. Nur ins Wasser, das zu Land wurde, nicht durch den Sand, der zum Weg wurde: Elisabethbay, Lüderitzbucht, Kolmannskuppe, Seeheim, Grasplatz, Keetmannshoop, Kalkfontain.
Und eine weitere Laune des Herrn Nissen sollte weithin leuchten und tut dies bis heute: Die Dächer, verfügte er, die Dächer sollten alle in der Farbe des Dachs des Hamburger Michels gestrichen werden, in hellem Grün. Ludwig erzählte, dass zwei Handwerksmeister, der eine Maler, der andere Tischler, von dem noch zu sprechen sein wird, eigens nach Hamburg fuhren und auf den Kirchturm des Michels stiegen, um den richtigen Farbton des angelaufenen Kupferdaches zu bekommen.
Bevor noch der Koog fertig eingedeicht worden war, vor gut 20 Jahren, war Herr Nissen gestorben. Ludwig hatte er uns dagelassen. Ob mein Vater wohl einen guten Knecht brauchen könne? »Arbeit gibt’s genug«, hatte mein Vater geantwortet.
Wir lebten auf unserem Hof wie auf unserem eigenen. Die Pacht wurde pünktlich bezahlt. Die Besitzerin, die Witwe Sönke Nissens, ließ sich nur selten sehen. Sie hatte wohl noch anderswo Besitz.
Immer wenn ich Angst bekam, hatte ich das Gefühl, meine Ohren wüchsen. Als ob mein Kopf ein wenig schrumpfte und die Ohren weiter ausgefahren würden. Wenn ich dann ganz stillhielt, konnte ich sie gut spüren, die Angst. Wenn es dunkel war, das machte mir nichts aus. Wenn der Sturm kam, die Flut hoch stieg, das schreckte mich nicht. Es war eher ein Sonntagmittagsgefühl von Einsamkeit. Wenn alle, auch Irene und Ludwig, meine Eltern, meine große Schwester, als sie noch bei uns lebte, zu Mittag schliefen. Wenn die Sonne die gute Stube warm machte, der Wind die Gardinen bewegte, dann konnte ich Angst kriegen. War ich als Einziger übrig? Waren die anderen tot?
Ich summte, singen wäre zu laut gewesen. Ich summte, schaffte es aber nicht, ein Lied oder nur eine Melodie zu fangen. Bis ich eine der drei Katzen sah, die auf ihrem Rundgang vorbeikam. Oder Scharik, den Hund, hörte, der sich von Fliegen ärgern ließ.
Manchmal träumte ich davon, dass ein Zug bei uns hielt. Ein dampfendes, rauchendes, rasselndes Ding, das am besten auch noch wahnwitzig laut pfiff. Es holte mich ab und fuhr auf gerader Strecke parallel zum Meer zum nächsten Hof, zur nächsten Station. Nach der siebten, Kalkfontain, pfiff der Zug erneut, ich beugte mich zum Fenster hinaus und hielt meinen Kopf in den Wind, sah drei, vier der Höfe noch hinter uns. Vor der Lokomotive aber lag leere, sandig-gelbe Strecke, von grauen Steinen bekörntes Land, die Luft war heiß, sie flimmerte. Und dann fuhr die Eisenbahn an.
Unser Koogsland war grün. Ich stellte mir manchmal vor, wie es von einem Flugzeug aus aussehen müsste. Grün, entschied ich. Natürlich. Auch die Dächer. Sie sollten wahrscheinlich wie Kupfer aussehen, das schon viele Jahre auf den wuchtigen weißen Häusern lag.
Sönke Nissen hatte diesem Ort nicht nur seine Erlebnisse mitgeben wollen durch die Bauweise der Häuser und die Namen, die in großen, schwarzen Buchstaben über den Eingangstüren standen. Er hatte ihnen auch eine Vergangenheit geben wollen. Ein bisschen Patina und Grünspan.
Und noch etwas ging mir mit den Jahren auf. Wir wohnten an einem Ort, der kein Punkt, sei er noch so groß, sondern eine Fläche war. Sönke-Nissen-Koog, das war unsere Adresse, aber es war eben doch nur die Summe der Höfe an den Feldern, ab und zu ein Haus an geradem Weg. Wie eine Gruppe von Inseln, die einen gemeinsamen Namen hatten.
Meine Schwester war erst im vergangenen Jahr ausgezogen. Ihr Mann, ein deutliches Hochdeutsch sprechender Düngemittelvertreter für den nördlichen Abschnitt, war mit ihr nach Elmshorn gezogen. Ich hatte mich, weil wir uns oft gestritten hatten, erst gefreut, dass sie ausgezogen war. Doch schon während der Hochzeitsfeier, die hier auf Elisabethbay gefeiert worden war, wurde mir der Triumph sauer.
Es war noch ein bisschen einsamer hier ohne sie. Zu ihr hatte ich gehen können, wenn ich abends noch etwas erzählen wollte. Sie konnte ich – neben Irene und Ludwig – etwas fragen, das ich meine Eltern nicht fragen wollte.
Sie schrieb regelmäßig. So regelmäßig, dass es uns allen auffiel, als die Briefe seltener kamen. Ich sollte sie, so war es an Weihnachten allgemein beschlossen worden, in den Sommerferien einmal besuchen. »Da hat der Junge doch Zeit, das kann er doch gut! Das ist doch auch für ihn interessant! Da wird er aber Augen machen, Euer Hannes, wirst Du doch sicher, was?«
Auf die konkrete Einladung wartete ich nicht mehr. Meine Mutter hatte das geplante und von allen Beteiligten für gut befundene Vorhaben bereits zweimal in ihren jüngsten Briefen angesprochen, aber keine Reaktion bekommen. Jeder Tag, an dem kein Brief mit einer Bestätigung kam, war mir deshalb recht. Meine Mutter dagegen, schon von beachtlichem körperlichen Umfang, hoffte immer noch, dass bald Post kam. Ebenso verabredet wie mein Besuch im großen Elmshorn war – Irene teilte mir auch das mit –, dass meine Schwester die Wochen vor und nach der Geburt hier bei uns sein sollte zur Unterstützung meiner Mutter.
Ich hatte nichts verstanden. Besuch, ja gut, das kam vor. Ich fegte den Hof gemeinsam mit Ludwig, der aber nichts erzählen wollte, nicht einmal andeuten.
»Nun sag schon. Wer?«
Ludwig wandte sich mit seinem Besen immer wieder ab. Fand immer wieder neue Ecken und Kurven, die er fegen wollte. Ich hinterher.
»Ludwig, nun sag schon.«
Er räusperte sich: »Die Madame.«
Ich sah ihn fragend an. Er machte wieder ein paar Schwünge, sah sich dann um, ob mein Vater, der nicht nur mit mir streng war, uns nicht schwatzen sehen könnte.
»Die Madame, die Nissensche.«
Er fegte weiter, als wolle er die Zeit, die er mit den paar Worten vergeudet hatte, wieder einholen.
»Und was ist daran so besonders? Die kommt doch immer.«
»Im Herbst, nach der Ernte«, brummte Ludwig und wies mit dem Kopf auf das hochgelbe Feld gegenüber unserer Einfahrt.
»Und was ist jetzt?«
»Jetzt?«
»Sommer.«
Ich fegte ebenfalls ein paar Schwünge weiter, rätselnd, was seine Worte bedeuten könnten. Ludwig fegte sich an mich heran.
»Sie kommt nicht allein.« Er sah wieder zum Stall und zum Haus hinüber. »Bringt ihren Neuen mit. Den Schweden.«
Er sah mir ins Gesicht, nickte, als wolle er mein Begreifen damit anschubsen.
Und dann wurde er noch deutlicher: »Das heißt nichts Gutes, wenn die mit dem jetzt kommt. Die ist nett, ich kenn’ die noch von früher, von Nissen. Aber ihren Neuen nicht. Wenn die man nicht alles verkaufen will!«
Mehr sagte er nicht. Doch bei jedem Besenstrich wuchs nun auch in mir die Sorge.
Mein Vater war ebenfalls zunehmend nervös, je näher der Tag rückte, an dem der hohe Besuch kommen sollte.
Mein Geburtstag rückte auch immer näher. Ich argwöhnte an manchem Abend, an dem ich in meiner Dachkammer nicht einschlafen konnte, dass die Babys oder der kommende Besuch mir vielleicht meinen 12. Geburtstag verderben könnten. Oder alles zusammen, man konnte schließlich nie wissen, wie lange so ein Besuch blieb. Die Madame war immer nur ein paar Tage geblieben, manchmal hatte sie ihren erwachsenen Sohn mitgebracht, der wie sein Vater auch Sönke hieß. Richtig viel hatte der nicht geredet, aber es war ihm anzumerken, dass er einen richtigen Bauernhof nicht so oft sah.
Читать дальше