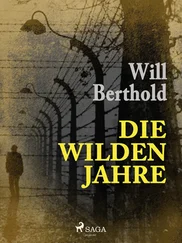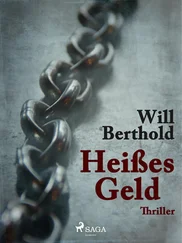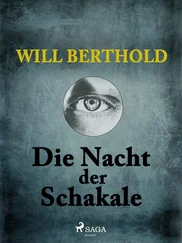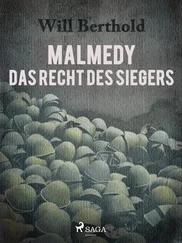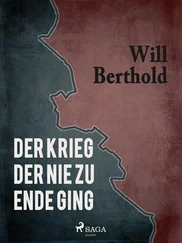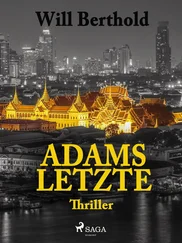Ich stand vor der Spruchkammer. Ich sagte: »Ich werde nie mehr einen Menschen hinrichten – mögen die Richter künftig ihre Todesurteile selbst vollstrecken!«
Neben mir saß Hans, der mir von meinen vier Kindern am nächsten stand. Er wollte helfen und konnte es nicht.
Er verzweifelte über mich.
Er verzweifelte für mich und ging freiwillig in den Tod.
Sie holten mich öfter, und wieder war der Tod in meinem Gefolge. Auf Befehl. Wie früher. Nur trugen diesmal meine Auftraggeber Uniformen statt Roben. Und die Männer, die ich hängte, waren in meinem Tagebuch keine Namen, die mir nichts sagten. Ihre Untaten hatten selbst in den dünnen Nachkriegszeitungen reichlich Platz eingenommen.
In der Nacht vor der Hinrichtung wurden sie in einen Keller gebracht. Eine Häftlingskapelle veranstaltete für sie ein Wunschkonzert, während die Frauen, die am nächsten Morgen Witwen sein würden, mit verstörten Gesichtern im »Hotel Goggl« herumsaßen.
Es gab wieder eine Henkersmahlzeit; jeder Verurteilte durfte rauchen, soviel er wollte, nur Alkohol blieb den Rotjacken versagt.
Dann wurden sie aufgerufen und gingen zum Galgen, von Priestern begleitet. Und ich waltete meines Amtes, wie immer so schnell, zielstrebig und schmerzfrei wie möglich. In die Augen brauchte ich dabei keinem zu sehen, denn es wurde ihnen eine schwarze Kapuze über das Gesicht gezogen, bevor ich den Mechanismus der Falltüre auslöste.
Zwischen den Hinrichtungen lebte ich jetzt in einer vorläufigen, brutalen Freiheit. Manchmal wurde ich nach Landsberg gerufen und dann wieder nach Hause geschickt; dann jeweils hatten die deutschen Anwälte der Rotjacken einen Hinrichtungsstop erwirkt. Meistens war es kein fragwürdiger Zeitgewinn, denn immer mehr Insassen von Landsberg wurden begnadigt, so daß ich am Ende nur noch sieben Delinquenten hinrichten mußte, unter ihnen Oswald Pohl, als Chef des SS-Wirtschaftshauptamtes zuständig für die KZ-Lager und die Leichenfledderei an den Ermordeten, Otto Ohlendorf, Chef eines Vernichtungskommandos, der nach eigenem Eingeständnis 90000 Menschen liquidiert hatte, und Standartenführer Paul Blobel, dem der Mord an 60000 Menschen vorgeworfen wurde.
Die Tage der Freiheit empfand ich von vornherein als eine Leihgabe. Bei den Anfeindungen, denen ich ausgesetzt war, mußte ich damit rechnen, daß man mich wieder holen würde. Im Mai 1947 erschien die Polizei und verhaftete mich. Als einer der Vollstrecker der Todesurteile des Dritten Reiches kam ich in das Internierungslager nach Moosburg.
Krankgeschrieben lieferte man mich in ein Interniertenlazarett in Garmisch ein. Ich hatte Kreislaufstörungen; mir ging es wirklich miserabel. Aber ich merkte bald, daß die anderen Patienten vorwiegend Prominente des Dritten Reiches waren, die bereits wieder eine Vorzugsbehandlung genossen. Ich bewegte mich unter feinen Leuten, und es war mir klar, daß die Größen von gestern meine Gesellschaft ebenfalls als merkwürdig empfanden.
Ich war zusammen mit Herrn von Papen, Emmy Göring, Feldmarschall Sperrle, Reichspostminister Ohnesorge, dem Hitler-Adjutanten Julius Schaub, SA-Obergruppenführer Brückner und vielen anderen gestürzten Hoheitsträgern, die ich nur aus der Zeitung und der Wochenschau kannte.
Nicht so sehr der Stacheldraht bedrückte mich als meine Mithäftlinge, die mir aus dem Weg gingen, als ob sie Angst vor mir hätten. Im Grunde verdankte ich es ja nur ihnen, daß ich im Internierungslager war. Aber sie wollten nichts mit mir zu tun haben.
Ich meldete mich gleich am ersten Tag beim Lagerleiter. »Ich gehöre nicht hierher«, erklärte ich ihm.
»Warum nicht?«
»Ich habe nur die Urteile des Reiches vollstreckt«, erwiderte ich. »Ich war ein kleiner, unbedeutender Mann.«
Ich erreichte nichts. Aber die Mithäftlinge erfuhren von meiner Intervention und benahmen sich entsprechend. Ich merkte es zuerst gar nicht, bis eines Tages der SA-Obergruppenführer Brückner zu mir kam, um mir die Verachtung des ganzen Lagers zu übermitteln.
»Reichhart«, sagte er. »Sie hätten die Hinrichtungen von Landsberg nie vollstrecken dürfen.«
»Was hätte ich denn tun sollen?« fragte ich.
Der Mann ballte die Fäuste. »Da hätten Sie sich eher selbst das Leben nehmen müssen!«
Ich drehte mich in meinem Bett zur Wand um.
Mein Zustand verschlechterte sich. Schüttelfrost. Man schaffte mich in den Operationsraum. Der behandelnde Arzt und seine Helfer waren ausnahmslos frühere SS-Leute. Sie verachteten mich wegen Landsberg.
Ich lebte in einem Getto innerhalb eines Gettos. Als Aussätziger. Ich haßte meine Mitgefangenen und wurde von ihnen gehaßt. Ich lebte in dumpfer Gleichgültigkeit. Die Baracken waren feucht und kaum geheizt. Ich war schwer krank und bekam kolikartige Schmerzen. Die schlechte Verpflegung war keine Schikane; zu dieser Zeit löffelte man in ganz Deutschland dünne Kohlsuppen. Auch die Menschen außerhalb des Internierungslagers mußten die Suppe schlucken, die ihnen die Menschen innerhalb des Internierungslagers angerührt hatten.
Ich lebte im Delirium und wartete auf das Ende. Es kam nicht. Nicht von selbst. Mein Bewußtsein dämmerte in einem Fieberwahn. Ich spielte mit dem Gedanken, Schluß zu machen. In meinen immer wiederkehrenden Anfällen sah ich mich in zwei Rollen: als Delinquent auf dem Schafott und gleichzeitig als Scharfrichter. Ich befahl mir selbst: »Mach schnell, Johann! Mach es wie immer!«
Vier Sekunden, überlegte ich verdämmernd, wie immer, länger darf es auch bei dir nicht dauern.
Es tat nicht einmal weh. Nebenan schnarchte einer. Das Urteil ist vollstreckt, dachte ich.
Dann schwamm mein Bewußtsein weg.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einem Bett. Vor mir stand ein Arzt und fluchte. »Schweinerei!« sagte er, während er an meinem Handgelenk hantierte.
Es schmerzte, und ich hatte die Empfindung, daß meine Armgelenke Stiefel waren, durch die man Schnürsenkel zog. Da begriff ich, daß man mein armseliges Leben wieder zusammennähte.
Ich weinte stumm, ohnmächtig und wehrlos, einem elenden Leben ausgeliefert. Ich verzweifelte, weil mir in meiner ganzen Laufbahn eine einzige Hinrichtung mißglückt war: das Todesurteil, das ich an mir selbst vollstrecken wollte.
Was es bedeutete, erfuhr ich schon wenige Tage später. Ich lag im Bett, an das der SS-Arzt Professor Dr. Packhaus herantrat. »Sieh da, der Henker«, sagte er höhnisch und drehte sich nach den anderen um.
Sie verstanden den Hinweis.
Ich war krank, hilflos. Ich konnte mich nicht wehren. Sie gingen mit Fäusten und Stiefeln auf mich los, rissen mich aus dem Bett, trampelten auf mir herum, bis ich das Bewußtsein verlor.
Ich lag Tage im Koma. Hinterher erklärte mir ein Arzt, er sei nicht sicher gewesen, ob ich je daraus wieder erwachen würde.
Ich wußte, was ich von meinen Lagergenossen zu halten hatte. Ich verstand mich auf sie.
Ich war ja ein Leben lang mit Mördern umgegangen.
Diese blutige Bekanntschaft hatte am 21. Juli 1924 begonnen.
Es war so weit. Im Gepäckwagen des Zuges, in einer riesigen Holzkiste verpackt, lag die Maschine. Die Arbeiter fluchten beim Einladen.
»Habt ihr Bleiklötze drin?« fragte der Zugschaffner.
Wir waren zu dritt im Abteil. Wenn wir zurückfuhren, würden drei Menschen nicht mehr leben. Drei abscheuliche Mörder. Ihr Fall stand in allen Zeitungen. Drei Gesichter. Eines wirkte brutal, das zweite gleichgültig, das dritte war ein Milchgesicht. Ich kannte die Fotos auswendig. Ich kannte die Unterschrift unter den Bildern. Drei Todesurteile im Landshuter Mordprozeß. Sie hießen Hutterer, Fischer und Steingruber.
Sie waren nach und nach auf die schiefe Bahn geraten. Zuerst hatten sie nur gestohlen und eingebrochen. Dann kamen die ersten Raubüberfälle. Eigentlich waren sie zu viert. Aber dem Vierten trauten sie nicht. Er hieß Langer.
Читать дальше