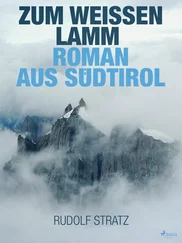Sie schwieg und gähnte nervös.
„Bloss wegen so ein paar tausend erbärmlichen Franken?“
Ein beinahe mitleidiger Blick als einzige Antwort.
„Aber weswegen sonst?“
Sie lachte kurz und verächtlich und schaute auf ihrer Seite zum Fenster hinaus, wo man nichts sah als einen vom Herbstwind gekräuselten, schilfumränderten See und jenseits kahlen Wald.
„Aus Hass gegen die Deutschen!“, sagte sie.
„Was haben wir Ihnen denn getan?“
„Ich bin so erzogen. Mein ganzes Leben war so. Meine ganze Familie ist so!“
„Dabei sprechen Sie doch fliessend Deutsch!“
„Ich bin zum Teil in Deutsch-Österreich auf der Schule gewesen und aufgewachsen. Ich besitze die ganze deutsche Bildung“
„Und trotzdem . . .“
„Das kommt bei uns oft vor!“
Sie rauchte und blickte ihn fest an. In ihren Augen war ein kalter, fanatischer Hass. In seinen Augen, als Erwiderung, derselbe Hass gegen die Feinde Deutschlands. Er setzte sich, mit einem raschen Entschluss, dicht neben sie und sagte knapp und bestimmt:
„Also passen Sie auf! Ich bin mit mir im reinen! Ich darf nicht anders: Ich muss den Schicksalswink benutzen . . . nicht wegen mir, sondern wegen der Leute in München. Es ist meine Pflicht, die Kameraden in München zu retten — und dafür Sie in Gottes Namen laufen zu lassen — aber merken Sie wohl — unter der Voraussetzung, dass Sie Deutschland auf der Stelle verlassen und sich nie wieder bei uns sehen lassen!“
Sie atmete tief auf und legte die Zigarette weg. „Gut!“ sagte sie.
„Und wer steht mir dafür, dass Sie es tun?“
„Ich schwöre es Ihnen!“
„Gott . . . Ihr Schwur . . .“
„Ich schwöre es Ihnen bei allem, was hoch und heilig ist!“
„Was ist Ihnen denn heilig?“
„Ich schwöre es Ihnen beim Grab meiner Mutter! Kann man beim Grab seiner Mutter lügen? Morgen bin ich weg für immer! Ich hab’ genug von heute! . . . Sie haben meinen wahrhaftigen Eid!“
Sie hatte halblaut, in unterdrückter Erregung, gesprochen. Sie hob feierlich die Hand. Ihr Antlitz leuchtete in einer fremdartigen und frommen dunklen Schönheit. Eine wilde Leidenschaftlichkeit wehte darüber hin und schwand. Die beiden Todfeinde sassen nebeneinander. Sie war plötzlich wieder, in jähem Wechsel der Stinimung, ganz beruhigt und zündete sich mit spitzen Fingern eine neue Zigarette an. Er begann:
„Vor allem muss ich so schnell wie möglich hier weiter! In Ihrem eigenen Interesse! Denn wenn die Polizei mich hier abfängt, habe ich gar keine Veranlassung, Sie zu schonen, und Sie sind mitgefangen und mitgehangen — in des Wortes verwegenster Bedeutung! . . . Also besorgen Sie mir sofort einen Zivilanzug mit allem Zubehör und leihen Sie mir Ihr Auto samt Chauffeur bis München!“
Sie bejahte ergeben, mit einem leichten Seufzer. Sie beugte sich im Sitzen fügsam etwas vor, drückte auf den Gummiball und begann, als der Chauffeur draussen daraufhin den Kopf wendete, durch das Sprachrohr mit ihm eine Unterhaltung in einer Mundart, die dem drinnen wieder das Böhmisch von vorhin schien. Die beiden stritten sich eine Weile miteinander, mehr wie Herr und Dame als wie ein Chauffeur und seine Gebieterin. Dann nickte sie: „Dobry!“ und sagte zu dem Gegner neben ihr: „Der Mann hat recht! Er meint, es ist das beste, er fährt in die Stadt zurück und holt seinen eigenen Sonntagsanzug und seine Sachen. Er hat ungefähr Ihre Gestalt. In einer halben Stunde ist er wieder da! Nun steigen Sie schnell aus!“
„Halt“ Sie drückte ihm noch rasch etwas in die Hand. Es war eine blaue Brille. „Setzen Sie das auf . . . Es ist meine eigene . . . Dann merkt man Ihre Augenfarbe nicht.“
„Das fällt doch gerade auf . . .“
„Beim Film?“ Da hat doch jeder mal etwas an den Augen!“
Nun begriff er erst, worüber er sich bisher keine Rechenschaft gegeben, dass dies hundertköpfige, buntscheckige Menschengewimmel vor ihm eine Filmaufnahme im Freien war. Auf grüner Wiese irrten und wirrten farbige Haufen, durch die ordnend, Gruppen formend, Stichworte ansagend, die Hilfsregisseure schossen, ein paar in fliegendem weissen Ateliermantel wie er, und mit blossem Kopf. Rufe aus langen, tütenartig gedrehten Sprachrohren überschrien, zwitschernde Signalpfiffe übertrillerten das sich langsam ordnende Gestrudel. Hammerschläge hallten aus dem Hintergrund. Hemdärmelige Arbeiter klopften da eilends die Latten- und Pappgestelle einer hochgiebligen mittelalterlichen Strassenreihe zurecht, die in den Stössen des Sturmes zitterte und schwankte. Der Himmel war herbstlich blassgrau und kühl. Zerrissene, weisse Wolkenballen jagten an ihm hin. Unten flatterten an drei, vier Stellen — auf dem Boden, in den Zweigen eines Apfelbaumes, auf einer hölzernen Plattform, die schwarzen Sargtücher der Photographenkästen, die weissen Kittel der Operateure. Ungeduldige Gesichter lugten nach der Windrichtung und dem Wolkenflug. Man wartete auf die Sonne. Es war noch Gewölk davor. Aber dort in der Ferne lag schon hoffnungsheller, goldener Schein über Stoppeläckern und braungepflügtem Land.
Es schien sich um ein mittelalterliches Volksfest zu handeln. Oder um eine Hinrichtung — was also ungefähr dasselbe war. Aus dem Gewimmel von Rittern, Edelfrauen, Ratsherren, Bürgermädchen, Handwerksgesellen, fahrenden Leuten, Landsknechten ragte in der Mitte des Platzes ein hohes, schwarzausgeschlagenes Schafott. Der Henker, von Kopf zu Fuss blutrot gewandet, stand unten an der Treppe, an die er sein blankes Richtschwert gelehnt hatte, und las, den Zwicker vor den Augen, stirnrunzelnd den Kurszettel. Auf dem freien Platz, zwanzig Schritte von ihm, harrte zwischen Schergen ein bleicher, apolloschöner Jüngling in Knappentracht und zündete sich gewandt, mit den gefesselten hohlen Händen vor den edlen Zügen, gegen den Wind eine Zigarette an.
Es pfiff kalt durch die Luft. Auf der Leiter, die, dem Schafott gegenüber, zu einem türmchenartigen Hochgerüst führte, witschte ein kleiner dicker Herr flink wie ein Wiesel die steilen Sprossen empor und donnerte oben, mit windflatternden Mantelschössen, in sonderbarem Deutsch durch ein Pappsprachrohr, das beinahe so gross war wie er selber: „Mjusik! Mjusik! . . . Tanzen! . . . Die Leute werden mir ja steif!“
Die Kapelle seitlings setzte mit einem Tangotakt ein. Edelleute, Mägdlein, Häscher und Volk schritten und schoben und liessen sich schieben und traten rückwärts und vorwärts, in hundert Farbenflecken, wie eine rhythmisch zuckende Malerpalette.
Der Mann, der aus der Limousine gestiegen war, nahm das Operettenbild einen Augenblick halb geistesabwesend in sich auf. Dann hörte er hinter sich das Surren des abfahrenden Autos. Er drehte sich jäh auf dem Absatz um. Ein Schrecken: Er sah seine Feindin nicht! Nur ihre Kammerfrau, die ihren dunklen Hut und Mantel wegtrug.
Doch: Da stand eine grosse, schöne, dunkeläugige, bleiche Nonne im langfliessenden schwarzen Klostergewand, unter dem nur die Füsse in den Sandalen weiss schimmerten. Ein blosser, schlichter Madonnenscheitel teilte ihr glattgestrichenes, glänzendes schwarzes Haar. Sie setzte mit Hilfe der wiederkehrenden Dienerin die grosse weisse Flügelhaube auf. Sie wirkte, in deren Beschattung über dem länglichen Antlitz, jetzt merkwürdig blutleer, wie ein schöner Schemen.
„Schauen Sie nur nicht selber auf Ihre Gefängnishosen“, sagte sie, während sich die Alte trollte. Dann tun’s die anderen auch nicht, sondern denken, das muss so sein! Hier läuft ja jeder anders herum!“
Das merkte er auch: Es war kaum möglich, hier aufzufallen, wo sich die Jahrhunderte und Stände auf einem Maskenball des Lebens mischten. Er hielt noch die blaue Brille in der Hand. „Benedikter! Ich muss dich nachher sprechen!“ rief ihm im Vorbeieilen ein junger, wie aus dem Modejournal von gestern entsprungener junger Mann zu, der ein Bündel Depeschen in der Hand trug, und winkte ihm kameradschaftlich mit der Rechten. Und er besann sich, dass er hier der Herr Benedikter sei . . . Aber wer war dieser Benedikter? Was tat er hier?
Читать дальше