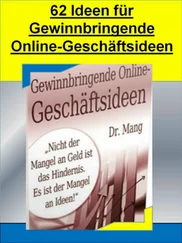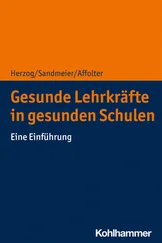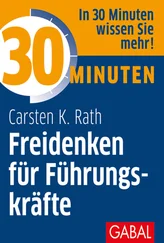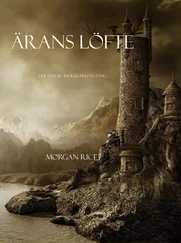Übung 213d
 Die Annahme eines umgekehrt proportionalen Verhältnisses zwischen Intension und Extension ist zwar weit verbreitet, aber letztlich nicht richtig, da Bedeutungen mit unterschiedlicher Intension durchaus die gleiche Extension zeigen können: Konstruieren Sie ein entsprechendes Beispiel!
Die Annahme eines umgekehrt proportionalen Verhältnisses zwischen Intension und Extension ist zwar weit verbreitet, aber letztlich nicht richtig, da Bedeutungen mit unterschiedlicher Intension durchaus die gleiche Extension zeigen können: Konstruieren Sie ein entsprechendes Beispiel!
Das wissenschaftliche Objekt der Linguistik ist die Sprache; dabei wird Sprache mit Hilfe von Sprache beschrieben und erläutert. Die Sprache als Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen wird als Objektsprachebezeichnet, die Sprache als Mittel wissenschaftlicher Untersuchungen demgegenüber als Metasprache(aus griechisch μετά meta ‚hinter, über‘ – vgl. auch Physik gegenüber Metaphysik ). So enthält zum Beispiel die folgende Feststellung sowohl eine objektsprachliche als auch eine metasprachliche Komponente (vgl. Abb. 213c): Der Satz „Fischers Fritz fängt frische Fische“ enthält keinen Artikel. Es gibt eine ganze Reihe an Wörterbüchern und Lexika zur sprachwissenschaftlichen Metasprache, deren Gebrauch angesichts der terminologischen Vielfalt der Linguistik im Allgemeinen und der Semantik im Besonderen angeraten sei (vgl. zum Beispiel: Bußmann 42008; Glück/Rödel 52016).
| Metasprache |
Der Satz |
|
enthält keinen Artikel. |
| Objektsprache |
„Fischers Fritz fängt frische Fische“ |
|
Abb. 213c:
Objektsprache und Metasprache (Beispiel)
Literatur
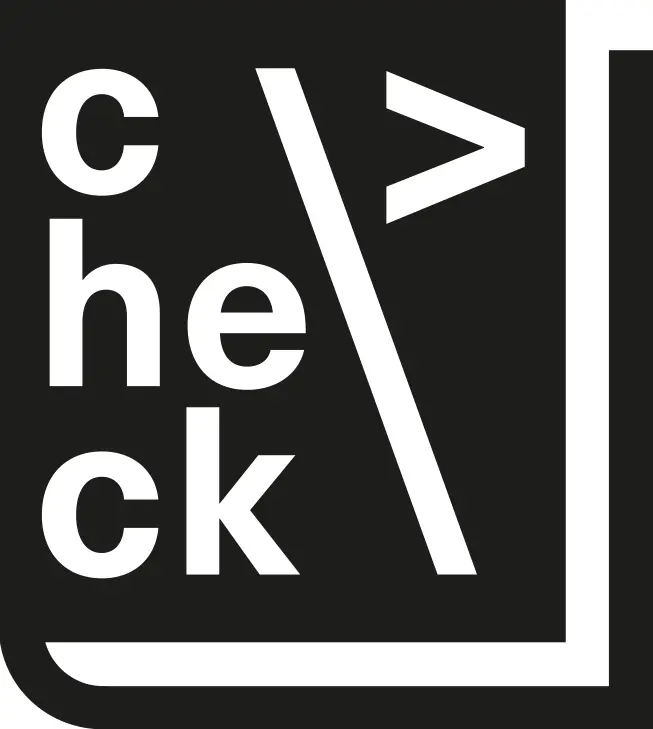 Arntz/Picht/Schmitz 72014; Croft/Cruse 62010; Gardt 1999; Leiss 2009; Nöth 22000, 2017; Posner/Robering/Sebeok 1996ff.; Posselt/Flatscher 2016; Ricken 1990; Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010.
Arntz/Picht/Schmitz 72014; Croft/Cruse 62010; Gardt 1999; Leiss 2009; Nöth 22000, 2017; Posner/Robering/Sebeok 1996ff.; Posselt/Flatscher 2016; Ricken 1990; Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010.
2.2 Beschreibung von Bedeutungen
Die Beschreibung von Bedeutungen gehört zu den zentralen Aufgaben einer jeden Semantik. Dabei haben sich zahlreiche verschiedene Modelle und Methoden herausgebildet, die eine solche Bedeutungsbeschreibung theoretisch begründen und praktisch gestalten. Im Folgenden werden vier der einflussreichsten Ansätze präsentiert und jeweils kurz diskutiert: zum Ersten der aus der Fachsprachenlinguistik bekannte Ansatz der Definitionvon Termini und zum Zweiten das Konzept der Wortfelder sowie deren Darstellung im Rahmen der Merkmalsemantikals Beispiele für eine systematische bzw. strukturalistische Vorgehensweise. Im Weiteren folgen dann mit der Prototypen- und der Stereotypensemantikeinerseits wie der Frame- und Skriptsemantikandererseits zwei Ansätze der sog. kognitiven Semantik, wobei sich die ersten beiden auf einzelne Wörter, die letzten zwei auf ganze Wortfelder beziehen.
Ein weit verbreitetes Verfahren der Angabe von Bedeutungen besteht im Aufstellen von Definitionen (Arntz/Picht/Schmitz 72014: 63–74; Roelcke 32010: 60–68). Solche Definitionen treten insbesondere innerhalb der fachlichen Kommunikation in Wissenschaft, Technik und Institutionen in Erscheinung und haben dabei in der Regel keine deskriptive (beschreibende), sondern vielmehr eine präskriptive (vorschreibende) Funktion (vgl. Kap. 2.5.2). Die allgemeine Definitionslehre unterscheidet diverse Typen von Definitionen sowie eine Reihe von Definitionsfehlern, die im Folgenden kurz skizziert werden.
Eine Definition setzt sich in der Regel aus drei Teilen zusammen (vgl. Abb. 221a): dem zu definierenden Element (das Definiendum), dem dieses definierende Element (das Definiens) und dem Element, welches diese beiden miteinander verbindet (der Definitor); im Falle des klassischen Typs der Definition, der auch als aristotelische Definitioncharakterisiert wird, untergliedert sich das Definiens wiederum in zwei Bestandteile: die Angabe einer übergeordneten Gattung (das Genus proximum) und die Angabe von Merkmalen, welche die betreffende Art gegenüber anderen Arten dieser Gattung unterscheiden (die Differentia specifica).
Dies lässt sich anhand der folgenden Definition leicht erläutern: Linguistik ist die Wissenschaft von der Sprache . Hier stellt das Fachwort Linguistik das Definiendum, also das Element dar, dessen Bedeutung festgelegt werden soll. Das Verb ist verbindet als Definitor dieses Definiendum mit dem Definiens. Und dieses Definiens als der die Bedeutung festlegende Teil der Definition wird durch die Wissenschaft von der Sprache gebildet; dabei stellen das Substativ Wissenschaft und sein Artikel die Angabe der Gattung und die attributive Präpositionalphrase von der Sprache die Angabe der artunterscheidenden Merkmale dar.
| Linguistik |
|
ist |
die Wissenschaft |
von der Sprache |
| Definiendum |
|
Definitor |
Definiens |
|
|
|
Genus proximum |
Differentia specifica |
Abb. 221a:
Aufbau einer klassischen (aristotelischen) Definition
Klassisch-aristotelische Definitionen eignen sich hervorragend zur Etablierung von Definitionsleitern und damit zum Aufbau von ganzen terminologischen Systemen. Dies lässt sich an dem folgenden Beispiel gut zeigen: In DIN 2330 (1993), einer terminologischen Grundsatznorm des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN), werden unter anderem die folgenden drei Termini definiert: Begriff , übergeordneter Begriff und Oberbegriff (die Bezeichnung übergeordneter Begriff bildet hier einen sog. Mehrwortterminus). Diese Definitionen lassen sich systematisiert wie folgt darstellen (vgl. Abb. 221b):
| Definiendum |
Genus proximum |
Differentia specifica |
| Begriff |
Denkeinheit |
die aus einer Menge von Gegenständen unter Ermittlung der diesen Gegenständen gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet wird |
| übergeordneter Begriff |
Begriff |
innerhalb eines hierarchischen Begriffssystems, der auf einer anderen, höheren Hierarchiestufe mehrere Begriffe zusammenfasst |
| Oberbegriff |
Übergeordneter Begriff |
innerhalb eines hierarchischen Begriffssystems, das durch Abstraktionsbeziehungen gekennzeichnet ist |
Abb. 221b:
Definitionen in DIN 2330 (1993), Beispiele
Die Termini sind hier von abstrakter Bedeutung (oben) zu konkreter Bedeutung (unten) dargestellt. Dabei erscheint das Definiendum der Definition eines abstrakten Terminus als Genus proximum im Definiens der Definition eines der nächsten konkreten Termini (also Begriff in der Definition von übergeordneter Begriff und übergeordneter Begriff wiederum in derjenigen von Oberbegriff ). Durch diese Identifikation von Definiendum und Genus proximum zweier nahestehender Definitionen entsteht eine Verkettung, die sich in Einzelfällen über viele Abstraktionsstufen ziehen und zu zahlreichen Verästelungen führen kann (zum terminologischen System der DIN-Norm vgl. Abb. 242d).
Neben der klassischen, aristotelischen Definition sind zahlreiche weitere Definitionsartenbekannt, die sich in der Gestaltung des Definiens voneinander unterscheiden (vgl. Abb. 221c). Hierzu zählen mit Blick auf die Gestaltung des Definiens die unsystematische Aufzählung von Merkmalen, die für das zu definierende Element charakteristisch sind (explikative Definition), die Angabe von entsprechenden Beispielen (exemplarische Definition), Hinweise zum Verfahren oder zur Herstellung des zu Definierenden (genetische oder operationale Definition), die Angabe von anderen Wörtern, die ebenfalls die Bedeutung des Definiendums aufweisen (Synonymendefinition), oder von solchen, deren Bedeutung mit dessen Bedeutung in einem mehr oder weniger genauen Zusammenhang stehen (wortassoziative Definition). Im Hinblick auf die Wahl des Definitors sind darüber hinaus die Definition, die sich auf eine bestimmte Sache, und solche, die sich auf einzelne Bezeichnungen selbst beziehen, zu unterscheiden (Real- und Nominaldefinition).
Читать дальше
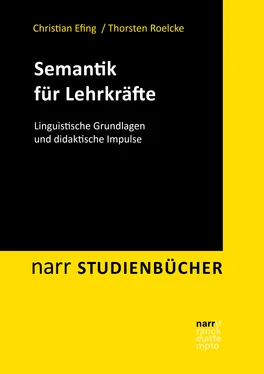
 Die Annahme eines umgekehrt proportionalen Verhältnisses zwischen Intension und Extension ist zwar weit verbreitet, aber letztlich nicht richtig, da Bedeutungen mit unterschiedlicher Intension durchaus die gleiche Extension zeigen können: Konstruieren Sie ein entsprechendes Beispiel!
Die Annahme eines umgekehrt proportionalen Verhältnisses zwischen Intension und Extension ist zwar weit verbreitet, aber letztlich nicht richtig, da Bedeutungen mit unterschiedlicher Intension durchaus die gleiche Extension zeigen können: Konstruieren Sie ein entsprechendes Beispiel!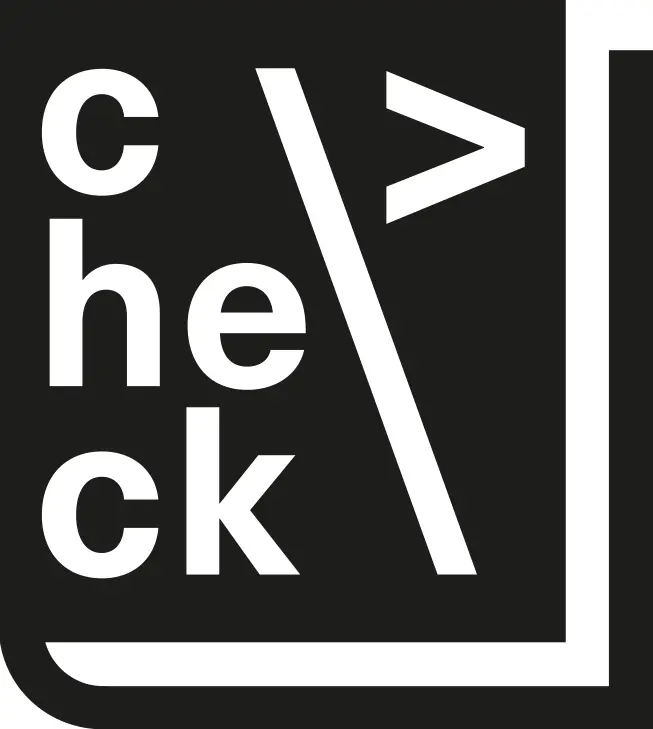 Arntz/Picht/Schmitz 72014; Croft/Cruse 62010; Gardt 1999; Leiss 2009; Nöth 22000, 2017; Posner/Robering/Sebeok 1996ff.; Posselt/Flatscher 2016; Ricken 1990; Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010.
Arntz/Picht/Schmitz 72014; Croft/Cruse 62010; Gardt 1999; Leiss 2009; Nöth 22000, 2017; Posner/Robering/Sebeok 1996ff.; Posselt/Flatscher 2016; Ricken 1990; Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010.