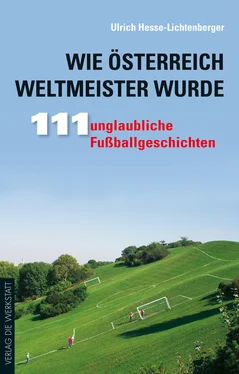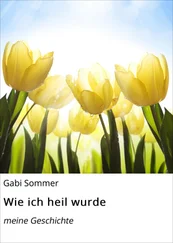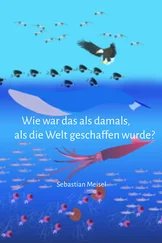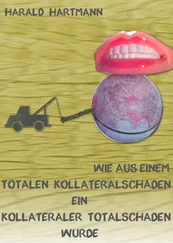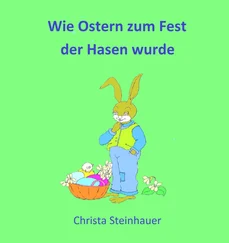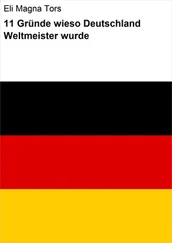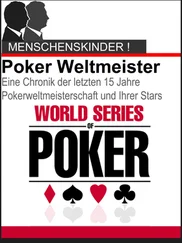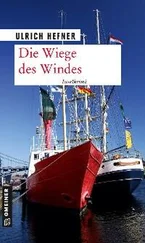Aber Trautmann hält nicht den Rekord, was das Spielen mit einer lebensgefährlichen Wirbelfraktur angeht. Diese zweifelhafte Ehre gebührt Billy Marsden von Sheffield Wednesday, der nicht nur 17, sondern gleich 42 Minuten absolvierte, in deren Verlauf er ständig von Lähmung oder sogar Tod bedroht war!
Auch in diesem Fall waren übrigens Deutsche zumindest indirekt beteiligt. Am 10. Mai 1930 spielte die englische Nationalelf in Berlin gegen Deutschland. Das war jene Partie, in der Richard Hofmann zum Volkshelden aufstieg, weil er drei Tore schoss und seiner Mannschaft zu einem sensationellen 3:3 gegen den haushohen Favoriten verhalf. Schon nach drei Minuten stieß Marsden, der erst sein drittes Länderspiel bestritt, mit einem Kollegen zusammen und bekam dessen Knie in den Rücken gerammt. (Bis heute ist nicht völlig klar, ob es sich bei dem anderen Spieler um Frederick Roy Goodall oder Ernest Blenkinsop gehandelt hat, Letzterer ebenfalls von Sheffield Wednesday.) Minutenlang wurde Marsden auf dem Spielfeld behandelt, dann rappelte er sich auf und spielte weiter. Erst zur Halbzeit wurde er aus der Partie genommen, die England mit zehn Mann beendete, weil zu jener Zeit noch keine Auswechslungen vorgesehen waren. Wie eine Röntgenuntersuchung in einem Berliner Krankenhaus später ergab, hatte sich Marsden bei der Kollision einen Halswirbel gebrochen. Er musste zwei Wochen lang in Berlin bleiben, bis er nach Hause reisen durfte. Marsden spielte nie wieder Profifußball.

Schon im November 1945,wenige Monate nach Kriegsende, nahm die Oberliga Süd ihren Spielbetrieb auf und ermittelte einen Meister. Die Umstände waren natürlich abenteuerlich, das Reisen war immer problematisch und die Spielausrüstung oft mangelhaft – Bälle stellten schließlich ein kostbares Gut dar.
Gleich in dieser ersten Nachkriegssaison kam es zu einem Skandal. Am letzten Spieltag trafen in Stuttgart der VfB (Zweiter mit 44:14 Punkten) und der 1. FC Nürnberg (Erster mit 45:13 Punkten) aufeinander. Schon nach drei Minuten wurde ein Nürnberger vom Platz gestellt, und zehn Franken unterlagen mit 0:1, was den VfB zum Meister machte. Doch die Gäste waren über die Rote Karte (und einige andere Dinge) so erbost, dass sie sich weigerten, den Stuttgarter Titelgewinn anzuerkennen. Dabei hätte sich all der Streit vermeiden lassen, wenn Nürnbergs Willy Billmann vorher etwas flinker mit der Nadel gewesen wäre …
Beim Auswärtsspiel gegen den sehr schwachen Karlsruher FV (der in dieser Saison 112 Tore in 30 Spielen kassierte) hatten die Nürnberger nämlich Probleme mit dem leichten Ball gehabt, den die Gastgeber benutzten. Da zu dieser Zeit kaum ein Verein einen Ersatzball hatte, verfiel Billmann auf die Idee, das Spielgerät zu zerstören, damit der Ball der Nürnberger in die Partie kommen würde. Um die Sabotage möglichst unauffällig zu begehen, nahm Billmann bei Einwürfen oder Freistößen vorsichtig die Sicherheitsnadel, die sein Trikot zusammenhielt, und perforierte damit den Karlsruher Ball. Die Methode war clever und erfolgreich – aber zu zeitaufwendig: Als Billmann endlich fertig und das Leder unbrauchbar war, hatten die Karlsruher schon vier Tore geschossen, der FCN verlor 1:4.
Billmann war ohnehin ein offenbar zu zurückhaltender und friedliebender Mensch. Das kostete ihn auch die Teilnahme am Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1948 gegen Kaiserslautern. Im letzten Ligaspiel zog er sich nämlich auf ungewöhnliche Weise einen Kieferbruch zu. „Ich wollte nur einen Streit schlichten“, erinnerte er sich, „und ein Schweinfurter hat mir den Ellbogen voll ins Gesicht gerammt. Dieser Kieferbruch war gleichzeitig das Ende meiner Fußballerlaufbahn.“

Der Jugoslawe GoranCurko kann kein ganz schlechter Torwart gewesen sein, sonst hätte er nicht für Offenbach, Bielefeld und Reutlingen in der 2. Bundesliga gespielt. Nur mit seinen Nerven, da schien er Probleme gehabt zu haben …
Am 20. Oktober 2000 traf Bielefeld daheim auf Mannheim. Curko war gerade eben zum dritten Mal vom „kicker“ in die „Elf des Tages“ gewählt worden, durfte also guter Dinge sein. Doch in dieser Partie gegen Mannheim unterlief ihm ein Ausrutscher, der zwar ohne Folgen blieb, aber die hinter seinem Tor stehenden Arminia-Fans gegen den Keeper aufbrachte. Darüber regte sich Curko auf, was wiederum die Zuschauer noch mehr verärgerte und … Nun, so schaukelten sich die Emotionen eben gegenseitig hoch – bis zur 62. Minute. Da hatte Curko genug und marschierte einfach so vom Feld und in die Kabine. Bielefelds neuer Trainer Benno Möhlmann musste in aller Eile Ersatzmann Dennis Eilhoff zwischen die Pfosten schicken. Trotzdem war der Coach gewillt, Curko im Kader zu behalten, doch Bielefelds Präsidium entließ den Spieler wegen „vereinsschädigenden Verhaltens“. (Die Partie endete übrigens 0:0.)
Knapp zwei Jahre später hatte Curko wieder Probleme mit unruhigen Fans, diesmal in Diensten des SSV Reutlingen. Im Heimspiel gegen Lübeck bekam der unsicher wirkende Keeper drei Gegentore, und die Anhänger forderten seine Auswechslung. Reutlingens Trainer Frank Wormuth sprach mit seinem Torwart und erfuhr, dass Curko bei Spielen manchmal die Konzentration verlor und an alle möglichen Dinge dachte, die nicht so richtig etwas mit Fußball zu tun hatten. Daher verfiel der Coach auf einen Kniff. Beim Spiel in Mainz am 15. September 2002 brachte Wormuth vier rote Zettel, etwas größer als eine Postkarte, an Torpfosten und Tornetz an. Reutlingen gewann 3:1, Curko war der beste Mann. „Ich war voll motiviert und konzentriert“, strahlte er später, „weil ich immer das Rot im Augenwinkel gesehen habe.“

Viele Fußball-Moderatorenhaben es sich angewöhnt, ihr Wissen um fremde Kulturen unter Beweis zu stellen. Sie sagen dann „Roma“ zum AS Rom, „ManU“ zu Manchester United und betonen das „Zeh Eff“ in CF Barcelona, damit auch jeder merkt, dass dieser Verein, da er spanisch ist, natürlich „Club de Fútbol“ heißt und nicht etwa FC (also „Football Club“). Aber wie das so ist, wenn man ganz schlau sein will: Manchmal – wie im Falle Roms – klappt es, meistens aber nicht.
Kaum ein Engländer sagt „ManU“, weil das wie das englischen Wort für „Menü“ klingt. Briten kennen den Klub als „Man United“ oder meistens bloß „United“. Nur wer dem Klub Böses will, der sagt „ManU“ und haucht noch einen „R“-Laut hinterher – denn „manure“ bedeutet Mist im Sinne von Dung. Wer von „ManU“ spricht, verrät sich sofort als Kontinentaleuropäer. Das aber ist ein verzeihlicher Fehler. Bei Barcelona stellt sich die Sache ganz anders dar. Zwar heißen fast alle spanischen Klubs in der Tat „CF“ (was normalerweise hinter den Vereinsnamen gesetzt wird, also: Valencia CF oder Real Madrid CF), der Klub aus Barcelona sieht sich jedoch als katalanischer oder sogar internationaler Verein, nicht als spanischer. Er wurde von einem Schweizer gegründet und stand immer auch unter englischem Einfluss, deshalb nennt er sich „Football Club“, FC Barcelona. (Ein anderer baskischer Klub, der aus Bilbao, heißt genau deshalb auch nicht „Atletico“, sondern britisch „Athletic“.)
Ist es nun so wichtig, ob man „CF“ oder „FC“ sagt? Im Falle Barcelonas schon. Denn eine Zeitlang hieß der Klub tatsächlich „CF“. Unter Francos faschistischem Regime wurde nämlich alles Fremdartige aus den Namen der Vereine getilgt, und Barcelona musste den „Football Club“ in „Club de Fútbol“ ändern. Für die stolzen Katalanen ist also ein solch kleiner Fehler ein Verweis auf schlimme Zeiten, in denen Real Madrid hofiert und man selbst unterdrückt wurde. (In diesem Zusammenhang könnte man auch noch Internazionale Mailand erwähnen. Viele italienische Klubs nennen sich „AC“ – für „Associazione Calcio“ – oder ähnlich, Inter aber ist ein „FC“, ein „Football Club“. Und auch Inter musste für diesen englischen Einfluss unter den Faschisten büßen: Während Mussolini an der Macht war, hieß der Klub „Ambrosiana“ – nach dem Schutzpatron der Stadt, Ambrosius, dessen Namen übrigens auch die berühmte Mailänder Bibliothek trägt, die erste öffentliche Bücherei Europas.)
Читать дальше