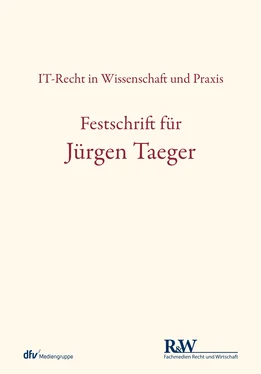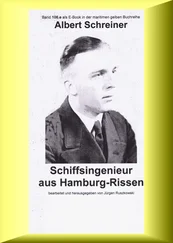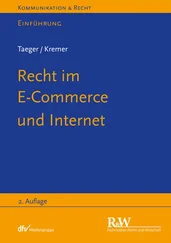4. Die Datenabfrage bei Auskunfteien
Geht es um die Zulässigkeit einer Bonitätsabfrage seitens vorleistender Unternehmen bei Auskunfteien, kommt als Legitimationsgrundlage zum einen die Einwilligung der betroffenen Person in Betracht, zum anderen aber auch die gesetzlichen Erlaubnistatbestände nach Art. 6 Abs. 1 lit. b (Vertragserfüllung) oder lit. f (Interessenabwägung). Letztlich wird man hier je nach Vertragsart differenzieren müssen. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO kommt von vornherein nur dann in Betracht, wenn das datenabfragende Unternehmen im Zuge einer Vertragserfüllung überhaupt irgendwie in Vorleistung geht und deshalb darauf angewiesen ist, die Wahrscheinlichkeit eines vertragskonformen Verhaltens auf Seiten eines potenziellen Kunden abschätzen zu können. Klassisches Beispiel ist der Kreditvertrag, dessen Abschluss ebenso wie dessen Konditionen im Einzelnen davon abhängig sind, welche Bonität ein potenzieller Kreditnehmer hat, weshalb es unstreitig erforderlich im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO ist, dass ein Kreditgeber die Bonitätsdaten potenzieller Kreditnehmer verarbeitet, um deren Kreditwürdigkeit beurteilen zu können.
Nicht immer ist allerdings die Frage, ob ein Unternehmen in Vorleistung geht, so einfach und eindeutig zu beantworten. Nicht nur Banken nehmen die Informationsdienste von Auskunfteien in Anspruch, sondern auch zahlreiche andere Unternehmen mit den verschiedensten Leistungsangeboten. So akzeptiert etwa die Schufa als sog. Vertragspartner, mit denen personenbezogene Daten ausgetauscht werden, Unternehmen aus den folgenden Branchen: Banken, Dienstleistung, eCommerce, Energieversorger, Forderungsmanagement und Factoring, Handel und Industrie, Immobilienwirtschaft, Leasing, Telekommunikation sowie Versicherungen.38 Nur teils kann für die Leistungsangebote aus diesen Branchen davon ausgegangen werden, dass eine Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO erforderlich ist. Mitunter dürfte selbst die Interessenabwägungsklausel des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO eine Datenverarbeitung nur schwer tragen.
Vermieter gehen nach ihrer eigenen Wahrnehmung sogar erheblich in Vorleistung, wenn sie ihren Mietern Räumlichkeiten zur Nutzung überlassen. Aus Mieterperspektive wiederum wird nicht nur die Mietzahlung zu Monatsbeginn, sondern zusätzlich auch die Mietkaution in Vorleistung erbracht. Aus letzterer Perspektive betrachtet wäre es dann aber auch nicht erforderlich i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, dass der Vermieter die Vertrauenswürdigkeit eines Mietinteressenten vorab zuverlässig beurteilen kann.
Jedoch wäre eine solche ausschließlich rechtliche Betrachtungsweise nicht sachgerecht, da sie die mitunter erheblichen wirtschaftlichen Risiken auf Vermieterseite gänzlich ausblendet. Die Frage ist weniger, ob Vermieter überhaupt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO Bonitätsdaten erheben dürfen, sondern vielmehr, ab welchem Zeitpunkt die Einholung von Bonitätsauskünften erforderlich im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO ist. Überzeugend ist insoweit die Herangehensweise, wie sie der Düsseldorfer Kreis bereits mit Beschluss vom Oktober 2009 vertreten hat: Zulässig ist danach die Einholung von Bonitätsauskünften zu einem bestimmten Mietinteressenten, wenn der Abschluss des Mietvertrags mit diesem Interessenten nur noch vom positiven Ergebnis der Bonitätsprüfung abhängt.39
b) Beispiel Versicherungen
Versicherungen wiederum können sich für eine Einholung von Bonitätseinkünften grundsätzlich nicht auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO stützen, weil sie anders als klassische Kreditgeber gerade nicht in Vorleistung gehen und daher für ihre Entscheidung über das Ob und Wie eines Versicherungsvertragsschlusses auch nicht auf die Kenntnis der Kreditwürdigkeit von Versicherungsinteressenten angewiesen sind. Allein der Umstand, dass unzuverlässige Versicherungsnehmer möglicherweise einen erhöhten Verwaltungsaufwand nach sich ziehen, ist für eine Erforderlichkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO ohne Relevanz. Als erforderlich könnte die Erhebung von Bonitätsdaten für Versicherungszwecke allenfalls dann eingeordnet werden, wenn Versicherungsunternehmen nachweisen könnten, dass Bonitätsdaten nicht allein für die Prognose einer vertragsgemäßen Prämienzahlung von Relevanz sind, sondern darüber hinaus auch Aufschluss darüber geben, als wie risikoträchtig das künftige Verhalten eines Versicherungsinteressenten einzuschätzen ist.40
In allen anderen Fällen scheidet Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO als Erlaubnistatbestand aus, und auch die Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO wird hier regelmäßig zuungunsten der Versicherer ausfallen. Allein deren Interesse an möglichst „pflegeleichten“ Vertragspartnern macht die Datenverarbeitung noch nicht zu einer erforderlichen Datenverarbeitung. Grundsätzlich ist diese Erforderlichkeit i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO eng auszulegen, wie dies der EuGH auch schon für die Vorgängervorschrift des Art. 7 lit. f DSRL betont hat (Beschränkung „auf das absolut Notwendige“).41 Daher reicht eine bloße Zweckdienlichkeit der Datenverarbeitung gerade nicht aus und allein die Zielsetzung einer „bestmöglichen Effizienz“ macht die Datenverarbeitung noch nicht zu einer erforderlichen.42
c) Beispiel Kauf auf Rechnung
Ein weiterer „Klassiker“ ist auch der Kauf auf Rechnung, der sich zunächst einmal als typisches Beispiel für ein Rechtsgeschäft präsentiert, bei dem das Unternehmen in Vorleistung geht und es aus Sicht des Unternehmens deshalb auch erforderlich ist, zuvor die Vertrauenswürdigkeit des Bestellers einschätzen zu können.43 Gleichwohl ist hier jedoch im Ergebnis die Erforderlichkeit einer Datenverarbeitung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO abzulehnen. Ausschlaggebend hierfür ist, dass der Kauf auf Rechnung lediglich eine mögliche Variante der Zahlungsabwicklung darstellt und das vorleistende Unternehmen alternativ die Versendung der Ware ebenso gut auch von einer Vorauszahlung des Kunden abhängig machen könnte. Wenn hier ein Unternehmen nichtsdestotrotz etwa aus Marketing-Gesichtspunkten in Vorleistung gehen und sich zur Risikoabsicherung einer Bonitätsauskunft bedienen möchte, so ist insoweit der sachgerechte Erlaubnistatbestand nicht der der Erforderlichkeit für eine Vertragserfüllung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, sondern vielmehr der Erlaubnistatbestand der Einwilligung.44 Einen flexibleren Ansatz wählt demgegenüber die Datenschutzkonferenz, die sich für die Legitimation einer Einholung von Bonitätsauskünften auf die allgemeine Interessenabwägungsklausel des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO stützen möchte, wenn im Zuge eines Bestellvorgangs ein finanzielles Ausfallrisiko nicht auszuschließen ist.45
Schon 2017 hat der Jubilar in einem Ausblick auf das „Datenschutzrecht 2018“ prognostiziert, dass es einige Zeit dauern wird, sich in die neuen Systematiken unter Geltung der DS-GVO hineinzufinden, die zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe gesetzeskonform auszulegen und Interessenabwägungen rechtssicher zu treffen.46 Vor Augen hatte Jürgen Taeger dabei vor allem „die hohe Komplexität des neuen Datenschutzrechts mit dem Zusammenspiel von europäischer Verordnung und nationalem BDSG“.
So hofft denn auch der Verfasser dieses Beitrags auf Nachsicht des Jubilars, wenn er hier abweichend von dessen Ansicht die Normen des BDSG auf Auskunfteien mangels Regelungsspielraums unter der DS-GVO nicht anwenden möchte. Zumindest könnte auf diesem Wege die vom Jubilar angesprochene hohe Komplexität des neuen Datenschutzrechts etwas reduziert werden. Der Gefahr, dass es dadurch zu noch mehr Rechtsunsicherheit kommt, weil dann noch mehr Datenverarbeitungsprozesse auf Grundlage einer allgemeinen Interessenabwägungsklausel (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO) zu beurteilen sind, könnte man wiederum dadurch begegnen, dass die Wertungen der alten und auch neuen BDSG-Regelungen für die allgemeine Interessenabwägung herangezogen werden.47 Damit wären sich Jubilar und Verfasser dann sogar im praktischen Ergebnis doch wieder einig, dass die bisherigen Errungenschaften des nationalen Datenschutzrechts bei der Regulierung von Auskunfteien auch zukünftig erhalten bleiben.
Читать дальше