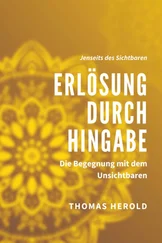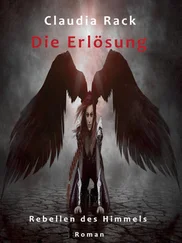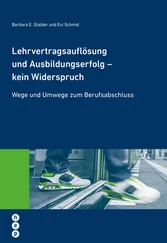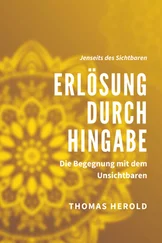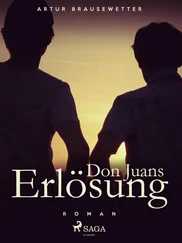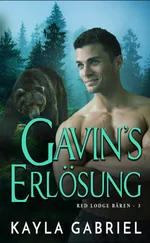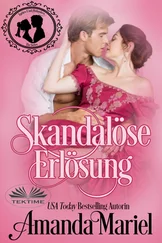Ein anderer Aspekt, der berücksichtigt werden muß, ist die ungeheure Macht und Autorität der orthodoxen Rabbiner und der chassidischen Zaddikim innerhalb der traditionalistischen Gemeinden des Ostens, die in Mitteleuropa nichts Gleichwertiges kennt. Daraus erwächst ein offener Konflikt zwischen der rebellischen Jugend, die dem Bund angehörte, sozialistisch oder anarchistisch war, und dem religiösen Establishment . »Da sie sich bedroht fühlten, reagieren die traditionellen Kreise oft mit offener oder heimtückischer Gewalttätigkeit, versuchen, ihre Sache mit allen Mitteln zu verteidigen, üben moralischen Druck und intellektuellen Terror aus … Vom kulturellen Erbe der religiösen Traditionen ist die Jugend durch und durch geprägt … Aber sie will frei werden von den Gesetzen, will die Fesseln nicht mehr tragen. Sie wirft es gewaltsam ab und setzt diesem Erbe ihre eigene Kultur entgegen. Es ist ihr innerer Feind.« 33
In diesem Zusammenhang entwickelt sich bei den progressiven jüdischen Intellektuellen ein heftiger »Antiklerikalismus«, von dem polemische Artikel, autobiographische Werke und Romane unerschöpflich Zeugnis ablegen.
Da er direkt mit einem Traditionalismus konservativster und autoritärster Prägung konfrontiert wird, kann der junge rebellische Jude aus Rußland oder Polen nicht diesen »romantisieren«, wie das in Deutschland oder Österreich möglich wäre. Diese Distanz, die eine im Benjaminschen Sinne auratische Wahrnehmung der Religion begünstigt, ist in Osteuropa nicht vorhanden.
Isaac Deutscher, der in einem Cheder (einer religiösen Schule für Kinder) im polnischen Schtetl Chrzanów erzogen und von seiner Familie zum Rabbiner der chassidischen Sekte des Zaddik von Ger ausersehen worden war, hat in seiner Jugend bereits mit der Religion gebrochen. Er wurde kommunistischer Führer in Polen und später der Biograph Trotzkis. Seine Einstellung zur Religion stellt er derjenigen der deutschen Juden gegenüber: »Wir kannten den Talmud und waren durchtränkt vom Chassidismus. Seine Idealisierungen empfanden wir nurmehr als Sand, der uns in die Augen gestreut worden war. Wir waren in der jüdischen Vergangenheit aufgewachsen. Wir lebten mit dem elften, dem dreizehnten und dem sechzehnten Jahrhundert jüdischer Geschichte Tür an Tür, ja, unter einem Dach. Dem wollten wir entfliehen, um im zwanzigsten Jahrhundert zu leben. Durch die ganze dicke Lack- und Goldschicht von Romantikern wie Martin Buber hindurch sahen und rochen wir den Obskurantismus unserer archaischen Religion und eine Lebensweise, die sich seit dem Mittelalter nicht verändert hatte. Für jemanden wie mich erscheint jedenfalls die modische Sehnsucht der westlichen Juden nach einer Rückkehr ins sechzehnte Jahrhundert, durch die man seine jüdische kulturelle Identität wiederzugewinnen oder neu zu entwickeln hofft, irreal und kafkaesk.« 34
Dieses Zitat macht die Motive der osteuropäischen revolutionären Intelligenz deutlich und zeigt, daß sich aus ihrer Mitte niemals eine geistige Strömung hätte entwickeln können, die jener in Mitteleuropa vergleichbar war.
Der einzige jüdische Intellektuelle des Zarenreichs, dem Religion und Spiritualität am Herzen liegen, konvertiert zum orthodoxen Christentum: Nikolai Maximowitsch Minski (N. M. Vilenkin) engagiert sich in der mächtigen Bewegung religiöser und revolutionärer Renaissance, die sich in St. Petersburg um die Jahrhundertwende um D. S. Mereschkowski, Zinaida Gippus, Nikolai Berdjajew und S. N. Bulgakow entwickelt hat. (Die »Konstrukteure Gottes« der bolschewistischen Partei, Bogdanow und Lunatscharski, sind im Zusammenhang mit dieser religiösen Renaissance ebenfalls von Bedeutung.)
Als Mitglied der Religiös-Philosophischen Vereinigung in St. Petersburg und der von Gorki herausgegebenen sozialistischen Revue Nowaja Shisn (Neues Leben) wird Minski stark beeinflußt vom Glaubensverständnis der russisch-orthodoxen Christen und scheint jede Verbindung zum Judentum abgebrochen zu haben. 35
Gibt es bei den revolutionären Juden des Ostens keinerlei Ausnahme von der Regel – wie Bernard Lazare in Westeuropa? Wahrscheinlich schon, aber soweit meine Forschungen bisher gediehen sind, habe ich sie noch nicht gefunden … 36
1Vgl. Pierre Guillen: L’Allemagne de 1848 à nos jours , Paris 1970, S. 58ff.
2Zum Begriff, seiner soziologischen Bedeutung und seiner verschiedenen Erscheinungsformen verweise ich auf meine Publikationen: Marxisme et Romantisme révolutionnaire. Essais sur Lukács et Rosa Luxemburg , Paris, Ed. du Sycomore, 1979; Pour une sociologie des intellectuels révolutionnaires , Paris, PUF, 1976.
3Vgl. Fritz Ringer: Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890–1933 , Stuttgart 1983, S. 12f.
4Vgl. Gershom Scholem: »Zur Sozialpsychologie der Juden in Deutschland 1900–1933«, Judaica IV , Frankfurt am Main 1984, S. 232.
5Vgl. Walther Rathenau: Ein preussischer Europäer. Briefe , (Hg: M. von Eynern), Berlin 1955, S. 146.
6Vgl. Gershom Scholem: »Zur Sozialpsychologie …«, S. 239.
7Vgl. Franz Rosenzweig: Briefe , Berlin 1935, S. 474.
8Vgl. Moritz Goldstein: Deutsch-jüdischer Parnaß, Der Kunstwart (Hg: Ferdinand Avenarius), 25. Jahrgang, 2. Viertel, Erstes Märzheft 1912, Heft 11, S. 286, 291.
9Vgl. Max Weber: Grundriß der Sozialökonomik , III. Abt.: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1947, S. 282.
10Vgl. Hannah Arendt: The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age , New York 1978, S. 68.
11Vgl. Friedrich Paulsen: Die deutschen Universitäten und das Universitätsstudium , Berlin 1902, S. 149f.
12Vgl. Ismar Elbogen: Die Geschichte der Juden in Deutschland , Berlin 1935, S. 302f.
13Vgl. Ismar Elbogen: op. cit ., S. 303 und Erich Rosenthal: Trends of the Jewish Population in Germany (1910–1939), Jewish Social Studies , VI, Juni 1944, S. 257.
14Vgl. das noch unveröffentlichte Manuskript des ungarischen Wissenschaftlers Zador Tordai: Wie kann man in Europa Jude sein? Walter Benjamin , Budapest 1979, S. 35, 48.
15Siehe die Analyse dieses Phänomens in dem vor kurzem veröffentlichten Werk von Frederic Grunfeld über die deutsch-jüdische Kultur: »But parents and grand parents were almost always unfathomable to the German – or Austrian – Jewish intelligentsia: the gulf between father Mahler’s small-town grog shop and his son’s cosmic Resurrection Symphony hardly seemed bridgeable in a single generation … The shoe-factory generation regularly produced and nurtured a brood of scribes, artists, intellectuals. Else Lasker-Schüler was the daughter of an investment banker … Walter Benjamin of an antique dealer … Stefan Zweig of a textile manufacturer, Franz Kafka of a haberdashery wholesaler … Often this pattern involved the sons in a double revolt – against the father’s Jewish-bourgeois values, and against the system of obedience training of German society as a whole.« (Frederic V. Grunfeld: Prophets without Honour. A Background to Freud, Kafka, Einstein and Their World , New York, McGraw-Hill, 1980, S. 19, 28f.)
16Leo Löwenthal: Wir haben nie im Leben diesen Ruhm erwartet. In: Mathias Greffrath (Hg): Die Zerstörung einer Zukunft. Gespräche mit emigrierten Sozialwissenschaftlern , Reinbek bei Hamburg 1979, S. 199.
17Vgl. Karl Mannheim: Das Problem der Generationen, Wissenssoziologie , Neuwied 1964, S. 542.
18Wir verwenden den Neologismus »An-Akkulturation«, um die Umkehrung des Vorgangs der Akkulturation zu bezeichnen, die Rückkehr einer Gruppe oder eines Individuums zu seiner ursprünglichen Kultur.
19Vgl. Martin Buber: Über Jakob Böhme, Wiener Rundschau , Band V, Nr. 12, 1901.
Читать дальше