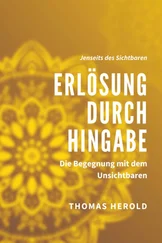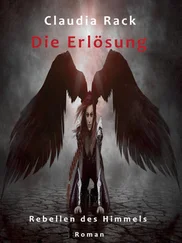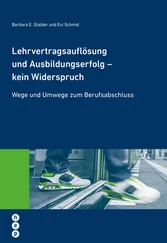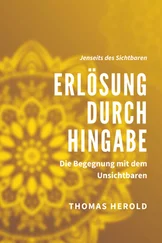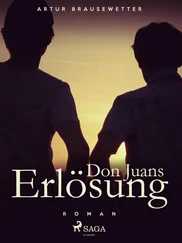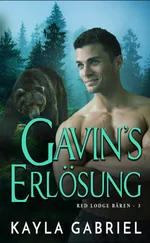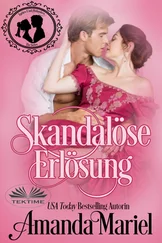Diese revolutionären Führer und Ideologen haben ganz verschiedene, wenn nicht entgegengesetzte politische Ansichten. Ihre Beziehung zum Judentum reicht von totaler und bewußter Assimilation im Namen des Internationalismus bis zu jüdischem Nationalbewußtsein und stolzer Identifikation mit der jüdischen Kultur. Dennoch haben alle eines gemeinsam: Die Ablehnung des Judentums als Religion . Ihre Weltanschauung ist immer rationalistisch, atheistisch, säkular, sie sind Aufklärer und Materialisten. Die Überlieferungen der jüdischen Religion, die Mystik der Kabbala, der Chassidismus, der Messianismus interessieren sie nicht. In ihren Augen sind das nur obskurantistische Überbleibsel der Vergangenheit, reaktionäre, mittelalterliche Ideologien, derer man sich so schnell wie möglich entledigen sollte, um der Wissenschaft und dem Fortschritt zu dienen. Wenn ein jiddischer Schriftsteller mit revolutionärer Gesinnung wie Moische Kulback mit einer Mischung aus Faszination, Angewidertsein und Nostalgie über den Messianismus schreibt, so geschieht dies vor allem, um die traurige Rolle eines falschen Messias wie Jakob Frank zu beleuchten, der seine Anhänger ins Verderben stürzte. 28Eine aus Rußland stammende Anarchistin wie Emma Goldman ist weit entfernt von der mystischen Spiritualität eines Gustav Landauer. Im Denkgebäude ihres libertären Universalismus ist kein Platz für jüdisches Nationalbewußtsein, und die Religion – sei sie nun jüdisch oder christlich – gehört in den Bereich des Aberglaubens. Der erste Besuch in der Synagoge hinterläßt bestenfalls – wie beim Bundisten Medem – einen tiefen Eindruck wegen der großen Schönheit, die den leidenschaftlichen Gefühlen der Menge innewohnt. Der religiöse Sinn des Kultes bleibt ihm fremd. 29Die Begeisterung der jüdischen revolutionären Intellektuellen für den Atheismus und die Wissenschaften zeigt am besten diese Episode: Leo Jogiches, der die ersten Zirkel für jüdische Arbeiter in Wilna organisiert, beginnt seine Aktivitäten als politischer Erzieher mit einer Vorlesung über … Anatomie und bringt seinen Schülern ein echtes Skelett mit … 30
Viele Historiker glauben, die Überzeugungen dieser russischen jüdischen Intellektuellen seien säkularisierter Ausdruck des Messianismus , materialistische und atheistische Manifestation von geistigen Strukturen, die das Erbe einer mehrere tausend Jahre alten religiösen Tradition sind. Dies ist eine Hypothese, die sich in mehreren Fällen als richtig herausstellen kann. Aber für die meisten der erwähnten Marxisten und Anarchisten ist sie unwahrscheinlich, denn nach ihrer Erziehung und ihrem sozialen und familiären Milieu waren sie so assimiliert, so wenig religiös, daß man eine konkrete kulturelle Verbindung mit dem messianischen Erbe vergeblich suchen wird. Jedenfalls enthält ihr Denken im Gegensatz zu dem vieler jüdischer Revolutionäre in Mitteleuropa nicht den geringsten Hinweis auf die Religion und nicht die geringste sichtbare Spur einer messianischen, religiösen Dimension.
Wie läßt sich dieser Unterschied zwischen der Weltanschauung der jüdischen Intelligenz Mitteleuropas und der des Zarenreichs erklären? Die Mehrzahl der jüdischen revolutionären Intellektuellen des Ostens stammt aus aufgeklärten, assimilierten, in religiösen Belangen indifferenten Familien. Einige von ihnen sind in den drei Städten geboren oder aufgewachsen, die die Bastionen der Haskala in Rußland bildeten: Odessa (Martow, Trotzki, Parvus), Wilna (Jogiches), Zamosc Rosa Luxemburg). Vielleicht sollten wir uns zuerst mit den Unterschieden zwischen der Haskala in Deutschland und in Rußland beschäftigen. Unter Haskala versteht man die Öffnung der jüdischen Religion für die rationalistische Philosophie der Aufklärung, wie sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Berlin von dem jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn eingeleitet wurde. Rachel Ertel zeigt in ihrer Untersuchung über das Schtetl , daß die Haskala und die Emanzipation der Juden »in einem westlichen Europa, das sich in Nationalstaaten konstituierte, über eine Konfessionalisierung der jüdischen Religion erfolgte, die diese ihrer nationalen Eigenschaften entkleidete.« Im Gegensatz dazu trug » die Haskala in Osteuropa einen zutiefst nationalen Charakter. Wenn diese Bewegung im Westen die Konfessionalisierung erstrebte, so wollte sie im Osten die Säkularisierung.« 31
Dieser nationale Inhalt der Emanzipation ist sowohl Resultat der Natur des zaristischen Staates – multinational, autoritär und antisemitisch – als auch der Situation der jüdischen Bevölkerung. Ihre Lebensbedingungen weisen alle Merkmale einer typischen Paria-Situation auf: Absonderung, Diskriminierung, Verfolgungen und Pogrome, territoriale Konzentration im Ghetto und im Schtetl , gemeinsame Kultur und gemeinsame Sprache, das Jiddische.
Natürlich haben viele jüdische marxistische Intellektuelle eine Bezugnahme auf jüdische Nationalität und Kultur strikt abgelehnt. Beim Bund und den sozialistischen Zionisten sah das anders aus. Es genügt, sich an die berühmte Antwort Trotzkis auf die Anfrage des Bundisten Medem beim Kongreß der russischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei im Jahre 1903 zu erinnern: »Ich gehe davon aus, daß Sie sich entweder als Russe oder als Jude betrachten?« »Nein«, antwortete Trotzki, »Sie irren sich. Ich bin einzig und allein Sozialdemokrat …«
Die jüdische Identität, ob sie nun akzepiert oder abgelehnt wird, ist zumindest seit den schrecklichen Pogromen im Jahre 1881 eine nationale und kulturelle Identität, nicht mehr eine ausschließlich religiöse. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es im Zarenreich sehr wenig Juden, die sich als »russische Staatsbürger jüdischen Glaubens« betrachten.
Um die atheistische und weltliche Orientierung der revolutionären Intelligenz Osteuropas besser zu verstehen, sollte man ebenfalls den im eigentlichen Sinne religiösen Aspekt der Haskala und seine Konsequenzen etwas genauer untersuchen. In Deutschland ist es der Haskala offensichtlich gelungen, die jüdische Religion »aufzuklären«, zu modernisieren, zu rationalisieren und zu »germanisieren«. Die jüdische Reformbewegung, angeführt von dem Rabbiner Abraham Geiger (1810–1874) und die »historische Schule«, eine etwas gemäßigtere Strömung des Rabbiners Zacharias Frankel (1801–1875), gewannen in den religiösen Institutionen der jüdischen Gemeinden die Oberhand. Sogar die neoorthodoxe Minderheit unter Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808–1888) akzeptierte bestimmte Reformen und Wertvorstellungen der deutschen Säkularisierung.
Dies war in Rußland nicht der Fall: mit Ausnahme einer kleinen Schicht der jüdischen Großbourgeoisie hatten die reformierten Synagogen wenig Anhänger. Die Angriffe, die die Gruppe der Maskilim , der Aufgeklärten, gegen die orthodoxen Dogmen führte, hatte keine andere Konsequenz, als die Traditionalisten in ihrer sturen Haltung zu bestärken. »Vor der Haskala … war das rabbinische Judentum weltzugewandter, toleranter, sensibler für soziale Veränderung. Nach der Haskala wurde der rabbinische Judaismus konservativ, unbeweglich und repressiv; der Chassidismus ist ihm auf diesem Weg gefolgt.« 32
Die jüdische Religion wurde in Deutschland und bis zu einem gewissen Grad in ganz Mitteleuropa reformiert. Sie erwies sich als geschmeidiger und aufgeschlossener solchen äußeren Einflüssen gegenüber, die vom Neukantianismus (Hermann Cohen) oder von der Neuromantik (Martin Buber) an sie herangetragen wurden. Demgegenüber blieb die Welt der religiösen Traditionen im östlichen Teil Europas weitgehend intakt und verschlossen. In unbeugsamer Strenge wurde jede Bereicherung durch eine andere Kultur zurückgewiesen. Dieser quietistische Messianismus des orthodoxen, rabbinischen oder chassidischen Milieus, der der politischen Sphäre nur Gleichgültigkeit entgegenbrachte, konnte zu einer weltlichen Utopie keinerlei Verbindung aufnehmen und lehnte sie wie einen Fremdkörper ab. Man mußte sich erst von dieser Art von Religion emanzipieren, atheistisch werden und »aufgeklärt«, um sich Zugang zu verschaffen zur »veräußerlichten« Welt revolutionärer Ideen. Demnach ist es nicht erstaunlich, daß sich diese vor allem innerhalb jüdischer Ansiedlungsgebiete entwickelten, die von jeder religiösen Praxis weit entfernt waren wie zum Beispiel Odessa, das die Orthodoxen als wahre Fischerspelunke betrachteten.
Читать дальше