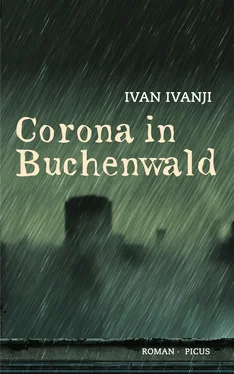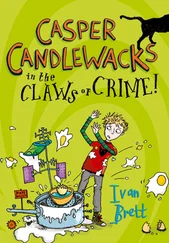»Wir befinden uns jetzt aber in Weimar, Towarisch«, Igor ist es zu langweilig geworden. »Ich schlage vor, wer von uns Geld genug hat, fliegt von hier aus direkt nach Dubrovnik und dort reden wir weiter über die Geschichte der Pest. Willst du einen Vortrag halten? Ich dachte, du hast eine Idee.«
Sascha seufzt: »Richtig. Also, es herrscht die Pest in Florenz, zehn junge Menschen, sieben Mädchen und drei junge Männer, entkommen in ein Landhaus unweit der Stadt. Sie verabreden sich zu einem Spiel: Jeden Tag wird unter ihnen eine Königin oder ein König gewählt, der oder die dann ein Thema vorgibt. Jeder muss dann etwas zu diesem Thema erzählen, das kann über die Pest sein, über Sultane, über Liebschaften. Im Laufe der zehn Tage kommen so hundert Kurzgeschichten zusammen. Es sind sehr junge Menschen, daher überwiegen sexuell freizügige Geschichten, die in der katholisch geprägten Gesellschaft unerhört waren. Von Boccaccio abweichend, auch weil die meisten von uns deutlich älter, selbst unsere jüngsten Begleiter älter sind als diese Leute, schlage ich nicht das Gleiche, aber etwas Ähnliches vor. Wir sind zu zwölft, wenn Franco bald zurückkommt, was ich sehr hoffe, sonst elf, wir wählen für jeden Abend einen von uns, der sein Thema selbst bestimmt und seine Geschichte zum Besten gibt, etwas Wahres über das Überleben in den Lagern, etwas aus seinem eigenen Leben oder etwas Erfundenes, wie er will, Hauptsache, er unterhält uns damit. Was meint ihr? Jeden Nachmittag um fünf?«
»Ich finde das gut«, erklärt Weisz.
Alle Anwesenden klicken auf Zustimmung, als trommelten sie mit den Fäusten auf den Tisch.
DIE URENKELIN EINES GEHENKTEN KRIEGSVERBRECHERS
Wie verabredet beginnt die Frau Doktor ihre täglichen Visiten. Sascha freut sich auf die Abwechslung. Wahrscheinlich geht es den anderen Hotelgästen nicht anders. Hotelgäste? Oder zur neuen Freiheitsstrafe verurteilte Buchenwaldhäftlinge?
Die Handgriffe der jungen Ärztin, natürlich mit Maske und Handschuhen, sind sicher, die Stimme freundlich.
»Sie machen das ausgezeichnet, Frau Doktor«, sagt Sascha. »Sie scheinen so jung, seit wann praktizieren Sie?«
»Zugegeben, erst seit zwei Jahren. Vielleicht ist es eine Talentfrage, oder einfach nur mein großes Interesse, obwohl ich die erste Medizinerin in der Familie bin.«
Offensichtlich ist sie bereit, sich auf ein längeres Gespräch einzulassen, sie scheint nicht in Eile.
»Wollen Sie nicht Platz nehmen? Mir fällt es schwer, lange zu stehen.«
»Mir macht es nichts aus, stehen zu bleiben. Aber setzen Sie sich doch. «
»Ich kann nicht sitzen, wenn eine Dame steht. Erziehungssache, das steckt mir in den Knochen.«
Gerda Meier lacht und nimmt in einem bequemen Sessel Platz. »Bitte, was wollten Sie fragen?«
»Wie geht es Franco?«
»Er ist leider viruspositiv und hat eine doppelseitige Lungenentzündung, er muss künstlich beatmet werden, aber im Großen und Ganzen ist er stabil, das heißt in keiner unmittelbaren Lebensgefahr.«
»Das haben Sie sicher seiner Enkelin mitgeteilt?«
»Natürlich.«
»Ich habe noch eine ganz andere Frage, Frau Doktor. Haben Sie sich freiwillig gemeldet, für uns zur Verfügung zu stehen? Sie konnten ja nicht wissen, dass einer von uns Träger des Virus ist. Und Sie sind auch noch zu uns ins Hotel gezogen. Haben Sie keine Familie, der Sie abgehen?«
Die junge Frau streckt die Beine aus. Sie hat lange, wahrscheinlich hübsche Beine, soweit es ihre Jeans erkennen lassen.
»Bitte nicht so förmlich, sagen Sie Gerda zu mir …«
»Unter der Bedingung, dass Sie Sascha zu mir sagen.«
Sie lacht wieder. Das ist kein Kichern, nichts Falsches, es klingt nicht belustigt, eher fröhlich, offen.
»Das wird für mich schwieriger. Nicht nur wegen des Altersunterschieds, auch wegen Ihres Schicksals. Ja, aber um auf die Frage zu antworten. Ich habe niemanden in Weimar, zwar stamme ich aus einer Großfamilie, aber meine Eltern leben in Hannover, meine Geschwister, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins in der ganzen Bundesrepublik verstreut. Aber ich habe mit keinem Kontakt, ich bin das schwarze Schaf … Oder eigentlich sind sie alle schwarze Schafe, ich bin das einzige weiße Lamm. Also ja, ich habe mich freiwillig gemeldet, weil ich eine Lebensaufgabe …« Sie verheddert sich, weiß augenscheinlich nicht, wie sie diesen Satz weiterführen könnte, und sagt nach einer kurzen Pause mit veränderter, jetzt härterer Stimme: »Ich bin sehr froh, dass mir das vergönnt ist.«
»Möchten Sie mir das erklären, Gerda?«
»Ich will es versuchen. Es wird für mich ein wenig peinlich werden, aber vielleicht ist es gut, wenn ich es vor jemandem wie Ihnen ausspreche. Vielleicht hilft es mir.«
»Sie können mir vertrauen. Mein Beruf ist es zwar zu schreiben, über Menschen zu schreiben, ich bin kein Arzt oder Psychotherapeut und schon gar kein Rechtsanwalt, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, aber ich habe auch meinen Freud gelesen. Und ich bin absolut diskret.«
»Gut. Dann kann ich mit Ihnen also reden, als ob Sie Professor Freud wären«, die junge Frau lehnt sich schmunzelnd zurück. »Als Kinder lebten wir in einem Bauernhaus in Hemmingen, mit den Großeltern, den älteren Brüdern, sogar meine Urgroßmutter hat meine Geburt noch erlebt, an sie kann ich mich freilich nicht erinnern. Als einziges Familienbild im Speisezimmer, dem einzigen Raum, den wir gemeinsam benützten, hing in vergoldetem Rahmen die vergrößerte Fotografie eines hübschen blonden jungen Mannes. Auf meine Frage, wer das sei, sagte Oma, es sei mein Urgroßvater. Unter einem Urgroßvater stellt man sich natürlich keinen Jüngling vor, ich fragte also, ob es denn keine Fotos aus späteren Zeiten gebe. Die gebe es schon, sagte Oma, aber sie liebe nun einmal dieses, so wolle sie sich an ihren Vater erinnern. Auf meine weitere Frage, wann er gestorben sei, erklärte sie ausführlich, er sei im Krieg gefallen, er sei ein guter Deutscher gewesen, habe auch das Ritterkreuz erhalten und sei sogar einmal dem Führer vorgestellt worden. Ich war ein Kind und nahm das so zur Kenntnis, erst viel später erinnerte ich mich, auf welch ehrfurchtsvolle Weise sie das Wort ›Führer‹ ausgesprochen hatte, aber ich bohrte damals nicht nach. Oma starb, als ich schon ins Gymnasium in Hannover ging. Am Abend nach ihrem Begräbnis ging ich in ihr Zimmer, wollte sehen, ob ich irgendetwas zur Erinnerung an sie finden und mitnehmen könnte. Ich habe sie sehr geliebt, wie man eben eine Großmutter liebt, wenn die viel beschäftigte Mutter nie genug Zeit hat. Oma erzählte ich meine ersten kleinen Liebesgeschichten und sie hörte mit viel Geduld zu. Auf dem Toilettentisch, so einem schönen, altmodischen Möbelstück, lag ein Pappkarton. Den habe ich neugierig aufgemacht. Ganz oben lagen einige Orden, darunter Fotos eines SS-Offiziers, auch Gruppenfotos mit Offizieren, die mit Hitler und Himmler zusammenstanden. Ich rannte mit einem der Bilder in die Küche, wo meine Mutter gerade das Abendessen vorbereite, und fragte, ob das mein Urgroßvater sei. Ja, sagte sie. Warum habe man mir nie diese Fotos gezeigt, nie gesagt, dass er bei dieser Bande gewesen ist? Das sei keine Bande gewesen, belehrte mich meine Mutter streng, das seien die besten Soldaten gewesen, die das Volk und das Reich beschützten. Ich könne stolz auf meinen Urgroßvater sein. Dann stotterte sie ein wenig herum, man hätte mich nicht verwirren wollen, sie habe vorgehabt, mich nach meinem Abitur aufzuklären. Aufklären? Was für eine Wortwahl! Weiß es Papa? Selbstverständlich. Und die Brüder? Aber ja. Und ihr seid alle stolz auf ihn? Wieso nicht? Ich soll also stolz auf diesem SS-Mann sein? Freilich, wenn du ein gutes deutsches Mädel sein willst, sagte sie. Das will ich nicht, schrie ich, rannte in mein Zimmer, zerriss dort das Bild in Fetzen und warf es schließlich ins Klo. Aber ich blieb im Haus wohnen, wo sollte ich damals hin? Ich bewarb mich für das Medizinstudium in Hannover, zog hin und versuchte herauszufinden, wer mein Urgroßvater gewesen war, wo er gedient hat. Das war gar nicht so schwer, weil er ja Ritterkreuzträger war. Er ist nicht an der Front gefallen. Er war Lagerkommandant eines KZ, ist kurz nach dem Krieg zum Tode verurteilt und gehenkt worden … Mein Urgroßvater!« Sie macht eine ziemlich lange Pause, ihre Fröhlichkeit ist verschwunden. Ist es Verzweiflung, die sich auf ihrem Gesicht spiegelt? Sascha ringt nach Worten. »Können Sie das verstehen? Nein, das kann niemand verstehen, aber deshalb wollte ich für Sie arbeiten hier, deshalb!« Sie weint.
Читать дальше