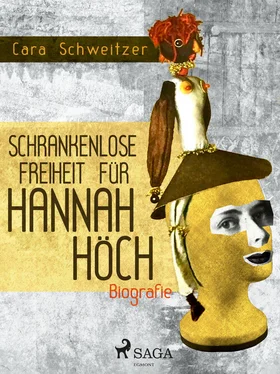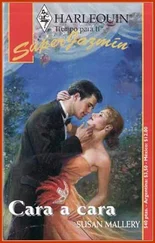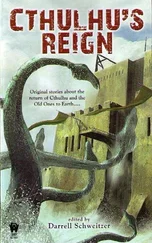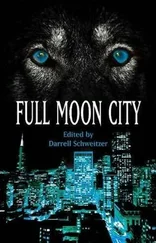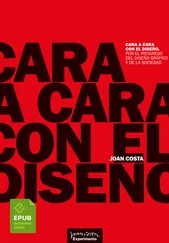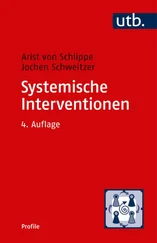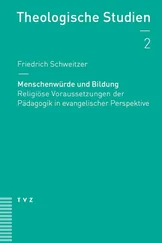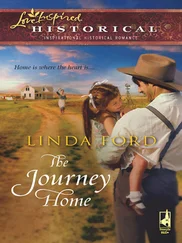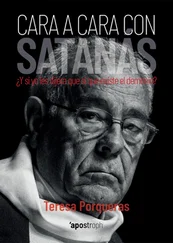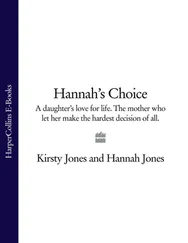Das utopische und revolutionäre Moment in seinen Texten macht Gross zum Therapeuten der DADA-Bewegung. Seine scharfe Kritik an den gegebenen Gesellschaftsstrukturen, die auch eine Erklärung für die brutale Gewalt des Ersten Weltkriegs lieferte, stieß insbesondere in linken und sozialkritischen Kreisen auf offene Ohren, die auf Veränderungen hofften. Vor allem die Mitglieder des Berliner DADA-Kreises, der sich ein Jahr später zusammenfand, allen voran Raoul Hausmann, festigten mit Hilfe seiner Schriften ihre gesellschaftskritische Position. Gross’ Texte gaben entscheidende Impulse für die Aktionen von DADA: »Ohne die psychoanalytische und zwischenmenschliche Umgestaltung der Gemeinschaftsbeziehungen, die in der Freien Straße ausgeübt und vorbereitete worden war, hätte die Berliner Dada-Bewegung nicht gleich beim ersten Auftreten eine Steigerung und Klärung des beinahe natürlichen Provokationsstoffes auf allen intellektuellen Gebieten ergeben können«, äußerte Hausmann rückblickend. 59
Doch zunächst dient Gross Raoul Hausmann dazu, die Spannungen zwischen ihm und Hannah Höch auf seine Weise zu analysieren. Seine Kritik an ihrer Familie ist den Gross’schen Texten entlehnt. Hausmanns Briefe, die um die Konflikte nach dem Schwangerschaftsabbruch kreisen, sind geprägt von einer erzieherischen Haltung gegenüber Hannah Höch. Die Germanistin Silke Wagener konnte zeigen, dass er mit seinem pädagogischen Anspruch einem traditionellen Geschlechterverständnis folgt und damit genau das Gegenteil von dem unternahm, was er der Künstlerin gegenüber vorgab. 60Hausmann führte, so Silke Wageners Analyse, die Tradition der klassischen Brautbriefe fort, mit denen ein Ehemann die ihm Anvertraute in unterschiedlichen Themen unterwies. 61Ziel der Erziehungsmaßnahmen war es, Hannah Höch dazu zu bringen, ihren Wunsch nach einer monogamen Beziehung mit ihm aufzugeben und ein gemeinsames Kind auch dann zuzulassen, wenn er sich nicht zuvor von seiner Ehefrau trenne. Ihre Entscheidung gegen ein Kind von Hausmann löst bei ihm eine Verletzung aus, die ihm seine Grenzen aufwies, über Hannah Höchs Körper zu entscheiden, »weil Du mein Anrecht auf Dein Kind wie überhaupt meine Anrechte auf die sich aus unserer körperlichen Gemeinsamkeit ergebenden Beziehungen ablehnst; nicht mit-fühlst [...]«, schreibt er ihr noch ein Jahr nach der Abtreibung. 62
1918 wird sie sich ein zweites Mal für eine Abtreibung entscheiden. Künstlerin und gleichzeitig Mutter eines Kindes zu sein, dessen Vater mit zwei Partnerinnen lebt, konnte sich Hannah Höch nicht vorstellen. Er dagegen versucht, ihr sein Konzept einer Beziehung mit zwei von einander unabhängigen Frauen als Philosophie der Befreiung und Emanzipation nahezubringen, in der die Frau ohne gesellschaftliche Konventionen endlich ihrem reinen »Mutterschaftstriebe« folgen könne. Hannah Höchs Entscheidung, das mit ihm gezeugte Kind nicht zu bekommen, legt er ihr im Sinne von Otto Gross als »Unterdrückung des Mutterschaftstriebes« und »Proteststellung« gegen ihn als Mann aus. Ihre erneute Ablehnung eines Kindes, seines von ihm sehnsüchtig erwarteten »himmelblauen Sohns«, wie er ihn in dem 1917 verfassten Gedicht »Mein Sohn Himmelblau« taufte 63, zeugte in Hausmanns Interpretation von Hannah Höchs Negation ihrer »eigenen Weiblichkeit«. 64
Hausmanns Briefe, die Hannah Höch in ihrem Nachlass aufbewahrte, zeigen, wie über die gesamte Dauer ihrer Beziehung die Auseinandersetzungen immer wieder um das gleiche Problemfeld kreisen. Wie in einer Spirale schrauben sich seine Anforderungen an die Partnerin und die an sie gerichteten Vorwürfe hoch. Teilweise eskalieren die Kämpfe zwischen beiden so sehr, dass es zu physischer Gewaltanwendung kommt. Sie reagiert mit Distanzierung und vorübergehender Trennung. Erst in diesen Situationen legt Hausmann die Gross’schen Theorien beiseite und wechselt zu reumütiger Selbstanklage.
Für Hannah Höch werden seine andauernden Vorwürfe und Erziehungsmaßnahmen immer mehr zur Strapaze, auf die sie wiederholt mit Kontaktabbruch reagiert. Sie flüchtet sich zu ihrer Familie nach Gotha oder zu ihrem Bruder Danilo, der auch in Berlin lebt. Bei Hausmann löst ihr Verhalten ein noch massiveres Drängen aus. Er versucht, sie wieder zurückzuerobern. Auf diese Weise wird das neurotisch aufgeladene Beziehungsgefüge der beiden kaum durchbrochen. 65
Hausmann schreckt nicht davor zurück, bei Hannah Höchs Arbeitskollegin, die in das Beziehungsdrama eingeweiht ist, Erkundigungen einzuholen, wo sie sich vor ihm versteckt hält. Trotz des erheblichen Drucks, den Hausmann ausübt, der bisweilen auch bei ihm einen selbstzerstörerischen Charakter annehmen kann, eignet sich Hannah Höch seine Vorwürfe nicht an. Ihre Distanz zu seinen theoretisch untermauerten Anklagen äußert sich etwa darin, dass sie in ihren Antwortschreiben die von Hausmann benutzte Gross’sche Terminologie in Anführungszeichen setzt. 66In einem in ihrem Nachlass erhaltenen Briefentwurf, den sie im Sommer 1918 in einer erneuten Phase heftigen Streits an Hausmann verfasst, schreibt sie: »... ich weiß wie ich Dich über alle Stürme hinweg lieben könnte – unbeschwert, längst frei von Grenzen die ich aus der ›Familienatmosphäre heraus als Leitlinie gestaltet habe‹ – so aber kann ich nie etwas für Dich tun weil ich nie zu Dir selbst gelangen kann weil ich überall an Schranken, Irrwege, Hinterhälte stoßen muß, die mich böse machen; [...].« 67
Die Krisen des Künstlerpaares Höch/Hausmann sind vor allem in seinen Briefen an die Künstlerin dokumentiert. Sie bewahrte sie auf. Ihre Reaktionen können nur noch erahnt werden und lassen sich vor allem aus seiner Perspektive schließen. Eine Ursache hierfür mag sein, dass Hausmann ihre Briefe nicht der Öffentlichkeit überlassen wollte. Trotz des ständigen Konfliktszenarios, das für beide kraftzehrend ist, finden Hannah Höch und Raoul Hausmann über sieben Jahre hinweg immer wieder zueinander. Ihre Beziehung fällt für beide in eine Zeit, in der sie sich künstlerisch positionieren. Für die kunsthistorische und kulturgeschichtliche Forschung sind die privaten Zeugnisse ihrer Beziehung deswegen so interessant, weil sie ihre persönliche Auseinandersetzung selbst als paradigmatisch für die gesellschaftlichen Umbrüche und den Wandel der Geschlechterrollen während und kurz nach dem Ersten Weltkrieg betrachteten. Exemplarisch hierfür ist insbesondere Hausmanns Rezeption der Theorien von Otto Gross. Ihre Liebe wird gewissermaßen zur gesellschaftspolitischen Handlung. Wie in der Kunst strebten Höch und Hausmann in ihren privaten Verhältnissen nach Erneuerung.
Im Winter 1916/17 sind die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auch in der Zivilbevölkerung zu spüren. Obwohl die Kriegshandlungen kaum auf deutschem Gebiet ausgetragen werden, kommt es in der Folge fehlerhafter logistischer Planung zu Hungersnöten. Die schlechte Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln ist auch in Hannah Höchs Briefen an die Familie dokumentiert. »Man wird jetzt buchstäblich zum Vegetarier ausgebildet«, schreibt sie etwa an ihre Schwester Grete. 68Doch im Verhältnis zu weiten Teilen der Bevölkerung scheint es Hannah Höch und Raoul Hausmann noch recht gut zu gehen. Dafür verantwortlich mag vor allem die Unterstützung durch Höchs Familie aus dem eigenen Garten in Gotha sein: »Gestern ist auch meine Appelkiste gekommen, ich hatte schon Angst, sie sei beschlagnahmt worden«, berichtet sie erneut Grete. 69Hausmann kommentiert die Situation mit dem ihm eigenen bissigen Zynismus: »Aber es gab gar nichts zu essen auch Abends 9 ½ in Potsdam nichts, dann nur teuer in einem ›großen‹ Restaurant. Wir haben geschimpft«, erzählt er Hannah Höch in einem Brief über einen Ausflug ins Berliner Umland. Und weiter heißt es: »Wie ich durchkomme? Na. Es kostet eben Geld. Manchmal esse ich den ganzen Tag für 1 Mark, aber das ist auch danach. Mein billigstes Abendbrot kostet mal 50, mal 60 Pfg. Meine Fleischkarte esse ich in der Stadt ab, da giebt es für 100 Gramm ungefähr 200. – Hab’ keine Angst, daß ich schlemme – aber etwas essen muß ich doch schon. Manches koche ich mir selbst.« 70Was sich in Hausmanns Briefen aus dem Spätsommer 1916 noch recht humorvoll anhört, sollte im sogenannten »Kohlrübenwinter« von 1916/1917 zur tödlichen Bedrohung für weite Bevölkerungsteile werden. Nicht nur in Deutschland, sondern bei allen kriegsführenden Parteien herrschte spätestens seit dem Winter 1915 Hunger. 71In Deutschland wurde ein Kriegsbrot eingeführt, das zu großen Teilen aus minderwertigem Kartoffelmehl bestand. Kinderärzte empörten sich über den von der Regierung als Säuglingsnahrung empfohlenen Malzbrei; der würde »jedes Tier entsprechenden Alters in kürzester Zeit zur Strecke bringen«. 72Stück für Stück wurden alle Bereiche der Lebensmittelproduktion und -verteilung staatlich kontrolliert: Getreideprodukte, Milch, die Kartoffelbewirtschaftung sowie Fleisch- und Wurstwaren. Die Kartoffelernte brachte im Winter 1916/17 nur 50 Prozent des durchschnittlichen Ertrags ein. 73Als Ersatz für die ausgebliebene Ernte teilte man der Bevölkerung Kohl- bzw. Steckrüben zu. Auf Grund der schlechten Getreideernte des folgenden Jahres, Zug- und Arbeitstiere, sowie landwirtschaftliche Arbeitskräfte waren eingezogen, sank die auf Lebensmittelkarten zugeteilte Durchschnittsration für die Bevölkerung auf 1000 Kalorien. Das war mehr als die Hälfte weniger als der vom Reichsgesundheitsamt ermittelte notwendige tägliche Kalorienbedarf. 74In den Städten, allen voran in Berlin, kam es zu heftigen Auseinandersetzungen und zu Demonstrationen gegen die staatlich sanktionierte Ernährungspolitik. Von der einstigen Kriegsbegeisterung war nun in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht mehr viel übrig geblieben. In den Kriegsjahren 1914–1918 sollten über 750000 Menschen in Deutschland an Hunger sterben. 75Die Hungersnöte in Europa, in der Folge des Ersten Weltkriegs, haben auch Einfluss auf die immer stärker politisch werdende Haltung von Raoul Hausmann. Ende Mai 1917 schreibt er an Hannah Höch, die über Pfingsten bei ihrer Familie in Gotha weilt: »Mir geht es seit Pfingstmontag schlecht, ich kann das Brot nicht mehr vertragen, hatte fortwährend Durchfall, und musste heute erbrechen. Nach der Zeitung gibt es in ›England‹ Todesfälle an Brot durch Entzündung innerer Organe.« 76
Читать дальше