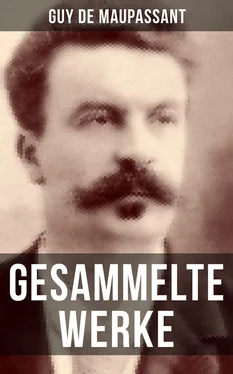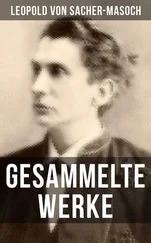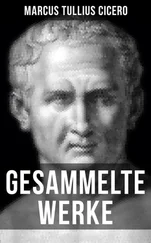Sie aßen Ragout, ein Stück Hammelkeule und Salat. Clotilde meinte:
– Ach ich habe das zu gern, ich habe eigentlich einen plebejischen Geschmack! Mir gefällt’s hier besser als im Café Anglais.
Dann sagte sie:
– Wenn Du mich ganz glücklich machen willst, so nimm mich jetzt auf den Tanzboden mit. Ich kenne ein sehr spaßiges Lokal ganz nah von hier, es heißt: »Zur weißen Königin.«
Duroy fragte erstaunt:
– Wer hat Dich denn dorthin gebracht?
Er sah sie an, gewahrte, wie sie rot ward, ein wenig verlegen, als ob die plötzliche Frage eine zarte Erinnerung in ihr wach gerufen. Sie zögerte nur einen Augenblick, wie es Frauen manchmal thun, so kurz, daß man es kaum merkt und antwortete:
– Ein Freund.
Dann machte sie eine Pause und fügte hinzu:
– Er ist tot.
Sie schlug mit natürlichem Ausdruck der Trauer die Augen nieder.
Und Duroy dachte zum ersten Mal an all das, was er aus dem vergangenen Leben dieser Frau nicht wußte, und sann nach. Sie hatte gewiß schon Liebhaber gehabt. Aber welche? Aus welcher Gesellschaftsschicht? Und eine unbestimmte Eifersucht, eine Art Feindschaft stieg in ihm empor, gegen sie, gegen alles, was er nicht wußte, gegen alles, was ihm von diesem Herzen und diesem Menschendasein nicht gehörte. Er sah sie an; das Geheimnis dieses stummen, hübschen Köpfchens, das vielleicht in diesem Augenblick an den anderen, an die andern mit Bedauern dachte, quälte ihn. Ach, er wäre zu gerne in ihre Vergangenheit eingedrungen, um darin zu wühlen, alles zu erfahren, alles zu wissen!
Sie sagte noch einmal:
– Willst Du mit mir in die »Weiße Königin« gehen? Das wird ein richtiges Vergnügen!
Er dachte: ach was geht mich die Vergangenheit an. Ich bin schön dumm, mich darum zu kümmern. Und lächelnd antwortete er:
– Aber gewiß, liebes Kind.
Als sie auf der Straße standen, fing sie wieder ganz leise mit jenem geheimnisvollen Ton an, in dem man Geständnisse macht:
– Ich habe bis jetzt nicht gewagt, Dich darum zu bitten, aber Du weißt gar nicht, wie gern ich tolle Jungenstreiche mache und dorthin gehe, wo man als anständige Frau nicht hingehen kann. Weißt Du, wenn erst Karneval ist, verkleide ich mich als Student. Ich sage Dir, als Student bin ich furchtbar komisch!
Als sie den Ballsaal betraten, schmiegte sie sich an ihn, etwas ängstlich, aber doch zufrieden, und betrachtete mit Entzücken die Mädchen und Zuhälter, und ab und zu sagte sie wie wenn sie sich gegen eine mögliche Gefahr schützen wollte, indem sie auf einen ernst und unbeweglich dastehenden Polizisten deutete:
– Der Schutzmann da sieht aber stramm aus.
Nach einer Viertelstunde hatte sie genug und er brachte sie nach Hause.
Von da an unternahmen sie Ausflüge in alle möglichen verdächtigen Lokale, wo sich das Volk amüsiert. Und Duroy entdeckte bei seiner Geliebten eine unglaubliche Leidenschaft für diese fidelen Bummelreisen.
Sie kam zu ihrem gewöhnlichen Stelldichein, im Waschkleide, ein Zofenmützchen auf dem Kopf; aber trotz der zierlichen und gesuchten Einfachheit ihres Anzuges behielt sie Fingerringe, Armbänder und Brillant-Ohrringe, und wenn er sie anflehte, sie abzulegen, sagte sie:
– Ach was, man wird sie doch für Glas halten.
Sie glaubte, sie wäre vorzüglich verkleidet, obgleich sie in Wirklichkeit sich nur wie der Vogel Strauß versteckt hatte. So gingen sie in die anrüchigsten Lokale.
Sie wollte durchaus, daß Duroy sich als Arbeiter anziehen sollte, aber er wehrte sich dagegen und behielt seinen gewöhnlichen Boulevardanzug, er wollte sogar nicht einmal statt des Cylinders einen weichen Filzhut aufsetzen.
Sie tröstete sich über seine Weigerung indem sie sich sagte: man denkt eben, ich bin ein Dienstmädchen, das Glück gehabt hat mit einem Herrn aus der Gesellschaft. Und sie fand diese Komödie köstlich.
So gingen sie in allerhand gewöhnliche Kneipen, setzten sich in verräucherte dunkle Löcher, auf wackelige Stühle an einen alten Holztisch. Eine dichte Rauchwolke, in der noch vom Mittag her der Geruch von gebackenen Fischen schwebte, lagerte über dem Lokal. Blousenmänner saßen da vor ihrem Glas und gröhlten. Und der Kellner blickte ganz erstaunt das seltsame Paar an, als er den Kirschschnaps vor sie hinstellte.
Zitternd vor Furcht und Entzücken nippte sie den roten Saft mit kleinen Schlückchen und blickte ängstlich und aufgeregt um sich. Jeder Schnaps, den sie trank, kam ihr wie ein Verbrechen vor, jeder Tropfen der brennenden gepfefferten Flüssigkeit, der ihr die Kehle hinabrann, machte ihr unendliches Vergnügen, die Freude am sündhaften Genuß der ververbotenen Frucht.
Endlich sagte sie halblaut:
– Wir wollen gehen.
Und sie gingen. Sie lief schnell, mit gesenktem Kopf und kleinen Schritten wie eine Schauspielerin, die die Bühne verläßt, und ging so zwischen den Zechern hindurch, die, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, ihr mit argwöhnischen, unzufriedenen Blicken nachschauten. Und wenn sie dann draußen stand, seufzte sie erleichtert auf, als ob sie einer furchtbaren Gefahr entronnen wäre. Manchmal fragte sie zitternd Duroy:
– Was würdest Du thun, wenn man mich hier beleidigte?
Er antwortete in renommistischem Ton:
– Nu Donnerwetter, ich würde Dich verteidigen!
Und glückselig preßte sie seinen Arm, vielleicht mit dem unbestimmten Wunsch, angegriffen und von ihm verteidigt zu werden, mit dem Wunsch, zu erleben, wie die Männer sich ihretwegen schlügen – sogar solche Kerle mit ihrem Geliebten.
Aber als diese Ausflüge zwei, sogar drei Mal in der Woche einander folgten, wurden sie Duroy lästig, der nebenbei seit einiger Zeit noch große Not hatte, sich auch nur die zehn Franken zu verschaffen, die jedesmal Wagen und Getränke kosteten.
Er hatte es jetzt sehr sauer, es wurde ihm schwerer auszukommen als zu der Zeit, wo er Eisenbahnbeamter gewesen. Da er während der ersten Monate seines Journalistentums ohne zu rechnen darauf los gewirtschaftet hatte, immer in der Hoffnung am nächsten Tage viel Geld zu verdienen, hatte er nun alle Möglichkeiten sich Geld zu verschaffen und alle Hülfsquellen erschöpft.
Das einfache Mittel, sich an der Kasse Vorschuß geben zu lassen, war schnell verbraucht. Er hatte bei der Zeitung sein Gehalt schon vier Monate im voraus erhoben, dazu sechshundert Franken Zeilenhonorar. Dann war er noch Forestier hundert Franken schuldig, Jacques Rival, der sehr freigebig war, dreihundert Franken, und eine Menge kleiner Schulden, die er sich gar nicht einzugestehen wagte, nagten an ihm, von zwanzig Franken bis herab zu hundert Sous.
Er hatte Saint-Potin gefragt, wie er es anstellen könnte, noch hundert Franken aufzutreiben. Aber obgleich jener ein erfindungsreicher Kopf war, wußte er kein Mittel. Und Duroy war außer sich über dieses Elend, das er stärker empfand als früher, weil er mehr Bedürfnisse hatte. Eine stille Wut gegen alle Welt kochte in ihm. Und seine unausgesetzte Erregung entlud sich bei jeder Gelegenheit, in jedem Augenblick, wegen der unbedeutendsten Dinge.
Manchmal fragte er sich, wie er es nur fertig gebracht, im Durchschnitt tausend Franken monatlich zu verbrauchen, ohne irgend welche Ausschweifung oder besondere Ausgabe. Und er stellte bei sich fest, daß allerdings, wenn man ein Frühstück für acht Franken mit einem Diner zu zwölf Franken, das er irgendwo in einem großen Restaurant auf dem Boulevard eingenommen, zusammenzählte, schon ein Zwanzigfrankenstück herauskam; zählte man dann bloß noch zehn Franken Taschengeld dazu, was sich so verkrümelt, wirklich ohne daß man weiß, wo es bleibt, so gab das schon dreißig Franken. Und dreißig Franken täglich wiederum ergaben am Monatschluß neunhundert Franken und dabei war noch nicht einmal Kleidung, Wäsche, Schuhmacher eingerechnet.
So hatte er also am vierzehnten Dezember nichts mehr in der Tasche und sah keine Möglichkeit, Geld aufzutreiben.
Читать дальше