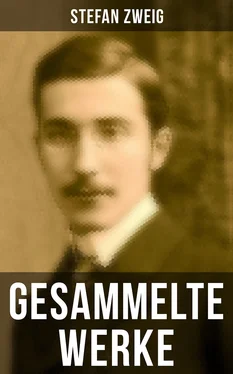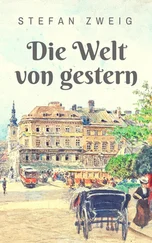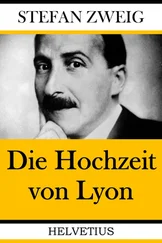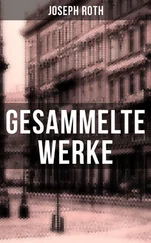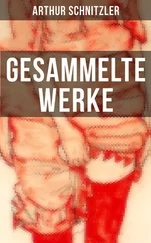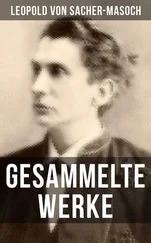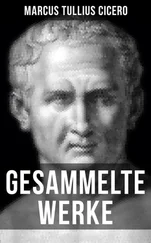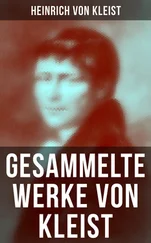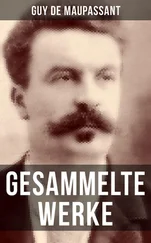Ein Heiliger: das Wort ist ausgesprochen, aller lächelnden Ironie zu Trotz. Denn gewiß scheint zunächst der Heilige in unserer ernüchterten Zeit vollkommen absurd und unmöglich, ein Anachronismus verschollenen Mittelalters. Aber nur die Embleme und die kultische Umschalung eines jeden seelischen Typs unterliegen der Vergängnis; jeder Typus selbst kehrt folgerichtig und zwanghaft immer wieder zurück in jenem unabsehbaren Spiel der Analogien, das wir Geschichte nennen. Immer und in jeder Epoche werden Menschen ein heiliges Dasein versuchen müssen, weil das religiöse Gefühl der Menschheit diese höchste Seelenform immer wieder neu benötigt und erschafft; nur wird ihre Vollführung sich äußerlich wandeln müssen am Wandel der Zeit. Unser Begriff von der Durchheiligung des Daseins kraft geistiger Inbrunst hat nichts mehr zu tun mit den holzschnitthaften Figuren der Legenda aurea und der Säulenstarre der Wüstenväter, denn wir haben die Gestalt des Heiligen längst abgelöst von dem Spruch theologischer Konzile und päpstlicher Konklaven – »heilig« bedeutet für uns heute einzig heroisch im Sinne der vollkommenen Hingabe des Daseins an eine religiös durchlebte Idee. Nicht um einen Zollstrich dünkt uns die intellektuelle Ekstase, die weltverleugnende Einsamkeit des Gott-Töters von Sils-Maria oder die erschütternde Bedürfnislosigkeit des Diamantschleifers von Amsterdam geringer, als die Ekstase eines fanatischen Dornengeißlers; selbst jenseits alles Wundertums, bei Schreibmaschine und elektrischem Licht, mitten in unseren querschnittigen, helligkeitserfüllten, menschendurchfluteten Städten ist der Geistheilige als der Blutzeuge des Gewissens auch heute noch möglich; nur tut es uns nicht mehr not, diese Wunderbaren und Seltenen als göttlich Unfehlbare und irdisch Unanfechtbare zu betrachten, sondern im Gegenteil: wir lieben diese großartigen Versucher, diese gefährlich Versuchten gerade in ihren Krisen und Kämpfen und am tiefsten nicht trotz, sondern eben in ihrer Fehlbarkeit. Denn unser Geschlecht will seine Heiligen nicht mehr als Gottesgesandte eines überirdischen Jenseits verehren, sondern gerade als die allerirdischsten unter den Menschen.
Darum ergreift bei dem ungeheuren Versuche Tolstois um die vorbildliche Form seines Lebens uns gerade am meisten sein Schwanken, und daß er in letzter Erfüllung menschlich versagt, scheint uns erschütternder, als sein Heiligsein uns gewesen wäre. Hic incipit tragoedia! Im Augenblicke, da Tolstoi die heroische Aufgabe unternimmt, aus den zeitlich konventionellen Lebensformen herauszutreten und nur die zeitlosen seines Gewissens zu verwirklichen, wird sein Leben notwendigerweise tragisches Schauspiel, größer als irgendeines, das wir seit Friedrich Nietzsches Empörung und Untergang gesehen. Denn eine solche gewaltsame Ablösung aus allen eingewachsenen Beziehungen der Familie, der Adelswelt, des Eigentums, der Zeitgesetze kann nie geschehen, ohne ein tausendgliedriges Nervengeflecht zu zerfetzen, ohne sich selbst und seine Nächsten auf das schmerzhafteste zu verwunden. Aber Tolstoi fürchtet keineswegs den Schmerz, im Gegenteil sogar, als echter Russe und darum Extremist dürstet er geradezu nach wirklicher Qual als dem sichtlichen Beweis seiner Wahrhaftigkeit. Er ist längst müde der Gemächlichkeit seines Daseins; das flache Familienglück, der Ruhm seiner Werke, die Ehrfurcht seiner Mitmenschen ekeln ihn an – unbewußt sehnt sich der schöpferische Mensch in ihm nach gespannterem vielfältigerem Schicksal, nach einer tieferen Vermischung mit den Urkräften der Menschheit, nach Armut, Not und dem Leiden, dessen schöpferischen Sinn er seit seiner Krise zum erstenmal erkennt. Er möchte, um die Reinheit seiner Demutslehre apostolisch zu bezeugen, das Leben des niedrigsten Menschen führen, ohne Haus, ohne Geld, ohne Familie, beschmutzt, verlaust, verachtet, vom Staat verfolgt, von der Kirche verstoßen. Er möchte im eigenen Fleisch und Bein und Hirn erleben, was er als die wichtigste und einzige seelenträchtige Form eines wahren Menschen in seinen Büchern geschildert: den Heimatlosen, Besitzlosen, den der Wind des Schicksals wie ein Herbstblatt vor sich hinjagt. Tolstoi verlangt – und hier baut die große Künstlerin Geschichte wieder eine ihrer genialen und ironischen Antithesen – aus innerstem Willen eigentlich genau nach dem Schicksal, das seinem Gegenspieler Dostojewski, diesem aber wider seinen Willen, verhängt gewesen. Denn Dostojewski erlebt alles an offensichtlichem Leiden, an Grausamkeit und Haß des Geschicks, was Tolstoi aus pädagogischem Prinzip, aus Märtyrergier gewaltsam erleben möchte. Dostojewski klebt die echte, quälende, brennende, freudenaussaugende Armut wie ein Nessushemd an, als Heimatloser schleppt er sich über alle Länder der Erde, Krankheit zerspellt seinen Körper, die Soldaten des Zaren binden ihn an den Todespfahl und werfen ihn in die Gefängnisse Sibiriens – alles, was Tolstoi zur Demonstration seiner Lehre als Märtyrer dieser Lehre durchaus erleben möchte, das ist jenem verschwenderisch zugeteilt, indes dem nach äußern, sichtbaren Leiden dürstenden Tolstoi nicht ein Tropfen Verfolgung und Armut zufällt.
Denn keine weltüberzeugende Bestätigung und Sichtbarmachung seines Leidenswillens will jemals Tolstoi gelingen. Überall sperrt ihm ein höhnisches und ironisches Schicksal den Weg zum Märtyrertum. Er möchte arm sein, sein Vermögen an die Menschheit schenken, nie mehr Geld aus seinen Schriften und Werken ziehen, aber seine Familie erlaubt ihm nicht, arm zu sein; wider seinen Willen wächst das große Vermögen ständig in seiner Hausgenossen Hand. Er möchte einsam sein; aber der Ruhm überflutet sein Haus mit Reportern und Neugierigen. Er möchte verachtet sein, aber je mehr er sich selber beschimpft und erniedrigt, je gehässiger er sein eigenes Werk herabsetzt und seine Aufrichtigkeit verdächtigt, um so ehrfürchtiger hängen die Menschen ihm an. Er möchte das Leben eines Bauern führen, in niederen rauchigen Hütten, unbekannt und ungestört, oder als Pilger und Bettler über die Straßen irren, aber die Familie umhüllt ihn mit Pflege und schiebt zu seiner Qual alle Bequemlichkeiten der Technik, die er öffentlich mißbilligt, bis in sein Zimmer hinein. Er möchte verfolgt sein, eingesperrt und geknutet – »es ist mir peinlich, in Freiheit zu leben« –, aber mit Sammetpfötchen weichen die Behörden ihm aus und begnügen sich damit, einzig seine Anhänger zu knuten und nach Sibirien zu schicken. So greift er zum Äußersten und beschimpft schließlich den Zaren, um endlich bestraft, verschickt, verurteilt zu werden, endlich einmal öffentlich die Revolte seiner Überzeugung zu büßen; jedoch Nikolaus II. entgegnet dem Beschwerde führenden Minister: »Ich bitte, Leo Tolstoi nicht anzurühren, ich habe nicht die Absicht, einen Märtyrer aus ihm zu machen.« Dies aber, gerade dies, Märtyrer seiner Überzeugung, wollte Tolstoi in den letzten Jahren durchaus werden, und gerade dies gestattet ihm das Schicksal nicht, ja, es entfaltet eine geradezu boshafte Fürsorge gegen diesen Leidenswilligen, daß ihm nur kein Leid geschehe. Wie ein Rasender, irrsinnig in seiner Gummizelle, so schlägt er im unsichtbaren Gefängnis seines Ruhms um sich; er bespeit seinen eigenen Namen, er schneidet dem Staat, der Kirche und allen Mächten grimmige Fratzen – aber man hört ihm höflich zu, den Hut in der Hand, und schont ihn als einen hochgeborenen und ungefährlichen Irren. Niemals gelingt ihm die sichtliche Tat, der endgültige Beweis, das ostentative Märtyrertum. Zwischen seinen Willen zur Kreuzigung und die Verwirklichung hat der Teufel den Ruhm gestellt, der alle Schläge des Schicksals auffängt und das Leiden nicht an ihn herankommen läßt.
Warum aber – so fragt ungeduldig das Mißtrauen aller seiner Anhänger und höhnisch der Spott seiner Gegner –, warum zerreißt Leo Tolstoi nicht mit entschlossenem Willen diesen peinlichen Widerspruch? Warum fegt er nicht das Haus rein von Reportern und Photographen, warum duldet er den Verkauf seiner Werke durch die Familie, warum gibt er statt dem eigenen immer wieder dem Willen seiner Umgebung nach, die in vollkommener Mißachtung seiner Forderungen unentwegt Reichtum, Behagen als höchste Güter der Erde anspricht? Warum handelt er nicht endlich eindeutig und klar nach dem Gebot seines Gewissens? Tolstoi hat selbst den Menschen auf diese furchtbare Frage nie geantwortet und niemals sich entschuldigt, im Gegenteil, keiner der müßigen Schwätzer, die mit schmutzigen Fingern auf den taghellen Widerspruch zwischen Wille und Wirksamkeit hindeuteten, verurteilte die Halbheit seines Handelns oder vielmehr seines Nichthandelns härter als er selbst. 1908 schreibt er in sein Tagebuch: »Wenn ich von mir als von einem Fremden reden hörte: ein Mensch, der in Luxus lebt, alles, was er kann, den Bauern nimmt, sie verhaften läßt und dabei das Christentum bekennt und predigt, Fünfkopekenstücke als Almosen austeilt und sich bei all seinen gemeinen Handlungen hinter seine liebe Frau verkriecht – ich würde mich nicht bedenken, einen solchen Menschen als Schuft zu bezeichnen! Und eben das müßte auch mir gesagt werden, damit ich mich von den Eitelkeiten der Welt lossage und nur der Seele lebe.« Nein, einen Leo Tolstoi brauchte niemand über seine moralischen Zweideutigkeiten aufzuklären, er zerriß sich selbst täglich die Seele an ihnen. Wenn er sich, im Tagebuch, die Frage ins Gewissen stößt, rotglühenden Brandstahl: »Sag, Leo Tolstoi, lebst du nach den Grundsätzen deiner Lehre?«, so antwortet die ingrimmige Verzweiflung: »Nein, ich sterbe vor Scham, ich bin schuldig und verdiene Verachtung«. Er war sich vollkommen darüber klar, daß nach seinem Glaubensbekenntnis zur Entbehrung logisch und ethisch nur eine einzige Lebensform für ihn möglich war: sein Haus zu verlassen, seinen Adelstitel, seine Kunst aufzugeben und als Pilger über die russischen Straßen zu ziehen. Zu diesem letzten notwendigsten und einzig überzeugenden Entschluß hat sich der Bekenner jedoch niemals aufraffen können. Aber gerade dies Geheimnis seiner letzten Schwäche, diese Unfähigkeit zum prinzipiellen Radikalismus, will mir Tolstois letzte Schönheit bedeuten. Denn Vollkommenheit ist immer nur jenseits des Menschlichen möglich; jeder Heilige, selbst der Apostel der Sanftmut, muß hart sein können, er muß die fast übermenschliche, die inhumane Forderung an die Jünger stellen, daß sie Vater und Mutter, Weib und Kind gleichgültig hinter sich lassen um der Heiligkeit willen. Ein konsequentes, ein vollkommenes Leben läßt sich immer nur im luftleeren Raum eines abgelösten Individuums verwirklichen, nie in Bindung und Verbindung: darum führt zu allen Zeiten der Weg des Heiligen in die Wüste als die ihm einzig gemäße Hausung und Heimstatt. So müßte auch Tolstoi, sofern er die äußersten Konsequenzen seiner Lehre tätig verwirklichen will, wie von Kirche und Staat sich auch aus dem engeren, wärmeren und haftenderen Kreise der Familie loslösen: zu diesem brutalen, rücksichtslosen Gewaltakt aber fehlt dem allzu menschlichen Heiligen dreißig Jahre lang die Kraft. Zweimal war er geflohen, zweimal zurückgekehrt, denn der Gedanke, seine verstörte Frau könnte Selbstmord begehen, lähmt ihm in letzter Stunde den Willen, er kann sich nicht entschließen – dies seine geistige Schuld und seine menschliche Schönheit! –, einen einzigen Menschen aufzuopfern für seine abstrakte Idee. Lieber als sich mit den Kindern zu entzweien und die Gattin in den Selbstmord zu treiben, duldet er stöhnend das drückende Dach einer nur körperlichen Gemeinsamkeit; verzweifelt gibt er in entscheidenden Fragen, wie jener des Testaments und des Bücherverkaufes, seiner Familie nach und nimmt es eher auf sich, selbst zu leiden, als anderen Leiden zu verursachen. Er bescheidet sich schmerzlich, lieber ein brüchiger Mensch statt ein felsenharter Heiliger zu sein.
Читать дальше