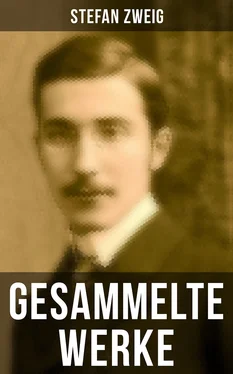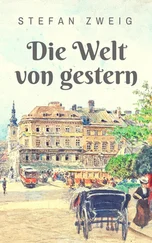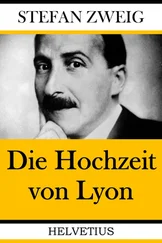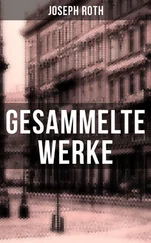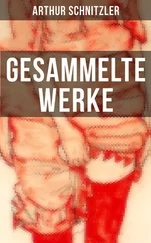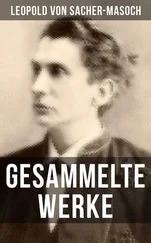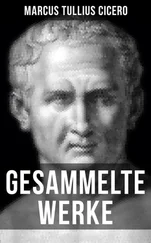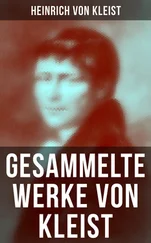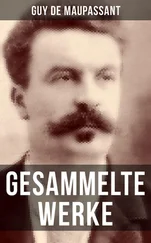So wenden sich aus ganz Rußland Millionen Seelenblicke zu Ende des Jahrhunderts Tolstoi entgegen, kaum daß er seine apostolische Botschaft ankündigt. Die »Beichte«, für uns längst bloß noch ein psychologisches Dokument, berauscht die gläubige Jugend wie eine Verkündigung. Endlich, so jubeln sie, hat einmal ein Gewaltiger und Freier und überdies der größte Dichter Rußlands als Forderung ausgesprochen, was bisher nur die Enterbten klagten, die halb Leibeigenen heimlich flüsterten: daß die gegenwärtige Ordnung der Welt ungerecht, unmoralisch und darum unhaltbar sei und eine neue, bessere Form gefunden werden müsse. Ein unverhoffter Impuls ist allen Unzufriedenen geworden, und zwar nicht von einem der professionellen Fortschrittsphraseure, sondern von einem unabhängigen und unbestechlichen Geiste, dessen Autorität und Ehrlichkeit niemand zu bezweifeln wagt. Mit seinem eigenen Leben, mit jeder Handlung seines offensichtlichen Daseins will, so hören sie, dieser Mann beispielgebend vorausgehen, er will als Graf seine Vorrechte, als reicher Mann sein Eigentum lassen und als erster der Besitzenden und Großen demütig sich einordnen in die unterschiedslose Werkgemeinschaft des arbeitenden Volkes. Bis zu den Ungebildeten, zu den Bauern und Analphabeten wandert die Botschaft von dem neuen Heiland der Enterbten, schon scharen sich die ersten Jünger zusammen, die Sekte der Tolstoianer beginnt buchstabengläubig ihres Lehrers Wort zu erfüllen, und hinter ihnen erwacht und wartet die unübersehbare Masse der Bedrückten. So glühen Millionen Herzen, Millionen Blicke Tolstoi, dem Verkünder entgegen und blicken gierig auf jeden Akt, jede Tat seines weltbedeutsam gewordenen Lebens. »Doch dieser hat gelernt, er wird uns lehren.«
Aber sonderbar, Tolstoi scheint ursprünglich gar nicht wahrzunehmen, welche Wucht von Verantwortung er sich zulastet. Selbstverständlich ist er klarsichtig genug, um zu empfinden, daß man eine solche Lebenslehre als Verkünder nicht nur in kalten Lettern auf dem Papier stehenlassen, sondern beispielhaft inmitten der eigenen Existenz verwirklichen müsse. Aber – und dies ist der Irrtum seines Anfangs – er meint, schon genug getan zu haben, wenn er die Durchführbarkeit seiner neuen sozialen und ethischen Forderungen in seiner Lebenshaltung nur symbolisch andeutet und ab und zu ein Zeichen prinzipieller Bereitschaft gibt. Er kleidet sich also wie ein Bauer, um den äußern Unterschied zwischen Herrn und Knecht unsichtbar zu machen; er arbeitet auf dem Felde mit Sense und Pflug und läßt sich dabei von Rjepin malen, damit jedermann schwarz auf weiß gewahren könne: Arbeit im Felde, grobe, ehrliche Arbeit um das Brot empfinde ich nicht als Schande, und niemand muß sich ihrer schämen, denn seht! ich selbst, Leo Tolstoi, der, wie ihr alle wißt, derlei nicht nötig hätte und den seine geistige Leistung vollkommen entschuldigte, ich nehme sie freudig auf mich. Er überträgt, um mit der »Sünde« des Eigentums nicht länger die Seele zu beflecken, seinen Besitz, sein Hab und Gut (damals schon mehr als eine halbe Million Rubel) an die Frau und Familie und weigert sich, von seinen Werken weiterhin noch Geld oder Geldeswert zu empfangen. Er gibt Almosen und dem fremdesten, niedersten Menschen, der ihn anspricht, seine Zeit in Besuchen und Briefen; er nimmt sich jedes Unrechts und jeder Ungerechtigkeit auf Erden mit brüderlich helfender Liebe an. Aber dennoch, bald muß er erkennen, daß noch mehr von ihm gefordert wird, denn die große grobe Masse der Gläubigen, jenes »Volk« eben, das er mit allen Sinnen seiner Seele sucht, hat kein Genügen an jenen geistig gedachten Symbolen der Demütigung, sondern fordert mehr von Leo Tolstoi: die völlige Entäußerung, das restlose Aufgehen in seinem Elend und Unglück. Wahrhaft Gläubige und Überzeugte schafft immer nur die Märtyrertat – und immer steht darum am Anfang jeder Religion ein Mann der vollkommenen Selbsthingabe – niemals aber die bloß andeutende, die versprechende Haltung. Und alles, was Tolstoi bisher tat, um seine Lehre in ihrer Erfüllbarkeit zu bekräftigen, war nie mehr als bloß Geste der Erniedrigung, ein religiös demütiger Symbolakt, vergleichbar etwa jenem, den die katholische Kirche dem Papst oder den strenggläubigen Kaisern auferlegt, daß sie am Gründonnerstage, also einmal im Jahre, zwölf Greisen die Füße waschen. Damit wird bekundet und vor dem Volke gezeigt, daß selbst die niedrigste Handhabung auch die Höchsten der Erde nicht erniedrige. Aber sowenig der Papst oder die Kaiser Österreichs und Spaniens durch diesen einmal jährlichen Akt der Bußübung sich ihrer Macht begeben und wirklich zu Badeknechten werden, sowenig wird der große Dichter und Adelsherr durch die eine Stunde mit Pfriem und Leisten zum Schuster, durch die zwei Stunden Feldarbeit schon zum Bauern, durch die Vermögensübertragung an seine Hausgenossen zum wirklichen Bettler. Tolstoi demonstrierte zuerst nur die Erfüllbarkeit seiner Lehre, aber er erfüllt sie nicht. Gerade aber dies hatte das Volk, dem Symbole (aus einem tiefen Instinkt) nicht genügen und das nur ein vollkommenes Opfer zu überzeugen vermag, von Leo Tolstoi erwartet, denn immer legen die ersten Anhänger ihres Meisters Lehre viel buchstabengenauer und strenger und wortwörtlicher aus als der Lehrer selbst. Darum jene profunde Enttäuschung, da sie, zu dem Propheten der freiwilligen Armut pilgernd, bemerken müssen, daß genau wie auf den andern Adelssitzen, die Bauern von Jasnaja Poljana weiterhin im Elend sielen, er aber, Leo Tolstoi, ganz wie vordem die Gäste als Graf im Herrenhaus herrschaftlich empfängt und somit immer noch der »Klasse von Menschen« angehört, »die durch allerlei Kunstgriffe dem Volk das Notwendige rauben«. Jene laut angekündigte Vermögensübertragung wird ihnen nicht eingängig als tatsächlicher Verzicht, sein Nichtmehrhaben nicht als Armut, sehen sie doch weiterhin den Dichter im Vollgenuß aller bisherigen Bequemlichkeit, und selbst die Stunde Ackern und Schustern vermag sie keineswegs zu überzeugen. »Was ist das für ein Mensch, der das eine predigt und das andere tut?«, murrt entrüstet ein alter Bauer, und härter noch äußern sich die Studenten und wirklichen Kommunisten über dies zweideutige Schwanken zwischen Lehre und Tat. Allmählich ergreift die Enttäuschung über seine halbe Haltung gerade die überzeugtesten Anhänger seiner Theorien: Briefe und oft pöbelhafte Angriffe mahnen immer vehementer, entweder sich zu dementieren oder endlich die Lehre wortwörtlich und nicht nur in symbolischen Gelegenheitsbeispielen zu erfüllen.
Aufgeschreckt durch diesen Anruf, erkennt Tolstoi endlich selbst, welch ungeheuren Anspruch er herausgefordert, und daß kein Diktum, sondern nur ein Faktum, nicht agitatorische Exempel, sondern nur vollkommene Umformung der Lebensführung seine Botschaft verlebendigen könne. Wer als Sprecher und Versprechender auf öffentlicher Tribüne steht, auf der höchsten des neunzehnten Jahrhunderts, erhellt vom grellen Scheinwerferlicht des Ruhms, überwacht von Millionen Augenpaaren, der muß auf alles private und konziliante Leben endgültig Verzicht leisten, der darf seine Gesinnung nicht bloß gelegentlich andeuten durch Symbole, sondern braucht als gültigen Zeugen die wirkliche Opfertat: »Um von den Menschen gehört zu werden, muß man die Wahrheit durch Leiden erhärten, noch besser durch den Tod.« So wächst Tolstoi für sein persönliches Dasein eine Verpflichtung entgegen, die der apostolische Doktrinär niemals geahnt. Mit Schauern, verstört, seiner Kraft nicht gewiß, bis in die unterste Seelentiefe verängstigt, nimmt Tolstoi das Kreuz auf sich, das er sich mit seiner Lehre aufgeladen, nämlich von nun an mit jeder Handlung seines Daseins restlos seine sittlichen Forderungen zu verbildlichen und inmitten einer spottfreudigen und geschwätzigen Welt ein heiliger Diener seiner religiösen Überzeugung zu sein.
Читать дальше