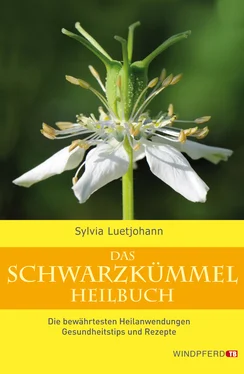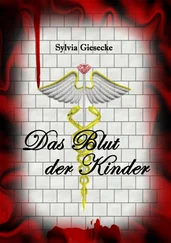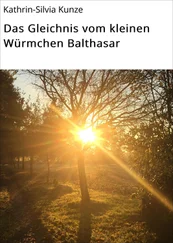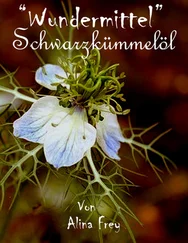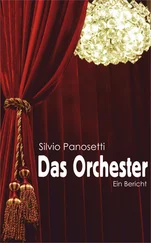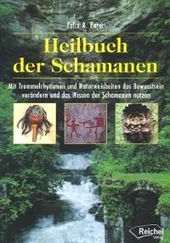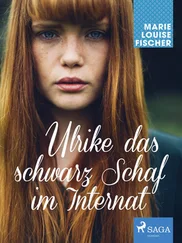Zu Anfang des 11. Jahrhunderts wird Schwarzkümmel von dem berühmten persischen Arzt und Philosophen Ibn Sina (auch als Avicenna bekannt) in seiner großen medizinischen Abhandlung Kitabasch schifa („Buch der Genesung“) ausführlich mit den folgenden Wirkungen erwähnt:
•innere Reinigung und Entgiftung des Körpers
•Entschleimung und Kräftigung der Lungen
•Hausmittel bei Fieber, Husten, Schnupfen, Zahn- und Kopfschmerzen
•Mittel bei Hautleiden und für die Wundbehandlung
•Mittel gegen Darmparasiten und Würmer, auch gegen Bisse und Stiche von giftigen Tieren.
Im Orient überliefert und durch viele Rezepte belegt ist außerdem seine vorwiegend schmerzstillende und krampflösende Wirkung bei Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, Durchfall und Verstopfung, Gelbsucht und Gallenkoliken, für die Anregung der Nieren und eine vermehrte Harnausscheidung, gegen Infektionen, Verschleimung und Bronchialleiden, bei Menstruationsbeschwerden und zur Förderung der Milchsekretion, gegen Hautparasiten und vor allem bei Kindern als Wurmmittel. Im Volk ist auch die Verwendung als hautpflegendes Mittel sowie gegen Schuppen und Haarausfall überliefert. Bis heute ist er überall in den orientalischen Gewürzbasaren zu finden. Der türkische Name Çörekotu , der sich etwa als „Gras(samen) für kleines Gebäck“ übersetzen läßt, weist auf einen seiner Verwendungszwecke hin. Er wird auch, ähnlich wie Mohn oder Sesam, auf Brotfladen gestreut. Viele Mohammedaner nehmen jeden Morgen zur Stärkung nicht nur der Manneskraft eine Prise des Samens in Honig zu sich. Und nicht zuletzt gilt der Samen auch als „Segen des Propheten Mohammed“ für die Rede.
Aus der Türkei ist die Verwendung als Räuchermittel sowie auch der Volksbrauch überliefert, genau 41 Samen des Schwarzkümmels in bunte Stoffsäckchen einzunähen und mit einer Sicherheitsnadel an der Kleidung von Kindern zu befestigen. Dieser Talisman soll sie beschützen. Die Samen werden auch wie Perlen an Schnüren aufgereiht und, mit bunten Stoffetzen verziert, im Fenster aufgehangen. Ein solches Nazarlik soll gegen den „Bösen Blick“ schützen. Auch in Indien gilt dieses blauschwarze Gewürz des dunklen Planeten Ketu, geformt wie eine Träne, als Beschützer gegen das böse Auge. Aus dem Jemen ist der Volksbrauch überliefert, Schwarzkümmel als Amulett zur Vertreibung böser Geister zu tragen.
Von Südosteuropa (Griechenland und Bulgarien) und Nordafrika (Sudan, Äthiopien, Ägypten) über die vorderasiatischen Mittelmeerländer, Syrien, die Türkei, das alte Zweistromland, Persien und Pakistan ist der Schwarzkümmel bis nach Indien und sogar nach China gelangt. In Indien wird Schwarzkümmel vor allem in den Regionen Punjab, Himachal Pradesh, Bihar und Assam kultiviert. Als Brot- und Speisegewürz oder in Rezepturen der indisch-ayurvedischen Medizin verwendet, galt und gilt Kalonji , der „schwarze Zwiebelsamen“, als wohlschmeckendes Gewürz zur Unterstützung des Stoffwechsels sowie als Heilmittel bei Verdauungsstörungen und den gefürchteten Durchfallerkrankungen, wie Amöben- und Bakterienruhr. Außer den Samen und dem fetten Öl wird hier auch traditionell das ätherische Schwarzkümmelöl verwendet.
Nach der ayurvedischen Überlieferung und der Typenlehre von den drei Doshas vermindert Schwarzkümmel Vata und Kapha und vermehrt Pitta . Daraus wurde die Behandlung auch bei ungewöhnlichen Indikationen, z. B. bei Magersucht, bestimmten Störungen des Nervensystems, Ausfluß und venerischen Krankheiten entwickelt. Eine besondere Rolle spielt weiterhin die Frauenheilkunde, wo Schwarzkümmel aufgrund seiner uteruskontrahierenden Wirkung auch bei zu schwachen Wehen und bei Kindbettfieber eingesetzt wurde, wegen der Möglichkeit einer Früh- oder Fehlgeburt allerdings nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden sollte. Dementsprechend gilt Schwarzkümmel auch als „pflanzliches Verhütungsmittel“ und taucht in zahlreichen indischen Pflanzenrezepturen mit abortivem Wirkungspotential auf.
Außerdem wird den Samen eine allgemein anregende, tonisierende und stimmungsaufhellende Wirkung zugeschrieben.
In ganz Indien gibt es im Volk den Brauch, zwischen Stoffe und Tücher zerstoßene Kalonji -Samen zur Insektenabwehr zu streuen. Bekannt ist auch die antibakterielle und daher für die Nahrungskonservierung nützliche Wirkung der Samen.
Die europäische Überlieferung (1. Teil)
Schwarzkümmel ist nicht nur in der Bibel, wo er Ketzah heißt, als vielseitig verwendbares Gewürz für Brot und Kuchen erwähnt, sondern auch allen naturheilkundlichen Autoren der griechischen und römischen Antike bekannt. Der griechische Arzt Hippokrates (5. Jh. v. Chr.) verwendet die Namen melánthion („Schwarzblatt“) oder meláspermon („Schwarzsame“) dafür. Die schwarzen Samen haben der Pflanze auch ihren botanischen Namen gegeben, nämlich Nigella (von lat. niger = „schwarz“ bzw. nigellus = „schwärzlich“). Im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wird er von Plinius Secundus d. Ä. in seiner umfangreichen Naturalis historia („Naturgeschichte“) ausführlich behandelt. Hier taucht als Name übrigens Git oder Gith auf, eine in den antiken lateinischen Schriften oft verwendete Bezeichnung, die sich wahrscheinlich aus dem Arabischen ableitet und der wir später auch in den alten deutschen Quellen noch mehrmals begegnen werden. Eine offenkundig ebenfalls arabisierte Namensform des Schwarzkümmels, nämlich „Salusandriam“, verwendet nur wenig später als Plinius der griechische Arzt Dioskurides in seiner fünfbändigen Arzneimittellehre De materia medica , die weit über das Mittelalter hinaus die Pflanzenheilkunde beeinflussen sollte.
Plinius nennt eine Reihe von Heilanwendungen, von denen uns viele aus der arabischen Welt bereits bekannt sind, so natürlich die verdauungsfördernde Wirkung als Brotgewürz; ferner die schon erwähnte Behandlung von Schlangenbissen und Skorpionstichen, außerdem von Verhärtungen, alten Geschwulsten, Eiterwunden, Hautausschlägen und sogar von Sommersprossen. Eine ganze Reihe von Rezepturen mit Schwarzkümmel gegen Erkältungen und Entzündungen im Kopfbereich werden empfohlen, die noch viele hundert Jahre später fast unverändert in den großen deutschen Heilpflanzen-Enzyklopädien des 16.–18. Jahrhunderts auftauchen werden. Hier einige Kostproben aus der „Naturalis Historia“:
Zerstoßen und zum Riechen in ein leinenes Tüchlein gebunden, vertreibt er Nasenkatarrh, mit Essig aufgestrichen Kopfschmerzen, mit Irisöl in die Nase gestrichen Augenkatarrh und Geschwülste, mit Essig gekocht Zahnschmerzen, zerrieben und gekaut Mundgeschwüre, mit einem Zusatz von Natron getrunken Atembeschwerden …
Der Gebrauch des Schwarzkümmels als wohlschmeckendes und gleichzeitig heilkräftiges Brotgewürz hat sich in der Folgezeit offenbar auch in Deutschland durchsetzen können. Um das Jahr 794 wird sein Anbau im „Capitulare de vilis“ von Karl dem Großen für diesen Verwendungszweck empfohlen. Er wird hier mit den Namen „Römischer Kümmel“ oder „Schwarzer Koriander“ bezeichnet und erhält auch die arabischen und von Plinius überlieferten Heilwirkungen zugeschrieben. Im Jahre 816 wird Schwarzkümmel, der hier Gitto heißt, im „Hortus“ des St. Gallener Klosterplanes aufgeführt. In altdeutschen Glossen wird er als protvurz oder brotchrut bezeichnet. Die Einbürgerung des botanischen Namens Nigella im Mittelalter scheint vor allem auf die Schriften des Albertus Magnus zurückzugehen, er hat sich auch in der Pharmakologie eingebürgert.
Hildegard von Bingen, die im 12. Jahrhundert ihr berühmtes Doppelwerk über Natur- und Heilkunde verfaßt hat, scheint dem Schwarzkümmel dagegen eher mißtrauisch gegenübergestanden zu haben. Sie stuft ihn zwar sehr treffend als „Pflanze von warmer und trockener Qualität“ ein, handelt ihn aber dann auffallend kurz ab. Zu erwähnen ist vor allem die Verwendung von zerstoßenem Schwarzkümmelsamen mit gebratenem Speck als Heilsalbe gegen Kopfgeschwüre. Der Samen, mit Honig vermischt und an die Wand gestrichen, wird außerdem als todsicherer Fliegenfänger empfohlen! Was die Einnahme durch den Menschen betrifft, warnt Hildegard allerdings vor seiner möglicherweise giftigen Wirkung. Dies trifft auf manche Mitglieder dieser recht verzweigten Hahnenfußfamilie sogar zu. Da Hildegard aber den Ackerschwarzkümmel in ihrer „Physica“ mit dem botanischen Namen Githerum ratde benennt, liegt eher die Vermutung nahe, daß bereits hier die später sprichwörtliche Verwechslung mit der Kornrade (Agrostémma githago) passiert ist. Die Samen dieses von den Bauern gefürchteten Getreideunkrauts sind durch Saponine tatsächlich giftig und machen Mehl, Brot und Getreidekaffee nicht nur bitter, sondern sogar gesundheitsschädlich.
Читать дальше