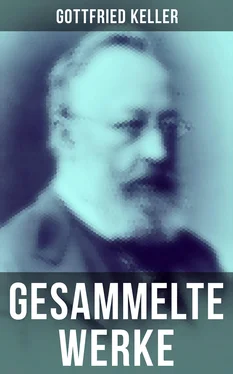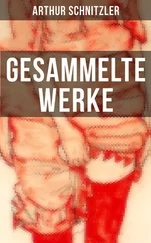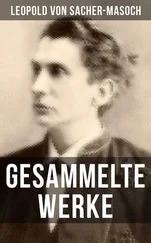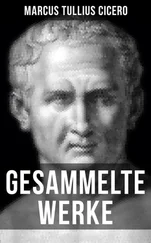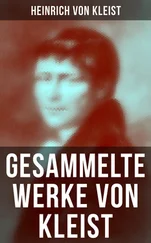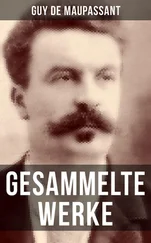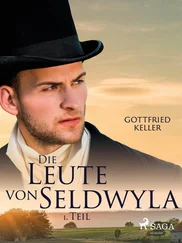Das Hauptbild aber, und auf welches er den meisten Fleiß verwandte, war eine größere Komposition, deren Veranlassung die Psalmworte gegeben Wohl dem, der nicht sitzet auf der Bank der Spötter! Auf einer halbkreisförmigen Steinbank in einer römischen Villa, unter einem Rebendache, saßen vier bis fünf Männer in der Tracht des achtzehnten Jahrhunderts, einen antiken Marmortisch vor sich, auf welchem Champagner in hohen venezianischen Gläsern perlte. Vor dem Tische, mit dem Rücken gegen den Beschauer gewendet, saß einzeln ein üppig gewachsenes junges Mädchen, festlich geschmückt, welches eine Laute stimmt und, während sie mit beiden Händen damit beschäftigt ist, aus einem Glase trinkt, das ihr der nächste der Männer, ein kaum neunzehnjähriger Jüngling, an den Mund hält. Dieser sah beim lässigen Hinhalten des Glases nicht auf das Mädchen, sondern fixierte den Beschauer, indessen er sich zu gleicher Zeit an einen silberhaarigen Greis mit kahler Stirn und rötlichem Gesicht lehnte. Der Greis sah ebenfalls auf den Beschauer und schlug dazu spöttisch mutwillig Schnippchen mit der einen Hand, indessen die andere sich gegen den Tisch stemmte. Er blinzelte ganz verzwickt freundlich mit den Augen und zeigte allen Mutwillen eines Neunzehnjährigen, indessen der Junge, mit trotzig schönen Lippen, mattglühenden schwarzen Augen und unbändigen Haaren, deren Ebenholzschwärze durch den verwischten Puder glänzte, die Erfahrungen eines Greises in sich zu tragen schien. Auf der Mitte der Bank, deren hohe, zierlich gemeißelte Lehne man durch die Lücken bemerkte, saß ein ausgemachter Taugenichts und Hanswurst, welcher mit offenbarem Hohne, die Nase verziehend, aus dem Bilde sah und seinen Hohn dadurch noch beleidigender machte, daß er sich durch eine vor den Mund gehaltene Rose das Ansehen gab, als wolle er denselben gutmütig verhehlen. Auf diesen folgte ein stattlicher ernster Mann; dieser blickte ruhig, fast schwermütig, aber mit mitleidigem, bedauerlichem Spott drein, und endlich schloß den Halbkreis, dem Jüngling gegenüber, ein eleganter Abbé in seidener Soutane, welcher, wie eben erst aufmerksam gemacht, einen forschenden stechenden Blick auf den Beschauer richtete, während er eine Prise in die Nase drückte und in diesem Geschäft einen Augenblick anhielt, so sehr schien ihn die Lächerlichkeit, Hohlheit oder Unlauterkeit des Beschauers zu frappieren und zu heillosen Witzen aufzufordern. So waren alle Blicke, mit Ausnahme derer des Mädchens, auf den gerichtet, welcher vor das Bild trat, und sie schienen mit unabwehrbarer Durchdringung jede Selbsttäuschung, Halbheit, Schwärmerei, jede verborgene Schwäche, jede unbewußte Heuchelei aus ihm herauszufischen oder vielmehr schon entdeckt zu haben. Auf ihren eigenen Stirnen und über ihren Augen, um ihre Mundwinkel ruhte zwar unverkennbare Hoffnungslosigkeit; aber trotz ihrer Marmorblässe, die alle, ohne den rötlichen Greis, überzog, staken sie in einer so unverwüstlichen muntern Gesundheit, und der Beschauer, der nicht ganz seiner bewußt war, befand sich so übel unter diesen Blicken, daß man eher versucht war auszurufen Weh dem, der da steht vor der Bank der Spötter! und sich gern in das Bild hineingeflüchtet hätte.
Waren nun Absicht und Wirkung dieses Bildes durchaus verneinender Natur, so war dagegen die Ausführung mit der positivsten Lebensessenz getränkt. Jeder Kopf zeigte eine inhaltvolle eigentümlichste Individualität und war für sich eine ganze tragische Welt oder eine Komödie und nebst den schönen arbeitlosen Händen vortrefflich beleuchtet und gemalt. Die gestickten Kleider der wunderlichen Herren, der grüne Sammet und der rote Atlas an der reichen Tracht des Weibes, ihr blendender Nacken, die Korallenschnur darum, ihre von Perlenschnüren durchzogenen schwarzen Zöpfe und Locken, die goldene sonnige Bildhauerarbeit an dem alten Marmortische, die Gläser mit den aufschäumenden Perlen, selbst der glänzende Sand des Bodens, in welchen sich der reizende Fuß des Mädchens drückte, diese zarten weißen Knöchel im rotseidenen Schuh alles dies war so zweifellos, breit und sicher und doch ohne alle Manier und Unbescheidenheit, sondern aus dem reinsten naiven Wesen der Kunst und aus der Natur heraus gemalt, daß der Widerspruch zwischen diesem freudigen, kraftvollen Glanz und dem kritischen Gegenstand der Bilder die wunderbarste Wirkung hervorrief. Dies klare und frohe Leuchten der Formenwelt war Antwort und Versöhnung, und die ehrliche Arbeit, das volle Können, welche ihm zugrunde lagen, waren der Lohn und Trost für den, der die skeptischen Blicke der Spötter nicht zu scheuen brauchte oder sie tapfer aushielt.
Lys nannte dies Bild seine »hohe Kommission«, seinen Ausschuß der Sachverständigen, vor welchen er sich selbst zuweilen mit zerknirschtem Herzen stelle; auch führte er manchmal einen armen Sünder, dessen gezierte Gefühligkeit und Weisheit nicht aus dem lautersten Himmel zu stammen schien, vor die Leinwand, wo dann der Kauz mit seltsamem, etwas einfältigem Lächeln seine Augen irgendwo unterzubringen suchte und machte, daß er bald davonkam.
Heinrich wurde von seinen beiden Freunden und anderen Gesellen auch hier der grüne Heinrich genannt, da er sie einst mit diesem Titel bekannt gemacht, und er trug ihn, wie man ihn gab, um so lieber, als er seiner grünen Bäume und seiner hoffnungsvollen Gesinnung wegen denselben wohl zu verdienen schien und sich überdies heimatlich dadurch berührt fühlte. Übrigens war er, wie es einst der unglückliche Römer prophezeit, richtig in den Hafen der gelehrten und stilisierten Landschaften eingelaufen und gab sich, indem er seit seinem Hiersein nicht mehr aus den Mauern der großen Stadt gekommen, rückhaltlos einem Spiritualismus hin, welcher seinen grünen, an den frischen Wald erinnernden Namen fast zu einem bloßen Symbol machte.
Sobald er die angehäuften Kunstschätze der Residenz und dasjenige, was von Lebenden täglich neu ausgestellt wurde, gesehen, auch sich in den Mappen einiger junger Leute umgeschaut, welche aus poetischen Schulen herkamen, ergriff er sogleich diejenige Richtung, welche sich in reicher und bedeutungsvoller Erfindung, in mannigfaltigen, sich kreuzenden Linien und Gedanken bewegt und es vorzieht, eine ideale Natur fortwährend aus dem Kopfe zu erzeugen, anstatt sich die tägliche Nahrung aus der einfachen Wirklichkeit zu holen.
Der Verfasser dieser Geschichte fühlt sich hier veranlaßt, sich gewissermaßen zu entschuldigen, daß er so oft und so lange bei diesen Künstlersachen und Entwickelungen verweilt, und sogar eine kleine Rechtfertigung zu versuchen. Es ist nicht seine Absicht, sosehr es scheinen möchte, einen sogenannten Künstlerroman zu schreiben und diese oder jene Kunstanschauungen durchzuführen, sondern die vorliegenden Kunstbegebenheiten sind als reine gegebene Facta zu betrachten, und was das Verweilen bei denselben betrifft, so hat es allein den Zweck, das menschliche Verhalten, das moralische Geschick des grünen Heinrich und somit das Allgemeine in diesen scheinbar zu absonderlichen und berufsmäßigen Dingen zu schildern. Wenn oft die Klage erhoben wird, daß die Helden mancher Romane sich eigentlich mit nichts beschäftigen und durch einen andauernden Müßiggang den fleißigen Leser ärgern, so dürfte sich der Verfasser sogar noch beglückwünschen, daß der seinige wenigstens etwas tut, und wenn er auch nur Landschaften verfertigt. Das Handwerk hat einen goldenen Boden und ganz gewiß in einem Romane ebensowohl wie anderswo. Übrigens ist nur zu wünschen, daß der weitere Verlauf die Endabsicht klarmachen und der aufmerksame Leser inzwischen solche Stellen dulden und von besagtem Standpunkte aus ansehen möge.
Also Heinrich versenkte sich nun ganz in jene geistreiche und symbolische Art. Da er seine Jugendjahre meistens im Freien zugebracht, so bewahrte er in seinem Gedächtnisse, unterstützt von einer lebendigen Vorstellungskraft und seinen alten Studienblättern, eine ziemliche Kenntnis der grünen Natur, und dieser Jugendschatz kam ihm jetzt gut zustatten; denn von ihm zehrte er diese ganzen Jahre. Aber dieser Vorrat blaßte endlich aus, man sah es an Heinrichs Bäumen; je geistreicher und gebildeter diese wurden, desto mehr wurden sie grau oder bräunlich, statt grün; je künstlicher und beziehungsreicher seine Steingruppierungen und Steinchen sich darstellten, seine Stämme und Wurzeln, desto blasser waren sie, ohne Glanz und Tau, und am Ende wurden alle diese Dinge zu bloßen schattenhaften Symbolen, zu gespenstigen Schemen, welche er mit wahrer Behendigkeit regierte und in immer neuen Entwürfen verwandte. Er malte überhaupt nur wenig und machte selten etwas ganz fertig; desto eifriger war er dahinter her, in Schwarz oder Grau große Kartons und Skizzen auszuführen, welche immer einen bestimmten, sehr gelehrten oder poetischen Gedanken enthielten und sehr ehrwürdig aussahen.
Читать дальше