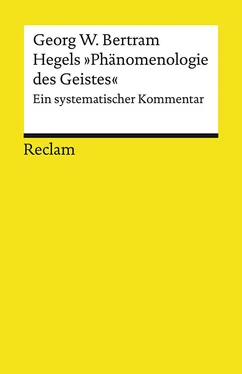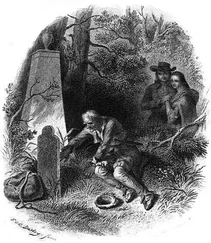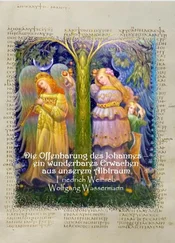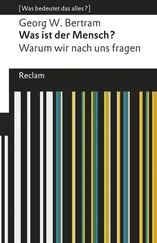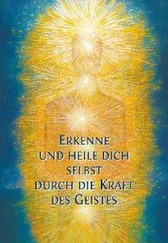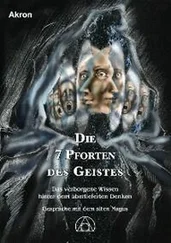Mit dieser Transformation wird ein entscheidender Unterschied eingeführt, der mit der Trennung zwischen einer substantiellen und einer phänomenalen Auffassung an sich bereits etabliert ist, nämlich derjenige zwischen der Wahrheit des Gegenstands und den Täuschungen des Bewusstseins:
Es hat sich hiemit für das Bewusstsein bestimmt, wie sein Wahrnehmen wesentlich beschaffen ist, nämlich nicht ein einfaches reines Auffassen, sondern in seinem Auffassen zugleich aus dem Wahren heraus in sich reflektiert zu sein. […] – Es ist hiemit itzt, wie es bei der sinnlichen Gewissheit geschah, an dem Wahrnehmen die Seite vorhanden, dass das Bewusstsein in sich zurückgedrängt wird, aber zunächst nicht in dem Sinne, in welchem dies bei jener der Fall war; als ob in es die Wahrheit des Wahrnehmens fiele, sondern vielmehr erkennt es, dass die Unwahrheit , die darin vorkömmt, in es fällt. (102/98 f.)
In zweifacher Weise kann das Bewusstsein als Quelle der Unwahrheit verstanden werden: Entweder führt es das Zustandekommen von Allgemeinheiten auf seine eigene Tätigkeit zurück, so dass die Allgemeinheiten nicht in den Gegenständen begründet sind und es entsprechend möglich ist, die Gegenstände als bloße Einheit zu fassen. Oder es begreift sich als Quelle der Einheit des Gegenstands, die es dadurch herstellt, dass es die in der Welt bestehenden Eigenschaften zusammenfasst und so Gegenstände bildet.
Im ersten Fall ist die Einheit des Gegenstands substantiell, im zweiten Fall ist sie eine Konstruktion des Bewusstseins. Es werden also Hinsichten voneinander unterschieden, in denen das Bewusstsein tätig ist und den Gegenstand als Gegenüber und damit Maßstab seiner Tätigkeit weiß. Dieses Unterscheiden aber beendet die Täuschung nicht: Dem Bewusstsein gelingt es nicht, die Einheit des Gegenstands mit der Vielheit der an ihm vorkommenden Eigenschaften zu versöhnen.
Aus der Erfahrung des Fortbestands dieser Widersprüche entwickelt sich eine dritte Form, in der die Wissenskonzeption auftritt: Die Unterscheidung zwischen dem, was das Bewusstsein auffasst, und dem, was der Gegenstand unabhängig von dieser Auffassung ist, wird dabei in die Konzeption des Gegenstands selbst eingetragen. An ihm werden dementsprechend Momente, die den Gegenstand für sich ausmachen, von solchen Momenten unterschieden, die konstitutiv darauf bezogen sind, dass der Gegenstand wahrgenommen wird: »Das Ding ist hienach für sich, und auch für ein Anderes, ein gedoppeltes verschiedenes Sein […].« (105/102)
Aber auch diese interne Aufteilung des Gegenstands (die an Lockes Unterscheidung von primären und sekundären Qualitäten erinnert30) lässt sich nicht stabilisieren. Die Unterscheidung selbst besagt, dass der Gegenstand insgesamt nur von dem her verstanden werden kann, wie er für andere ist. Wenn man im Gegenstand das, was er für sich ist, und das, was er für andere (wahrnehmende Subjekte) ist, voneinander unterscheidet, dann wird der Gegenstand in seiner Konzeption auf das hin angelegt, wie er zu anderem in Beziehung steht. In Hegels Worten:
Durch den absoluten Charakter gerade und seine Entgegensetzung verhält es sich zu andern , und ist wesentlich nur dies Verhalten; das Verhältnis aber ist die Negation seiner Selbstständigkeit, und das Ding geht vielmehr durch seine wesentliche Eigenschaft zugrunde. (107/103)
Die Wissenskonzeption der Wahrnehmung erweist sich damit als eine solche, die ihren wesentlichen Anspruch, den Gegenstand in seiner Sichselbstgleichheit zu fassen, nicht einlöst.
Hegels Diagnose dafür nimmt sich erst einmal überraschend aus. Das Problem der Wahrnehmung sei, dass sie ein unzureichendes Verständnis von Allgemeinheit entwickle. Sie konzipiere Allgemeinheit als » sinnliche Allgemeinheit « (108/105). Die Idee einer in dieser Weise eingeschränkten Allgemeinheit ist, so kann man Hegel verstehen, in sich widersprüchlich. Sinnliche Allgemeinheiten sind Allgemeinheiten, die auf die Welt der Erscheinungen beschränkt sind (aus diesem Grund nennt Hegel sie »sinnlich«), nicht Allgemeinheiten, die Gegenstände als solche einbeziehen. Charakteristisch für die Wissenskonzeption der Wahrnehmung ist so, dass sie Gegenstände als solche versteht, die nicht aus sich selbst heraus in allgemeine Strukturen eingebettet sind. Die Einbettung in allgemeine Strukturen wird durch die Beziehung geleistet, in der die Gegenstände zu wahrnehmenden Subjekten stehen. Dieser Gedanke hängt in der Wissenskonzeption der Wahrnehmung damit zusammen, dass Gegenstände als solche aufgefasst werden, die aus sich heraus das sind, was sie sind. Zwar wird das Bewusstsein von dieser Konzeption als aktiv begriffen, die Aktivität erstreckt sich jedoch nicht auf die Gegenstände als solche.
Hegels Diagnose lässt sich auch noch einmal anders fassen: Die Wahrnehmung versteht Eigenschaften als solche, die im Zusammenhang vieler anderer Eigenschaften bestimmt sind. Wir können dies als ein holistisches Verständnis von Eigenschaften verstehen (als Teilaspekt des bereits angesprochenen holistischen Verständnisses von Begriffen):31 Eine Eigenschaft wie Röte ist nur im Kontext anderer Eigenschaften wie Bläue und Grünheit konstituiert. Hegel spricht in diesem Sinn von der Gesamtheit der Eigenschaften als dem »allgemeine[n] gemeinschaftliche [n] Medium « (101/98). Die Wissenskonzeption der Wahrnehmung will die Sichselbstgleichheit der Gegenstände in diesem allgemeinen Medium erfassen. Dies aber misslingt, so Hegel, da die Allgemeinheit des Mediums nicht im Sinne einer umfassend produktiven Auseinandersetzung mit Gegenständen verstanden wird. Die These lautet entsprechend, dass die Wahrnehmung gewissermaßen vor den Gegenständen haltmacht. Wer Allgemeinheit als sinnliche Allgemeinheit konzipiert, geht davon aus, dass Gegenstände unabhängig von den Strukturen der Allgemeinheit Bestand haben. Hegel macht also hier bereits implizit deutlich, dass Allgemeinheit nicht nach dem Paradigma der Allgemeinheit sinnlicher Eigenschaften gedacht werden darf.
III. Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt
Die dritte Gestalt, die Hegel im Bewusstseinskapitel kommentiert, hebt die Widersprüche auf, die sich in der als Wahrnehmung bezeichneten Wissenskonzeption ergeben haben. Aufgehoben wird in erster Linie der Widerspruch zwischen der Einheit des Gegenstands (der substantiellen Auffassung) und der Vielheit der Eigenschaften (der phänomenalen Auffassung). Dies geschieht dadurch, dass die Einheit des Gegenstands mit den Eigenschaften, mit denen er erscheint, versöhnt wird. Damit kommt eine neue Wissenskonzeption ins Spiel, die Hegel als Verstand bezeichnet. Der Verstand sucht Wissen dadurch zu erlangen, dass Gegenstände als Quelle von Kräften begriffen werden, die sich in Erscheinungen zeigen. Charakteristisch für die Wissenskonzeption des Verstandes ist also, dass sie sich nicht an die Erscheinungen und Gegenstände hält, sondern eine theoretische Größe einführt, die die Einheit des Gegenstands ausmacht und die sich in seinen Erscheinungen äußert.
Aus diesem Grund charakterisiert Hegel die Wissenskonzeption mit dem Begriff der »übersinnlichen Welt«. Es handelt sich dabei um den Versuch, die Grundlage des Wissens weder im direkten Kontakt mit den Gegenständen noch in den Wahrnehmungen von Eigenschaften, sondern in hinter den Gegenständen wirksamen Kräften zu suchen, also dadurch, dass man über die sinnliche Welt hinausgeht. Der Übergang zu einer »übersinnlichen Welt« macht dabei deutlich, dass es Hegel im Bewusstseinskapitel nicht im engeren Sinn um empiristische Positionen geht. Er diskutiert nicht Konzeptionen, die Wissen in einem sinnlichen Gegenstandsbezug fundieren, sondern interessiert sich für die Fundierung von Wissen in einem Gegenstandsbezug überhaupt. Der Verstand bezieht sich auf übersinnliche Gegenstände – auf Kräfte und Gesetze – und beansprucht durch diesen Bezug Wissen zu begründen.
Читать дальше