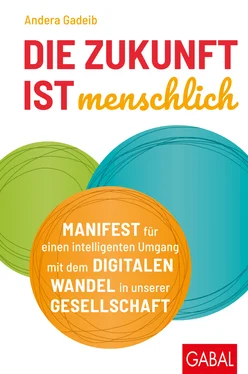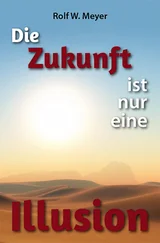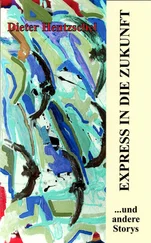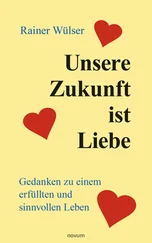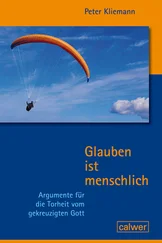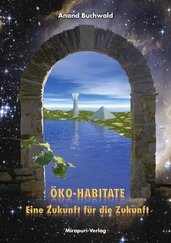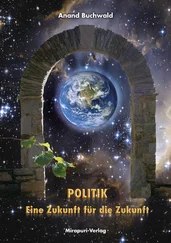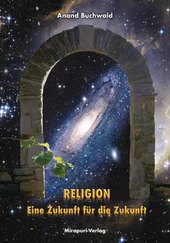Aus dem Unternehmensalltag eines Marktforschers kann ich sagen, dass es Anfragen gibt, die lauten: »Hauptsache, Sie liefern 1000 Interviews oder mehr. Dann ist es repräsentativ.« Genau das ist Quatsch, und ich erkläre Ihnen, warum.
Ein einfaches Beispiel, bei dem Sie vermutlich die Alarmglocken läuten hören: Stellen Sie sich vor, Sie sollen herausfinden, wie viel Wert die Deutschen ganz allgemein auf Biolebensmittel legen. Sie stellen sich an einem Samstagmorgen vor einen Biomarkt im Ort und fragen dort 30 Menschen, wie sie es mit dem Einkauf von Biolebensmitteln halten. Am Abend führen Sie die gleiche Umfrage vor dem Multiplex-Kino Ihrer Wahl durch und erreichen weitere 30 Personen. Am Sonntag setzen Sie sich in Ruhe hin, nehmen sich Ihre Interviews vor, werten die Antworten aus (wie oft wurde welche Antwort gewählt?) und vergleichen die beiden Gruppen, also Biomarkt- und Kinogänger. Was vermuten Sie? Was kommt raus? Ticken beide Gruppen gleich? Vermutlich nicht. In der Gruppe der Biomarktkäufer erhalten Sie vermutlich 100 % Zustimmung, wenn es um die Wichtigkeit von Biokost geht. Vor dem Kino wird der Wert deutlich niedriger liegen. Angenommen, Sie erwischen vor allem studentische Befragte, werden diese möglicherweise urteilen, dass sie aus Kostengründen eher zu konventionellen Produkten greifen. Welche Antworten sind nun »richtig«? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten: Die Stichproben waren nicht ausgewogen und nicht geeignet, etwa eine Aussage über alle Deutschen zu treffen, schließlich sind Sie allein durch die Ortswahl Ihrer Interviews jeweils auf spezielle Zielgruppen getroffen. Im Kapitel 2 werden wir darauf etwas genauer schauen.
Mit diesem einfachen Beispiel will ich Sie motivieren, Ihren gesunden Menschenverstand einzuschalten, wenn Sie solche Ergebnisse sehen. Lesen Sie nicht nur die Titelzeile. »Biolebensmittel total angesagt« könnte die Überschrift lauten, wenn ein Artikel über Biokäufer geschrieben wird. Es nützt übrigens wenig, wenn Sie Ihre Freizeit so lange vor dem Biomarkt verbringen, bis Sie 1000 Interviews oder gar 10 000 Interviews durchgeführt haben. Das Ergebnis passt immer noch nur für die Biokäufer. Daraus eine Aussage über die gesamte Bevölkerung abzuleiten wäre schlichtweg falsch. Daran ändert eine große Zahl Befragter gar nichts, sondern nur eine ausgewogene und kontrollierte Rekrutierung der Teilnehmer.
Lesen Sie also weiter, wenn Sie eine Überschrift sehen. Schauen Sie sich an, was im Detail berichtet wird. Wenn eine Studie zitiert wird, hinterfragen Sie diese kritisch. Eine gute Berichterstattung wird Auskunft darüber geben, wie befragt wurde und wie viele Menschen dahinterstehen. Jeder gute Journalist wird kritisch hinterfragen. Sollten Sie journalistisch tätig sein, dann lassen Sie sich nicht vom Druck im Hamsterrad und der Größe einer Stichprobe leiten, sondern überlegen Sie, was Sie veröffentlichen. Schließlich steht Ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, 8auch wenn wir in Zeiten des Wandels und hohen Drucks sehen, dass reißerische Meldungen sich besser verkaufen mögen.
Aber was heißt das nun? Ich meine, Sie sollten Haltung einnehmen. Aus Ihrer Rolle und Verantwortung heraus, sei es als Mutter oder Vater, Arbeitnehmer, Manager, Lehrer, Pfleger, Freund … Seien Sie ehrlich mit sich selbst und fragen Sie sich: Kann das sein? Nehmen Sie sich die Zeit, gründlich zu lesen. Haben Sie diese nicht, dann verbreiten Sie bitte keine Meldung. Vergegenwärtigen Sie sich, dass Ihr Gegenüber Ihren Aussagen vertraut.
Wir werden uns im Verlauf noch mit der Bedeutung von Marken, bspw. als Absender eines Produkts oder einer Dienstleistung, beschäftigen. Allgemein betrachtet ist jeder Einzelne eine »Marke«, ebenso wie Institutionen. Warum es in Zeiten digital schnell verbreiteter (Falsch-) Meldungen so wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben und die eigene Glaubwürdigkeit und Integrität zu wahren, lesen Sie im folgenden Beispiel.
Wie eine hochintegre Institution zweifelhafte Statistiken verbreitet
Während ich dieses Buch schrieb, veröffentlichte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das Ergebnis einer Studie auf Twitter: 25 % der Deutschen können in wenigen Worten erklären, was künstliche Intelligenz (KI) bedeutet. Darunter noch ein lustiges Interaktionselement: eine Umfrage. Twitter ist ein 2006 gestarteter Social-Media-Kanal, auf dem mit 1,8 Millionen deutschsprachigen Nutzerkonten vergleichsweise wenige Nutzer aktiv sind. Sie treffen hier überwiegend »Fachpublikum« wie Journalisten, Politiker und Experten ihres Fachs.
Zurück zur Umfrage auf Twitter. Sie ahnen es schon: Wir haben hier den Biomarkteffekt. Ganze 93 % der 43 Teilnehmer auf Twitter (ich war eine davon) können KI erklären. Nur drei verneinten. Mein GMV sagte bei den 93 % »Ja, das passt«, ist Twitter doch ein Medium, in dem sich fast ausschließlich technologieaffine Menschen tummeln. Und wer sich für die Nachrichten eines Wirtschaftsministeriums interessiert, ist wohl erst recht im Thema.
Aber 25 % der Deutschen? Mein GMV schlug Alarm. Wäre der Absender irgendein Klatschblatt gewesen, hätte ich drüber hinweggelesen, weil ich schon diesen Absender nicht ernst nehme (Thema Marke! Dazu weiter unten mehr). Aber das Bundeswirtschaftsministerium? Dort, wo ich seit einigen Jahren und sehr gerne eine Beiratsrolle wahrnehme und Hinweise geben soll, wie das Digitale zu gestalten ist? Da fühle ich mich aufgefordert, Haltung einzunehmen. Ich muckte auf und antwortete auf den Tweet, dass ich Zweifel an der Richtigkeit der 25 % habe. Ich schätze diese Zahl – aus meiner Erfahrung und Studien heraus – deutlich niedriger ein. Zwar erhielt ich keine Antwort des BMWi, aus dem Lobbyumfeld aber erreichte mich eine scharf formulierte private Nachricht. Und was glauben Sie, was darin stand? Wie ich es mir erlauben könnte, eine Aussage des BMWi in Zweifel zu ziehen! Meine Antwort: Gerade weil ich mich in dem Feld auskenne, finde ich es wichtig, Haltung einzunehmen.
Genau das ist entscheidend: Lassen Sie uns in Diskurs gehen, statt blind zu vertrauen. Am Diskurs wachsen wir alle und lernen aus der Erfahrung und im Kontext mit anderen. Dazu gehört auch, etwas aushalten zu können. Im blinden Vertrauen jedoch bleiben wir passiv, wachsen nicht in die Gestalterrolle und fügen der Diskussion keine eigenen Akzente hinzu. Also: Statt einfach im Schwarm mitzuschwimmen, drücken Sie die eigene Haltung oder Überzeugung aus dem gesunden Menschenverstand offen aus, auch wenn mit Widerstand zu rechnen ist. Resilienz nennen die Psychologen diese Widerstandskraft. Was dazu beitragen kann, diesen wichtigen Soft Skill zu schulen, sehen wir im Kapitel 4: Bildung .
Zum Diskurs gehören Argumente und Gegenargumente, die uns oder unser Gegenüber auch überzeugen können. Es gehört Mut dazu, Fehler und Fehleinschätzungen zu korrigieren oder zu kommentieren. Als schädlich dagegen stufe ich Passivität ein – die »Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen«-Haltung der berühmten drei Affen, wie ich sie zunehmend wahrnehme. Und zwar immer dann, wenn die Themen besonders kompliziert werden, wie etwa beim Thema Daten.
Lassen Sie uns aufstehen und den Diskurs starten. Aus gesundem Menschenverstand. Das wäre ein wunderbarer Beginn der »halb vollen« Sichtweise auf die Welt.
Mensch und Maschine
Stärken entfalten
Die »Halb voll«-Haltung kann uns helfen, in jeder Situation auf die Stärken und Potenziale zu blicken statt auf die Schwächen. Der Neurobiologe und Bestsellerautor Gerald Hüther nennt es Potenzialentfaltung und beschreibt, dass wir mit Kreativität und Begeisterung statt Stress und Leistungsdruck das entfalten, was in uns steckt. 9Die Neuroplastizität, also Weiterentwicklung unseres Gehirnnetzwerks, geschieht nur, wenn wir etwas mit Begeisterung tun. So liegt es mir am Herzen, Begeisterungsfähigkeit für diese neue digitale Welt zu schaffen. Wer in Zeiten des digitalen Wandels zum Gestalter wird und die eigenen Stärken entfaltet, kann vom Wandel nicht überrollt werden.
Читать дальше