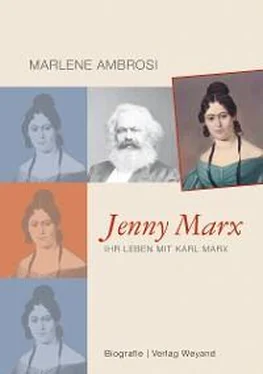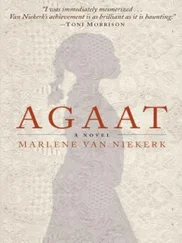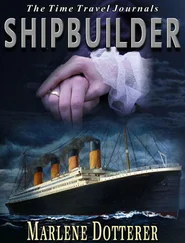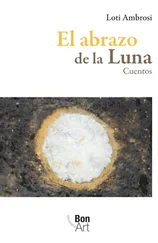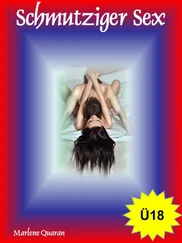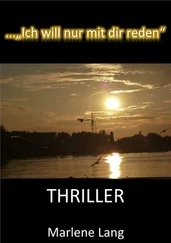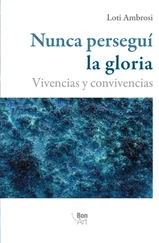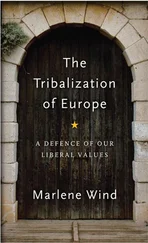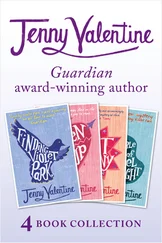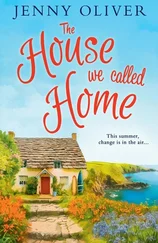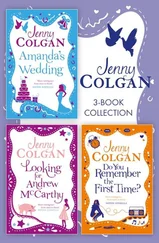Warum ging der Vater so hart mit dem Sohne ins Gericht? „Die Stimmung, in der ich mich befinde, ist in der That auch nichts weniger als poetisch. Mit einem Husten, der jährig ist, und mein Geschäft mir drückend macht, und mit einer seit kurzem hinzugekommenen Gicht verpaart, finde ich mich selber mehr verstimmt als billig, und ärgere mich meiner Karackterschwäche, und so kannst Du freylich nur erwarten die Schilderungen eines alternden grämlichen Mannes, der sich über die ewigen Täuschungen ärgert, und besonders darüber, daß er seinem eignen Idol einen Spiegel voller Zerrbilder vorhalten muß“ 18, fügte er in seinem Brief vom 9. Dezember 1837 hinzu. Statt dem Vater zu antworten, beklagte sich der Sohn so bitterlich über die Vorhaltungen, dass sich sogar sein zukünftiger Schwiegervater bei Sohn Ferdinand echauffierte über „das wirkliche Unrecht, was ihm der strenge, ihn durchaus nicht schonende Vater quasi ab irato u. durch eigenes langes Unwohlsein u. das Gefühl einer herannahenden schweren eigenen Krankheit u. durch häusliches großes Leid sehr verstimmt … zugefügt hat – u. wodurch diese nun zugleich wohl auch durch übermenschliche besonders nächtliche Geistesanstrengung dessen nun Gottlob gehobene gefährliche Krankheit erzeugt worden. Er hatte, wie er wähnte, zur Befriedung seines von ihm hoch verehrten, über alles geliebten Vaters, diesem ein opus von 300 enggeschriebenen Bogen über einen höchst trockenen Theil der Rechtswissenschaften mitgetheilt, wovon der Vater selbst einräumen mußte, sie zeuge von vielen gründlichen Rechtskenntnissen, tiefem philosophischen Geist, Originalität, scharfem, eindringlichem Urtheile u. sey mit gr(oßer) Klarheit in reinstem fasslichem Style abgefasst, an deren Ende u. im Schluß Resultate der Verfasser aber selbst anerkannt, er habe aus falschen unhaltbaren Prämissen ein völlig unhaltbares, falsches System entwickelt und die Arbeit sey zu verwerfen. Daraus nimmt nun der Vater Anlaß zum schärfsten Tadel seiner unpractischen unersprieslichen Arbeits– und Beschäftigungsweise… dass er auf diesem Wege niemals zu seinem Zwecke kommen und stets leeres Stroh dreschen werde – u. nun folgt nichts als wie strenger herber Tadel auf Tadel.“ 19Eine schöne Verteidigungsrede für Karl und doch relativierte Westphalen sein barsches Urteil, als er auf die schlimmen Wochen im Hause Marx hinwies. Eduard, der jüngste Sohn, war nach langer Krankheit am 14. Dezember 1837 im Alter von nur 11 Jahren gestorben. Er war, wie Ludwig von Westphalen anfügte, „von dem Augenblicke an, wo er das Gymnasium besuchte – in eine d(urch)aus räthselhafte Auszehrungskrankheit aus einem blühenden kräftigen Jungen verfallen …, bis der Tod ihn u. die armen Eltern und Geschwister von so großem Leiden befreite.“ 20Jenny, die das Sterben des kleinen Eduard mit bangem Herzen verfolgt hatte, vernahm nach den Worten ihres Vaters mit Tränen „das klugrührende Testament des kl(einen) Engels, worin er seine liebe Jenny vorzüglich bedachte!“ 21Diese Zeilen von Karls jüngerem Bruder sind nicht erhalten.
Zu gleicher Zeit kriselte es in der Beziehung zwischen Jenny und Karl. Mit der Post, die ihm den schonungslosen Brief des Vaters so kurz vor dem Tode des jüngeren Bruders gebracht hatte, war auch ein Brief „von seiner vergötterten Jenny“ angekommen. Dieser war, wie Ludwig von Westphalen meinte, „in solchem zufällig ähnlichem Tone geschrieben also quasi ein zwischen Vater und Schwiegertochter gegen ihn, der etwas argwöhnischer Natur – in der Liebe wenigstens – zu sein scheint, getriebenes Spiel – so tief gekränkt u. erschüttert hat, dass er in eine sehr gefähr(liche) schwere Nervenkrankheit verfallen war, von der er jedoch Gottlob jetzt wieder – dank sey es seiner eisernen Constitution – völlig genesen ist.“ 22Ob Jenny in dem nicht überlieferten Brief, aus welchen Gründen auch immer, ihre Verlobung in Frage gestellt und vielleicht sogar mit Trennung gedroht hat, ist nicht zu eruieren, aber ihre Worte zeigten Wirkung. Karl geriet an den Rand eines Zusammenbruchs und ließ sich auf ärztlichen Rat in dem kleinen Fischerdorf Stralau bei Berlin nieder. Zu seiner Erholung trug die Beseitigung des Missklanges zu Jenny bei. Die Verlobte hoffte, Karl suche nun das klärende Gespräch über Weihnachten, vergebens. Karl ahnte jedoch ihre grenzenlose Enttäuschung und schickte ein wunderbares Trostpflaster: Gedichte aus seiner Feder. „8 Tage hätte man an diesen reichen Schätzen zu lesen u. sich mit Wonne u. Bewunderung gegen den seltenen Menschen mit wahrer Götterspeise (zu) füllen, denn wahrlich ich … schwamm … – u. Jennys Gefühle waren sicher meinen gleich – in einem Meer von Entzücken“ 23, begeisterte sich Ludwig von Westphalen über Karls Geschenk. Voller Emphase las Jenny den Eltern, Bruder Carl und Tante Christiane am Weihnachtsabend 1837 die Gedichte vor. Die Dichtungen sind (vermutlich) nicht mehr erhalten.
Karl Marx fuhr im Frühjahr 1838 nach Trier, weil nach Aussage von Ludwig von Westphalen Heinrich Marx daniederlag „an einem schlimmen schwer zu heilenden Gichthusten, den er ganz vernachlässigte, woran er schon über ein Jahr laboriert.“ 24Wie schlimm es um den starken, schweren Mann stand, erkannte niemand, da sogar der behandelnde Arzt Hoffnung auf Heilung äußerte. Drei Tage nach des Sohnes Abreise, am 10. Mai 1838, starb Heinrich Marx. Tröstlicherweise hinterließ er seiner Witwe und den unmündigen Kindern ein ansehnliches Vermögen. Das Aktivvermögen betrug 22.110 Taler, wovon allerdings 13.100 Taler von Henriette Marx mit in die Ehe gebracht worden waren. Abzüglich der Passiv-Masse konnten ca. 9.000 Taler unter der Mutter und den sieben Kindern verteilt werden. Der Mutter stand die Hälfte zu und nach ihrem Ehevertrag vom 21. November 1814 zudem ein Viertel „eigen-thümlich“ und ein Viertel „niesbräuchlich“. Jedes Kind erbte 482 Taler, wie in einer Urkunde vom 23. Juni 1841 festgehalten wurde. Auch Sohn Karl unterschrieb diese Berechnung. Er musste sich keine Sorgen um die weitere Finanzierung seines Studiums machen. „Lieber Carl, hierbey empfangs du die Summe von 160 thaller welche du zu promowiren brauchst“ 25, beruhigte ihn die Mutter im Oktober 1838. Der Herr Sohn ließ sich Zeit und so zahlte die Mutter vermutlich nicht nur einmal.
Heinrich Marx hatte seit Beginn der Liebesbeziehung manche Differenz abschwächen, manches Missverständnis beseitigen können. Nach seinem´ Tode prallten Jennys und Karls Meinungsverschiedenheiten aufeinander, wie ein Brief der Braut vom Mai 1838 zeigt. Jenny an Karl: „Ich war still, mein Herz hörte auf zu schlagen; da Fühltest Du was Du gethan und batest um Verzeihung. Das konntest Du in Augenblicken der höchsten Liebe, was kann ich erwarten, wenn sie einst erkaltet sein wird. Sieh Karl, das ist ein Gedanke der Hölle in sich schließt. Ihn nähren wäre Selbstmord und dazu muß es noch schlimmer kommen. Verzeih, daß ich das geschrieben, aber zuweilen durchzuckt mich noch jetzt der Schmerz. Es war der 3te Mai, dem 7ten reistest Du, am 10ten war Er nicht mehr da. Es war zuviel. Das war Vorgefühl des Todes … das zweite Mal wär es mein Tod.// Karl, daß Du mir sagen konntest, ich sei ein gemeines Mädchen, daß Du es mir in jener Zeit sagen konntest, war nicht recht. Ich bin Dir nicht böse deshalb. Du hast ja vielleicht recht; aber es thut so weh …Weißt Du noch, wie ich im Anfang immer sagte, ja ich habe Dich lieb, wie ich mich nie zu dem Wort lieben entschließen konnte? In dem haben liegt noch ein bischen Freundschaft, Bruderliebe, damit wollte ich es beschönigen. … Dich lieb’ ich. Verstehst Du mich, wie ich das meine? Es beleidigt Dich doch nicht? Ich sinne hin und her ob ich in meinem letzten Brief nichts kränkendes gesagt! Ich kanns nicht finden und dann wars auch nicht Absicht; die wars aber auch damals nicht, so wahr ein Gott lebt, aber ich war so beleidigt, so aufgeregt und du weißt ja wie eitel ich bin und Karl verzeih mir nur dies eine Mal noch, verbrenne den Brief und vergiß ihn. … Wenn Du nur wohl bist, einziges, einziges Herzchen.“ 26Mit „Augenblicken der höchsten Liebe“ waren vermutlich die innigen Gefühle nach der langen Trennung gemeint, nicht mehr. Als „gemeines Mädchen“ bezeichnet zu werden, hatte Jenny tief getroffen und offen gestand sie, nicht die Kraft zu haben, eine solche Situation ein zweites Mal durchzustehen: „es (wär) mein Tod“. Sie übertrieb sicherlich, aber sie fühlte nach dem Tode von Heinrich Marx alles „so trübe, so unheilverkündend, die ganze Zukunft so dunkel, kein freundliches Bild lächelt mir entgegen, keine einzige frohe Aussicht. … jeder Tag, jeder Augenblick mahnt mich daran, … daß er nicht mehr unter uns ist, der Herrliche, der unsre Liebe gesegnet, daß er keine segnenden, belebenden Sonnenstrahlen mehr in die Dunkelheit der Gegenwart hineinfressen kann, daß er uns für ewig entrissen, für ewig dahin ist.“ 27Jenny von Westphalen trauerte um einen Menschen, der stets zu ihr gehalten hatte, sogar gegen den eigenen Sohn. Sie ahnte den unermesslichen Verlust, als sie schrieb: „Er sprach herrliche köstliche Worte, goldne Lehren in mein Herz, sprach zu mir mit einer Liebe einer Herzlichkeit, einer Innigkeit, deren nur ein so reiches Gemüht, wie das seinige, fähig ist. Mein Herz hat sie ihm treu erwidert, diese Liebe, wird sie ihm ewig bewahren! – Es gibt eine Liebe, die unendlich ist, und diese gehört ihm. … Verzeihe, Karl, diese Ausbrüche des Schmerzes, verzeihe, daß ich so lange bei dem ewig unvergeßlichen, hochheiligen Gegenstande Deiner und unser aller Trauer verweilte. Ich sende Dir hierbei einige Haare von dem Teuren, es ist das letzte, was uns von seiner äußern Hülle übrig geblieben. Kummer und Sorge haben sie gebleicht. Ich habe sie mit meinen Küssen bedeckt, mit meinen Tränen benetzt. Möchten sie Dir ein Talisman durch dieses (L)eben werden.“ 28Die Haare des Vaters hat Sohn Karl ein Leben lang aufbewahrt.
Читать дальше