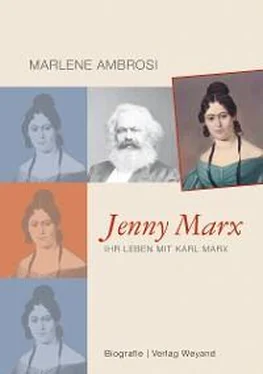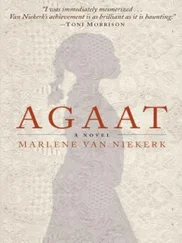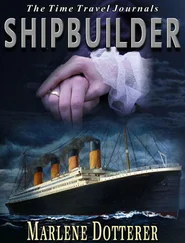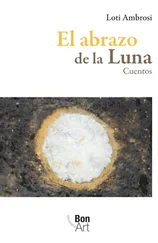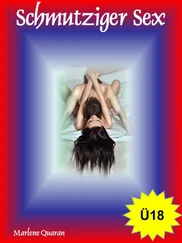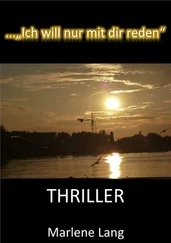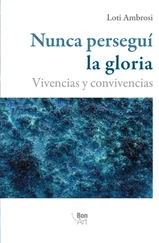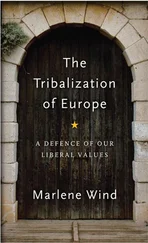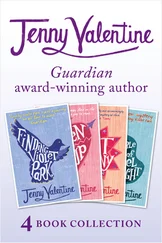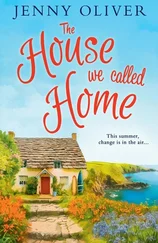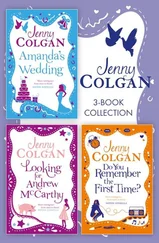1Jacobs, Existenz und Untergang der alten Judengemeinde der Stadt Trier, S.23
2Blumenberg, Karl Marx mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, S.26
3Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.514
4Raddatz, Karl Marx, S.41
5Gemkow, Edgar von Westphalen, S.415/416
6MEGA III,1 Heinrich Marx an Karl Marx am 28.12.1836
7MEGA III,1 Sophie Marx an Karl Marx am 28.12.1836, Anlage zum Brief von Heinrich Marx am 28.12.1836
8MEGA I,1 Buch der Liebe, Erster Teil, S.487
9MEGA I,1 Buch der Lieder, S.607
10MEGA III,1 Heinrich Marx an Karl Marx am 2.3.1837
11MEGA III,1 Heinrich Marx an Karl Marx am 2.3.1837
12MEGA III,1 Heinrich Marx an Karl Marx am 2.3.1837
13MEGA III,1 Heinrich Marx an Karl Marx am 2.3.1837
14MEGA III,1 Heinrich Marx an Karl Marx am 2.3.1837
Als Verlobte grüßen eine Adlige und ein junger Student
Frühjahr 1837
Jenny von Westphalen zeigte Mut, als sie sich für Karl Marx entschied. Vielleicht gefiel es ihr, der sich so überlegen fühlenden Denkerin, einen gesellschaftlich revolutionären Schritt zu gehen, aber ihre Entscheidung war ausschließlich in ihrer Liebe zu Karl Marx begründet. Um an seiner Seite leben zu können, war sie bereit, gegen alles und alle zu kämpfen. Einwänden bezüglich des Standesunterschiedes und des Verlustes ihrer Standesprivilegien verschloss sie sich. Dieser Mann hatte für sie eine glänzende Zukunft vor sich als Wissenschaftler oder Politiker, an seiner Seite stand ihr die Welt offen. Nur für ihn vollzog sie den radikalen Schnitt: Es war ihre Revolution, die Revolution einer starken, liebenden Frau.
Obwohl sich Jenny nicht zur Trennung von Pannewitz geäußert hat, wird sie den Vergleich angestellt haben: Was hatte Karl Marx, was Pannewitz nicht hatte? Der Leutnant hatte zunächst imponiert durch zackiges Auftreten in schmucker Uniform und gute Manieren. Seine vaterländischen Floskeln hatten sich allerdings mit der Zeit immer schaler angehört. Unerträglich fand Jenny auf die Dauer seine geistige Armut, und verglich sie ihn mit Karl Marx, kam sie zu dem Schluss, dass dieser, obwohl nur halb so alt, über mehr Geist und Argumentationsvermögen verfügte als der Adlige. Der Student Karl war zwar noch ungelenk im gesellschaftlichen Umgang und verhöhnte übertriebene Etikette, aber er war Jenny vertraut seit Kindertagen und wirkte durch seine Gelassenheit beruhigend auf sie. Von ihm fühlte sie sich ernst genommen, er hörte ihr zu, griff ihre Ideen und Argumente auf, machte ihr keine Vorhaltungen, dass politische und soziale Themen ausschließlich Männersache seien. Für ihn war sie kein schmückendes Beiwerk, sondern eine gleichberechtigte Partnerin.

Jenny von Westphalen
Im Frühjahr 1837 reiste Karl Marx nach Trier. Sein Vater feierte am 15. April seinen 60. Geburtstag, und Sohn Karl überreichte persönlich sein Geschenk „Gedichte, meinem Vater zu seinem Geburtstag 1837“. Er hatte sich in allen Sparten der Literatur versucht, in Sonetten, Epigrammen, im Trauerspiel und im Roman. Während dieses Aufenthaltes machte der knapp 19-Jährige seine Aufwartung bei Ludwig von Westphalen, vielleicht am 30. April, dem Tage der Silbernen Hochzeit von Jennys Eltern. Mit welchen Worten er um die Hand der Geliebten anhielt, ist nicht überliefert, aber Vater von Westphalen freute sich bei Ferdinand über den „herrlichen, herrlichen, vierten Sohn“, den „bewunderswerthen Sohn“ 1, der seine Tochter glücklich mache. Er schätze sich „u. uns alle unaussprechlich glücklich ..., daß sie mir und uns allen einen so treflichen, edelen, seltenen Sohn u. Bruder als ihr Eigenthum zu erwerben wusste – ein Kleinod, worauf sie stolz seyn kann und was auch die edlere Welt, nur nie und nimmer die gemeine, kleinstädtische Triersche, worin wir leben, billigen und keineswegs tadeln würde.“ 2Das Kleinliche traf nicht nur auf die Kleinstädter, die einfachen Gemüter zu, sondern auch auf die adlige Verwandtschaft und die eigene Familie. Der Vater hatte für seine „Person nicht den geringsten Zweifel mehr an der Güte ihrer Wahl, da ich Beide für einander geschaffen erachte, u. daß sie ein sehr, sehr glückliches Ehepaar, wenn auch erst nach 5 ja nach mehr Jahren u. per pot discrimina rerum, die seiner Seits noch zu überwältigen bleiben werden – dem wahren Segen unsres Hauses noch die Krone aufsetzend.“ 3Dass aufgrund dieser Heirat die Familie von Westphalen in die Annalen der Geschichte einging, sie durch Karl Marx die Krone aufgesetzt bekam, lag damals nicht einmal im Bereich des Vorstellbaren. Trotz aller Freudebeteuerung seinem ältesten Sohn gegenüber gab Ludwig von Westphalen mit gemischten Gefühlen seine Einwilligung. Die zukünftigen Schwiegereltern liebten Karl Marx durchaus, kannten seine Begabungen und Fähigkeiten und konnten die Faszination, die dieser junge, gut aussehende Mann mit den dunklen Augen und schwarzen Locken auf ihre Tochter ausübte, nachvollziehen; aber Karls oppositionelle Haltung, seine Kompromisslosigkeit und seine Weigerung, sich anzupassen und sich gegen seine überzeugung verbiegen zu lassen, war zumindest Ludwig von Westphalen nicht verborgen geblieben. Er wusste um Karls kritische Einstellung, hatte er doch über Jahre hinweg als Mentor diese Entwicklung gewollt-ungewollt gefördert. Belastend war, dass der Bräutigam noch studierte und Bruder Ferdinand von dem „ewigen Studenten“ sprach, der keine Ambitionen zeige, sich auf ein Amt im Staatsdienst vorzubereiten, die einzig akzeptable Zukunftsperspektive aus seiner Sicht. Jenny war überglücklich, dass die Eltern ihr Einverständnis gegeben hatten. Endlich konnte sie sich mit ihrem Traummann Karl präsentieren und stolz ihren Verlobungsring zeigen. Ein großes Verlobungsfest wird man nicht gefeiert haben. Die Eltern haben die sehr ungewöhnliche Verbindung vermutlich nicht offiziell verkündet. Das hätten Ferdinand und die in Trier ansässigen Florencourts als höchst unpassend empfunden. „Ueber ihr Verhältnis erfahre ich von ihr selbst nichts, da ich mit ihr darüber nicht spreche, u. sie auch keine Veranlassung dazu giebt“ 4, brachte Ferdinand die Kommunikation mit seiner jüngeren Halbschwester zu diesem Thema auf den Punkt.
Jenny von Westphalen war erleichtert, dass die Heimlichkeiten ein Ende gefunden hatten, aber die Verlobung hatte an den äußeren Umständen nichts geändert. Karl war noch Student, lebte in Berlin, hatte sich noch nicht auf eine berufliche Richtung festgelegt und ihr blieb nur Warten im väterlichen Hause in Trier.
1Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.517
2Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.519
3Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.519
4Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.516
Warten in Trier – Selbstfindung in Berlin
Die Jahre 1837 bis 1842
Karl Marx hatte größte Schwierigkeiten mit sich selbst und seiner Zukunftsplanung. Nach dem Wechsel an die Universität in Berlin erkannte er, dass er nicht den juristischen Berufsweg einschlagen wollte, aber er zögerte, dies dem Vater mitzuteilen. Heinrich Marx konnte dem Sohn manches vorwerfen, jedoch nicht Faulheit oder Nichtstun. Im Gegenteil: Karl widmete sich so eifrig den Fächern, die er nicht studieren sollte, dass der Vater sich Sorgen um seine Gesundheit machte. „Ein siecher Gelehrter ist das unglücklichste Wesen auf Erden“ 1, warnte er. Das war nicht das Einzige, was ihm Sorgen bereitete. Er beobachtete bei seinem Sohn einen Charakterzug, den Jenny noch nicht erkannte. Immer deutlicher kristallisierte sich nämlich heraus, dass Karl Marx mit Geld nicht verantwortungsvoll umgehen konnte. „Soviel sah ich, daß Du Geld brauchst, und deswegen habe ich Dir 50 Thaler geschickt. Das macht mit dem was Du mitgenommen immer 160 Thaler. … Lieber Karl, ich wiederhole Dir, daß ich alles recht gerne thue, daß ich aber als Vater von vielen Kindern – und Du weist recht gut, ich bin nicht reich – nicht mehr thun will, als zu Deinem Wohl und Fortkommen nothwendig ist“ 2, ermahnte Heinrich Marx seinen Sohn; denn wie er die Beträge aufbrachte, kümmerte den Sprössling nicht. Im Mai 1836 erhielt der Sohn weitere 100 Taler, im November 50 Taler. Trotz Aufforderung schien er ein Jahr später noch immer keinen überblick über seine Ausgaben zu haben. „Als wären wir Goldmännchen, verfügt der Herr Sohn in einem Jahre für beynahe 700 Thaler gegen jede Abrede, gegen alle Gebräuche, während die Reichsten keine 500 ausgeben. Und warum? Ich lasse ihm die Gerechtigkeit widerfahren, daß er kein Prasser, kein Verschwender ist. Aber wie kann ein Mann, der alle 8 oder 14 Tage neue Systeme erfinden, und die alten mühsam erwirkten Arbeiten zerreißen muß, wie kann der, frage ich, sich mit Kleinigkeiten abgeben?“ 3, schrieb der erboste Vater, der es dennoch nicht übers Herz brachte, seinen Sohn mittellos leben zu lassen. Studiosus Karl brauchte doch Geld für Wein, Bier, Tabak und Essen, für Papier, Tinte, Wohnung und Kerzen. Jenny erfuhr von diesen innerfamiliären Problemen wenig, und sie interessierte sich auch nicht für Marx’sche Geldangelegenheiten.
Читать дальше