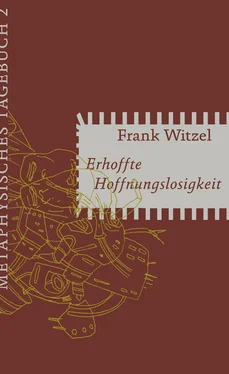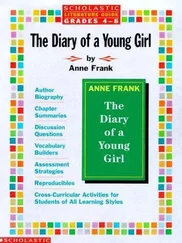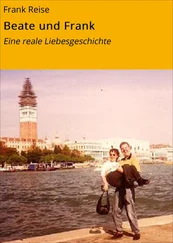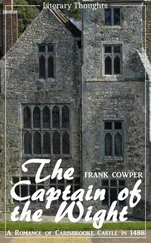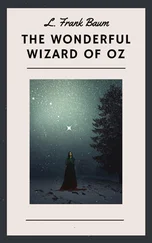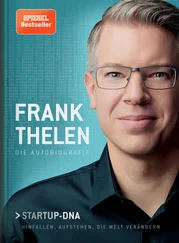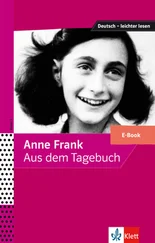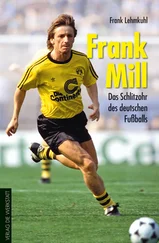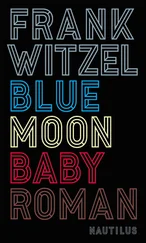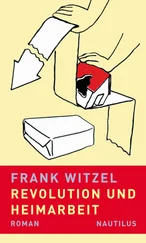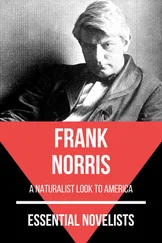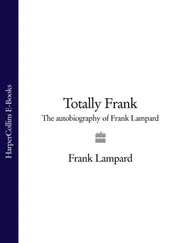Das Für-sich-Verrücktsein ist also tatsächlich ein Verrücktwerden, da sich allein im Werden die Verrückung noch von mir selbst wahrnehmen lässt. Dort, wo ich verrückt bin, es keinen Zweifel, keine Distanz mehr gibt, bin ich nicht wirklich verrückt, exzentrisch außerhalb eines vermeintlichen Zentrums der Normalität, sondern lediglich in einem anderen, neuen Zentrum angelangt, so wahnhaft angelegt dieses Zentrum auch sein mag.
Bei diesem zuletzt beschriebenen Zustand handelt es sich um das An-sich-Verrücktsein. Im An-sich-Verrücktsein gleiche ich dem Ding ohne Bewusstsein. Das Verrücktsein kann nicht mehr von mir selbst als Für-sich-Verrücktsein, sondern nur noch von außen als An-sich-Verrücktsein wahrgenommen werden. Der Zustand des An-sich-Verrücktseins entspricht einem Gefängnis, in dem ich gefangen bin, so wie die Dinge in ihrer Dinglichkeit gefangen sind.
Ich könnte im Zustand des An-sich-Verrücktseins folgende Vorstellung entwickeln: Um mein Gefängnis der Dinghaftigkeit zu verlassen, sollte ich vom Zustand des An-sich-Verrücktseins in den des Für-andere-Verrücktseins wechseln. Ähnlich dem Hammer, von dem es theoretisch vorstellbar ist, er könnte die Idee entwickeln, seiner Dinghaftigkeit zu entkommen, indem er den ihm zugewiesenen Gebrauchswert akzeptiert und nicht nur (unbewusst) an sich Hammer ist, sondern (bewusst) für andere, könnte ich versuchen, für andere verrückt zu sein. Mein Für-andere-(Verrückt)-Sein wäre allerdings ein schaler Kompromiss, weil ich nicht mehr für mich sein kann und nicht länger an sich sein will. Ich würde diesen Kompromiss eingehen, um mit meiner Umwelt zu kommunizieren, würde aber dabei genau das einbüßen, was ich kommunizieren wollte. Heißt das, der Wahnsinn wird immer auf eine gewisse Weise dargestellt? Oder heißt es sogar, dass der Wahnsinn in manchen Fällen erst durch diese Pattsituation innerhalb der Kommunikation entsteht?
Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen einem Gegenstand und einem Verrückten im Verhältnis zum anderen: Der Hammer wird gebraucht, der Verrückte wird behandelt. Der Gebrauch des Hammers gilt nicht dem Hammer selbst. Der Hammer ist nur zweckgebundenes Werkzeug und tritt in seinem An-sich-Sein erst dann in Erscheinung, wenn er nicht mehr funktioniert. Die Behandlung des Verrückten setzt jedoch dessen Nicht-Funktionieren in seinem Für-andere-Sein voraus. Könnte man daraus schließen, dass analog zum Nicht-Funktionieren des Werkzeugs oder Gegenstands das »Funktionieren« des Verrückten dessen An-sich-Sein hervorrufen könnte?
Eben nicht. Das An-sich-Sein ist ja der Zustand des Verrücktseins, dem der Verrückte durch das Für-andere-Sein in der Behandlung zu entkommen glaubt. Bleibt er im Für-andere-Sein und wird dieses Für-andere-Sein bereits als Heilungserfolg angesehen, weil er den Zustand der Dinglichkeit annimmt, so entwickelt er eine Art Hospitalismus und wird unfähig, das Für-andere-Sein abzulegen und die Anstalt zu verlassen. Da im Für-sich-Sein das Verrücktsein nur in seiner Form des Verrücktwerdens existiert, müsste der Verrückte in diesen Zustand zurückkehren, um in einer negativen Form des Werdens, dem Vergehen, genauer dem »Verrückt-Vergehen«, wieder für sich sein zu können. Das würde bedeuten, dass dem Verrücktsein nur zu entkommen ist, wenn ich mich auf das Verrücktwerden und Verrücktvergehen einlasse, keinerlei »Normalität«, kein Außerhalb, mehr anstrebe, sondern mich in dieser Bewegung des Werdens und Vergehens bewusst aufhalte.
Man könnte diese zyklische Bewegung, ähnlich der Bewegung von Ebbe und Flut, mit dem Weil’schen Begriff der »Entschaffung« (décreation) bezeichnen: eine Entschaffung der Normalität, die von einer Entschaffung des An-sich-Verrücktseins abgelöst wird. Nur wenn ich bereit bin, verrückt zu werden und verrückt zu vergehen, um erneut verrückt zu werden und wieder verrückt zu vergehen und immer so weiter, kann ich für mich sein. Es ist ein Vorgang wie das Atmen, eine beständige Entschaffung, somit eine beständige Ruhelosigkeit.
Deshalb kann ich im Verrücktwerden, auch wenn ich den Zustand des Verrücktseins fürchte, ihn besonders fürchte, weil ich in ihm tatsächlich nicht mehr bewusst sein werde, ihn gleichzeitig herbeisehnen, weil sich im Verrücktsein die Ruhelosigkeit aufhebt, ich nicht länger werde und vergehe, sondern wieder sein kann, auch wenn ich im An-sich-Sein nichts mehr bewusst von diesem Sein erfahre.
Ist nur das bewusst Erfahrene eine Erfahrung?
Das Verrücktwerden ist vielleicht nur deshalb bedrohlich, weil das Werden generell als ein zu überwindender Zustand angesehen wird, dessen Dauerhaftigkeit mich in Unruhe versetzt, vor allem dann in Unruhe versetzt, wenn ich nicht weiß, wohin dieses Werden führt, dieses Werden mir zudem unnütz erscheint, da es unmittelbar vom Vergehen »entschaffen« wird.
Wenn diese Aufzeichnungen so klingen, als sei ich verrückt geworden, so mag das einerseits stimmen, gemäß dem landläufigen Gebrauch dieses Begriffs. Aber das Verstiegene, Obskure, Arkane dieser Aufzeichnungen ist allein dem Versuch geschuldet, eine Form der Darstellung des Nicht-Darstellbaren zu finden. Es mag natürlich dennoch in gewisser Weise stimmen, dass ich mithilfe eines philosophischen Vokabulars Theorien konstruiere, die weder Hand noch Fuß haben. Leicht könnte mir ein Psychiater nachweisen, dass ich von Verrücktsein und Wahnsinn keine Ahnung habe. Und ich würde ihm sofort zustimmen, nicht nur, weil nach meiner Theorie der Wahnsinnige in seinem An-sich-Verrücktsein nichts von seinem Wahnsinn weiß, sondern weil ich wirklich keine, wirklich nicht die geringste Ahnung vom Wahnsinn habe. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ich selbst diese Aufzeichnungen zu einem anderen Zeitpunkt als im herkömmlichen Sinne »verrückt« (auch im Sinne von »bekloppt«) ansehen werde. Dennoch habe ich sie geschrieben und dennoch meine ich, auch wenn ich mich irre, dass dieses Schreiben, vielmehr dieses Reflektieren über meinen Zustand, gleichgültig, ob ich mich über diesen Zustand im Irrtum befinde oder nicht, etwas ausdrückt oder versucht, sich einem Ausdruck anzunähern. Und wenn diese Aufzeichnung über meine momentane »Rettung« hinaus nur eins bewirkt, nämlich aufzuzeigen, dass es Zustände gibt, die sprachlich schwer oder gar nicht zu fassen sind.
Es ist vielleicht vergleichbar mit den Visionen eines Mystikers, die der Kurie zur Bewertung vorgelegt werden. Letztlich können die Mitglieder des Ausschusses nur entscheiden, ob sich diese Zeugnisse noch innerhalb der Lehre befinden. Über die Qualität der Offenbarung aber können sie kein Urteil fällen.
Für mich ist die Qualität oder der Gehalt dieser Aufzeichnungen nicht entscheidend, da sie ihren Wert für mich im Vorgang des Aufschreibens selbst haben. Öffnet sich hier vielleicht eine Tür zu einer anderen Möglichkeit, Kunst und Literatur zu begreifen, indem das Geschriebene nicht länger primär wegen seiner Aussage gelesen wird, sondern als abgelegtes Zeugnis für eine Erfahrung? Eine Gratwanderung, denn es könnte natürlich auch dem Phänomen des dilettantischen Aquarellierens ähnlich sein, bei dem während des Malens alles so wunderbar ineinanderfließt und so enttäuschend aussieht, sobald das Blatt getrocknet ist.
»Die Verunsicherung des Werdens«: ein schöner Titel, dessen Geschmeidigkeit allerdings die existenzielle Dramatik verbirgt. Letztlich verbirgt Sprache immer die Dramatik des Seins, weil der, der spricht, so tut, als habe er etwas überwunden. Aber auch wenn er es nicht »wirklich« überwunden, das heißt bewältigt, hat, so hat er es auf eine bestimmte Weise doch überwunden, indem er darüber spricht. Das Darüber-Sprechen zeigt diese »Überwindung« an, nicht der Inhalt dessen, was gesagt wird. So habe ich mich gestern mit der Erzählung meines Zustands aus diesem Zustand selbst befreit, letztlich, weil mir der Glaube (im Sinne von »Vertrauen«) fehlte, der Glaube, der mich hätte schweigen und damit sein lassen.
Читать дальше