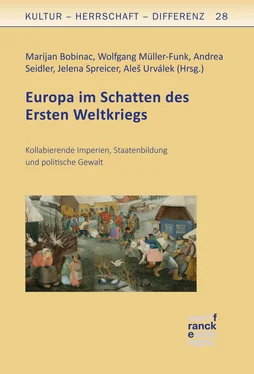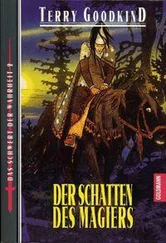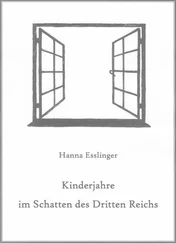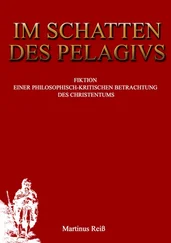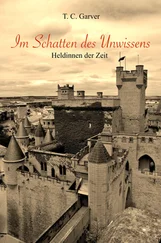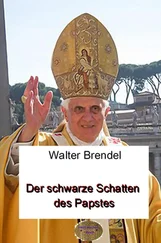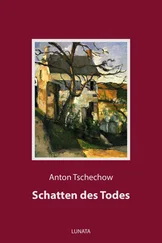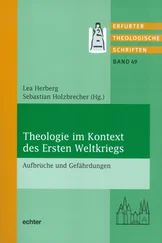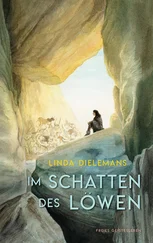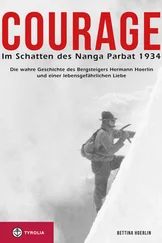Der ‚Komplex‘ Sladek funktioniert auch hier etwas anders. Im Stück wird Sladek dreimal mit Frauen konfrontiert, mit der älteren Anna, einer selbständigen Frau und Soldatenwitwe, mit dem Fräulein an der Bar im Restaurant und mit Lotte in der elften und letzten Szene des Stückes.
Im Falle von Anna tritt Sladeks Unselbständigkeit auf mehreren Ebenen zutage. Der sozial und ökonomisch pauperisierte, arbeitslose, gestrandete Mann bedarf der Frau als Einkommensquelle, dadurch verstärkt sich indes seine Marginalisierung, ist er nun doch von der tief verachteten Frau abhängig. Daraus erklärt sich auch die tiefe Ambivalenz Sladeks gegenüber Anna, der er dankbar sein muss und die er dafür hasst, eben weil er sie braucht.
Ich kam zu dir zerlumpt. Bei mir in der Familie haben sie sich um ein Stück Brot gehaßt. Du warst für mich ein höheres Wesen, du hattest eine Zweizimmerwohnung und hast Kriegsanleihen gezeichnet. Du hast für Kaufmannsfrauen geschneidert, ich hab mich waschen können. Du hast mir einen Wintermantel gekauft. Danke.15
Und in der dritten Szene, wenn sich Sladek kurz vor der Ermordung von Anna, dem Fräulein im Restaurant erotisch annähern will, schildert er der fremden anderen Frau sein Verhältnis mit Anna:
Sie hat es gewußt, daß sie nur winseln muß und ich verlier die Kraft. Weil ich ein anständiger Mensch bin, zu guter Letzt. […] Ich hab noch nie richtig gearbeitet. Sie hat es nicht gern gesehen, daß ich was verdien. Sie hatte Angst, ich könnte ohne sie leben. Sie hat mich lieber ausgehalten, das ist das berühmte mütterliche Gefühl.16
Die harten Männer, die Soldaten der Armeen, die den Krieg verloren haben, stehen nach ihrer Rückkehr auf wackligen Beinen. Ihre berufliche Grundlage, ihre Ausbildung, ihre Lebenspläne haben sich in Luft aufgelöst. Der Krieg zeitigt völlig unbeabsichtigte und unabsehbare Folgen. Die Frauen, die zu Hause geblieben sind, haben sich eine ökonomische Basis geschaffen und sind, vielleicht zum ersten Mal, unabhängig vom andern Geschlecht. Während sie sich recht oder schlecht – es sind Krisenzeiten – in der Welt bewähren, stehen die Männer abseits und den Frauen, deren Schwäche sie doch so verachten, unterlegen, geschlechtlich marginalisiert. Diese Situation schildert Horváth in Geschichten aus dem Wiener Wald und Roth in Die Rebellion . Auch dort sind es geschäftstüchtige Frauen, die Männer, Kriegsheimkehrer und durch den Krieg bodenlos gewordene Existenzen unterhalten und ihr Superioritätsgefühl bis zu einem gewissen Grade auch auskosten. Dem melancholisch erfahrenen marginalisierten Zustand der Heimkehr-Männer steht eine weibliche Tüchtigkeit gegenüber, die sich mit der drohenden Marginalisierung nicht abfinden will.
Anna ist Sladek zudem an Lebenserfahrung, und dazu gehört wohl auch die Sexualität, überlegen, sie ist seine zweite Mama, lacanianisch gesprochen die phallische Frau, was sie auch in poetische Formeln gießt: „[…] Du kleiner Riese. Du bleibst, du bleibst. Du Jung, du – es ist kalt, die Erde ist kalt, aber die Sonne war schon warm. Das ist der zunehmende Mond.“17 Im Bild des kleinen, hilflosen Mannes nach 1918 ist dessen Situation auf den Punkt gebracht. Aufschlussreich ist die anschließende Kuss-Szene. Die Frau ist empört, weil der Mann ihr den Kuss einigermaßen gewaltsam verweigert, um sodann zu sagen: „Ich küß nicht gern so, so sinnlich.“18 Die emotionale Askese verträgt sich nicht mit einer Sinnlichkeit, in der sich der männliche Mann verlieren könnte, vor allem dann, wenn er beständig gegen die eigene Weichheit ankämpfen muss.
Das gilt auch für die Begegnung mit der stramm nationalistisch eingestellten Kellnerin im Restaurant. Diese Annäherung scheitert und damit auch der Versuch einer geglückten sexuellen Beziehung. Die Frau, die in diesen Kontexten auch als Betrügerin firmiert, bietet dem hilflosen und selbstverlorenen Sladek an, sich für einen stattlichen Betrag – es ist die Zeit der Inflation – auszuziehen:
SLADEK: Du hast so eine schöne Haut.
DAS FRÄULEIN: Ich bin auch ein Sonntagskind.
SLADEK: Ich nicht. – Du bist so weich.
DAS FRÄULEIN: Das hat jede Frau.
SLADEK: Nein, nicht jede.
DAS FRÄULEIN: Was der kleine Mann für große Augen hat. Schau mich an. Wohin schaust du denn?
SLADEK: Ich schau dich an.
DAS FRÄULEIN: Nein.
SLADEK: Doch.
DAS FRÄULEIN: Du schaust mich an und doch nicht an. Hinter mir ist nichts. Ich glaube, du findest den richtigen Kontakt zum Weibe nicht.19
Nachdem sie ihn geküsst und sich ausgezogen hat, meint die Frau selbstbewusst: „Du bist ein einsamer Mensch. Du mußt öfters kommen, sonst wirst du noch melancholisch. Das Weib ist die Krone der Schöpfung.“20 Anfänglich amüsiert sich die junge Frau ganz offenkundig lustig über den empfindsamen romantischen Mann ihr gegenüber, der enttäuschenderweise gar nichts Männlich-Zupackendes an sich hat, sondern sich in der Weichheit ihrer schönen Haut verliert. Am Ende macht sie indes eine überraschende und wohl auch zutreffende Entdeckung: Dieser Mensch, dieser Mann ist unfähig, eine konkrete Beziehung zu einer Frau einzugehen. Er schaut nicht sie an, sondern sieht etwas in ihr, das dahinter ist. Insofern geht diese sexuelle Annäherung ganz schief, Sladek kommt ihr nicht näher, sondern möchte sie vor allem aus der Ferne vollständig nackt betrachten können.
Soweit kommt es in der letzten Szene gar nicht, wenn Sladek, der nach dem gescheiterten Aufmarsch gegen die Republik nach „Nikaragua“ auswandern möchte (weil ihm, wie auch beim „Kap der guten Hoffnung“, der Name ausnehmend gut gefällt), nähert sich überaus schüchtern und ungeschickt einer jungen Frau, Lotte, und fragt sie, ob sie mit ihm Karussell fahren möchte und das Fremde mit seiner Einsamkeit begründet:
SLADEK: […] ich kenn nämlich keinen Menschen.
LOTTE: Sie sind hier fremd?
SLADEK: Sehr fremd.
LOTTE: Sind sie nicht Engländer?
SLADEK: Stimmt.21
Das ist einer dieser fetzenhaften und verwehten Dialoge in der Horváth-Welt, die die Weltverlorenheit der Menschen in den Pausen, das ein Schweigen der Worte ist, versinnbildlicht. Horváths Menschen bleiben dem Publikum rätselhaft fremd, so wie sich seine Figuren auf der Handlungsebene im Stück selbst und einander fremd bleiben. Es ist nicht ohne Ironie, dass Sladek die Frage der fremden jungen Frau, ob er ein Engländer sei, bejaht. Es ist pure Ironisierung des Umstandes seiner einsamen Existenz, die ihn in das politische Abenteuer und nun zum Auswandern veranlasst
5. Close Reading 2: Joseph Roths Das Spinnennetz
Den gleichen Zeitraum behandelt auch Joseph Roths erster Roman Das Spinnennetz , der zunächst, der Germanistik lange unbekannt, in der Wiener „Arbeiterzeitung“, dem Zentralorgan der österreichischen Sozialdemokratie erschien, dessen Handlung indes in Berlin angesiedelt ist, auch wenn mit der Familie Ephrussi/Efrussi eine Spur nach Wien gelegt wird. Wie im Sladek spielt hier das Thema männlicher Marginalität im Gefolge von Krieg und Inflation, sowie der Bekämpfung durch Rechtsradikalismus und die schwarze Reichswehr eine maßgebliche Rolle.
Roths Figur des Theodor Lohse ist freilich aus gänzlich anderem Holz geschnitzt als jene des Sladek, der sich in die völkische Welt ebenso verirrt wie in die der Frauen. Seine Ausgangssituation ist erbärmlich und unerfreulich. Sein männlicher Wert als Soldat, ja sogar als Leutnant des wilhelminischen Heeres, ist – wie die Geldwerte in der Inflation – auf ein Nichts zusammengeschrumpft. In der von Frauen, der Mutter und Schwestern, dominierten Nachkriegs-Familie, ist er ein geduldeter, nicht wohlgelittener Gast,1 was der Erzähler sarkastisch kommentiert:
Die Mutter kränkelte, die Schwestern gilbten, sie wurden alt und konnten es Theodor nicht verzeihen, daß er nicht seine Pflicht, als Leutnant und zweimal im Heeresbericht genannter Held zu fallen, erfüllt hatte. Ein toter Sohn wäre immer der Stolz der Familie geblieben. Ein abgerüsteter Leutnant und ein Opfer der Revolution war den Frauen lästig. Es lebte Theodor mit den Seinigen wie ein alter Großvater, den man geehrt hätte, wenn er tot gewesen wäre, den man geringschätzt, weil er am Leben bleibt.2
Читать дальше