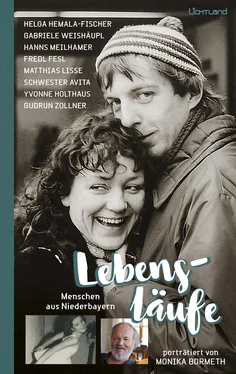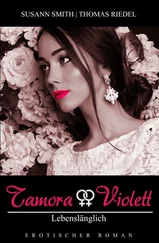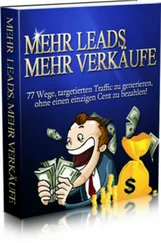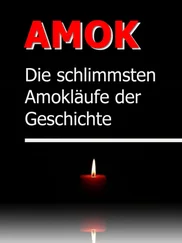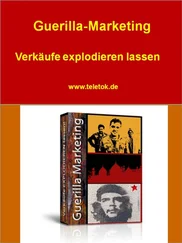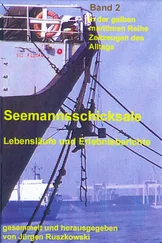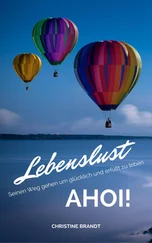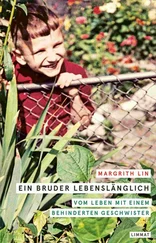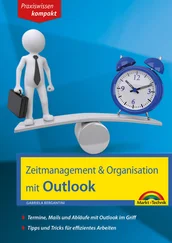„Wir hatten unter anderem einen Walzer einstudiert. Als die Musik erklang, habe ich alles um mich herum vergessen. Meine Arme sangen und meine Beine tanzten.“ Neun Mädchen aus Klagenfurt und neun aus Graz nahmen an der Reifeprüfung teil, nur fünf bestanden. Helga war dabei! Wieder waren es insbesondere ihre Armbewegungen, die überzeugten, wie sie später erfuhr.
Die Klagenfurter Choreographin Mracek fragte Helga daraufhin, ob sie nicht Tänzerin werden wolle. Eduard Hemala, der seine Tochter gerne in einem soliden, kaufmännischen Beruf gesehen hätte, war nicht begeistert. Erst die Tatsache, dass das Theater seinem Helgele sogar die volle Tänzerinnengage – nicht die Gage einer Elevin – anbot, überzeugte auch den Kaufmann in ihm. 1300 Schilling könnte seine Tochter in einem Büro nicht verdienen. Diese Monatsgage war mit einem Mal doch eine andere Hausnummer als die 15 Schilling, die es für eine Vorstellung von „Wiener Blut“ gegeben hatte. Am 28. Juli 1956 hielt Helga Hemala schließlich den Bühnendienstvertrag in Händen und verfasste den legendären Tagebucheintrag: „Nun darf ich tanzen, tanzen, TANZEN. Menschen Freude bereiten, das will ich.“
Einzig die Reaktion von Adi Fischer war eine große Enttäuschung. Er riet ihr von einer Bühnenkarriere ab – wohl im Wissen um die Herausforderungen, die einem solch ein Beruf abverlangt. Aber Helga vertraute ihrer Intuition: Am 1. September 1956 trat sie ihr Engagement als Tänzerin im Stadttheater Klagenfurt an. „Tanzen – sich zur Musik zu bewegen – das war einfach mein Traum.“
Die erste Operette, bei der sie unter Vertrag mitwirkte, war „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár. Margarete Hemala hat ihrer Tochter damals einen kleinen Teddybären als Glücksbringer auf den Schminktisch gestellt. Helga hat diesen über Jahrzehnte zu jeder Vorstellung mitgenommen. Es gibt ihn noch heute.

Der „Opernball“ – eines von vielen prunkvoll inszenierten Stücken am Theater an der Rott. Helga Hemala-Fischer choreografierte zahlreiche Werke.
Es blieb nicht bei Klagenfurt. Intendant Professor Klingenbeck hatte mittlerweile das Angebot erhalten, das Salzburger Landestheater zu übernehmen. Er bot Helga Hemala an, mit ihm zu kommen. Trotz ihrer Zweifel, ob sie wohl mit anderen Profitänzerinnen Schritt halten könne, sagte sie zu. Nicht zuletzt weil auch Adi Fischer als Operettenbuffo für Salzburg engagiert wurde. Ab August 1957 war sie dann Tänzerin und Schauspielerin unter Vertrag.
Professor Klingenbeck sah großes Potenzial in Helga Hemala und förderte sie stetig. Adi Fischer nahm seine junge Kollegin weiterhin als sympathisches Mädchen wahr. Mehr vorerst nicht. Seine Ehe war zu diesem Zeitpunkt zwar schon ins Wanken geraten, allerdings nicht Helgas wegen. „Er hat das Leben genossen“, resümiert Helga Hemala-Fischer, die durchaus zugeben muss, dass ihr Liebster ein „Don Juan“ war. Verurteilt hat sie sein Verhalten, trotz vieler Tränen, nie. Weder damals als schwärmender Teenager noch heute als Witwe nach über 50 Jahren Ehe. „Man kann den Charakter eines Menschen nicht ändern“, sagt sie nachdenklich. Der Krieg habe ihrem Mann, Jahrgang 1930, die Jugend genommen. Er habe leben wollen, einfach nur leben: „Und er hat sich keine Gelegenheit dazu entgehen lassen.“
Das erste Balletttraining in Salzburg hat Helga Hemala-Fischer noch vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Obwohl sie ihr Bestes gab, konnte sie mit den erfahrenen Profitänzerinnen, einige kamen von der Ballettakademie in Wien, tatsächlich nicht Schritt halten. Nach der Probe nahm die Ballettmeisterin Professor Dr. Hanna Kammer sie beiseite und fragte: „Mädele, willste nicht oder kannste nicht?“ Ein Urteil, das mitten ins Herz traf. Was tun? Als die Tränen getrocknet waren, suchte Helga sich Hilfe. Bereits am nächsten Tag stand sie bei dem jugoslawischen Solotänzer Boris Tonin zum Privatunterricht an der Ballettstange. Das war nicht immer leicht. Als sie einmal schwer erkältet den Privatunterricht absagen wollte, entgegnete Boris Tonin ungerührt: „Du müssen schwitzen, du werden gesund.“ Es dauerte ein Jahr, dann hatte sie es geschafft: Nicht nur, dass sie von nun an mit den anderen Tänzerinnen mithalten konnte, sie durfte sogar immer wieder als Solistin auftreten.
Helga war keine 19 Jahre alt, als der Direktor noch mehr als den Tanz in ihr sah. In Schauspiel und Märchen hatte er sie bereits eingesetzt. Helga durfte einige Rollen spielen und war dabei positiv aufgefallen. Ende September 1958 bat er sie um ein Vorsingen. Die junge Tänzerin sollte Soubrette werden. Das bedeutete, künftig nicht nur zu tanzen, sondern auch zu singen und zu spielen. Fritz Klingenbeck bezuschusste ihren Gesangsunterricht am Mozarteum. Am 18. Juni 1959 legte Helga die Prüfung für das neue Fach Soubrette ab. Von nun an war Adi Fischer ihr Spielpartner und Regisseur. Ihre erste Operette als Tanzsoubrette, „Die Csárdásfürstin“, ging 35 Mal vor begeistertem Publikum über die Bühne.
Nun erfüllte Helga sich auch ihren Kindheitswunsch, ein Musikinstrument zu lernen, und nahm Klavierunterricht.
Ihre Karriere entwickelte sich stetig weiter. Die erste Anfrage fürs Fernsehen kam noch im selben Jahr. Man suchte eine Besetzung für die Rolle der Ida in der Verfilmung der Strauss-Operette „Die Fledermaus“. Als Helga Hemala-Fischer bei dem bekannten Regisseur Kurt Wilhelm in München vorsprach, erfuhr sie zum ersten Mal, dass in der Branche manchmal Dinge gefordert wurden, die ihr fremd waren. Der Regisseur bat sie um Fotos – freizügige Fotos. Helga Hemala lehnte augenblicklich ab. „Wenn das nötig ist, um zu Film oder Fernsehen zu kommen, verzichte ich gerne darauf.“ Ihre strikte Entschlossenheit schien Kurt Wilhelm zu imponieren. Sie bekam die Rolle ohne Fotos – und ohne dass jemals wieder etwas dieser Art von ihr verlangt wurde. „Natürlich braucht man auch ein wenig Glück, um im rechten Moment an die richtigen Menschen zu geraten, aber in jedem Fall wollte ich mit meiner Kunst und meinem Können die Bühne erobern.“
Es zeichneten sich weitere Veränderungen ab. Helgas Förderer, Professor Klingenbeck, hatte vor, das Theater zu verlassen, und der nächste Intendant zeigte wenig Interesse an Operetten. Daher beschloss Helga, sich an eine Agentur zu wenden. Zum Vorsingen fuhr sie in einem vollbesetzten Zug nach Wien – die ganze Fahrt ohne Sitzplatz mit einem Gipsbein. Kurz zuvor hatte sie in der Operette „Der Opernball“ (Helga spielte die Hosenrolle des „Henri“) einen folgenschweren Unfall. Die Handlung sah ein Stolpern über eine Treppe vor. Helga stolperte wirklich, fiel die lange Freitreppe herunter und blieb für einige Augenblicke reglos liegen. Der Kapellmeister war verunsichert, begann dann aber dennoch mit der Musik. Helga Hemala-Fischer rappelte sich auf und spielte die restliche Vorstellung zu Ende – wie ihr das gelang, kann sie heute nicht mehr sagen. Diagnose: Bänderriss. Der Direktor war verzweifelt: So schnell gab es keinen Ersatz. Er bat Helga trotz ihrer Schmerzen, noch zwei weitere Vorstellungen zu spielen, und sie tat es. Im Anschluss erst bekam sie den Gips, mit dem sie dann nach Wien zum Vorsingen fuhr. Dieses meisterte sie trotz widriger Umstände bravourös. Die diversen Theaterdirektoren, die bei der renommierten Agentur Starker zugegen waren, amüsierten sich köstlich über ihre „gipsbeinige“ Darbietung der „Riquette“ aus der Operette „Victoria und ihr Husar“: „Wenn Sie so tanzen, dann glauben wir Ihnen gerne, dass Sie eine Tanz-Soubrette sind.“ Zurück in Salzburg wurde es Helga auch während ihrer Genesungszeit nicht langweilig. Die Chefsekretärin war erkrankt und Helga sprang kurzerhand ein. Die Maschinenschreibkenntnisse aus der Handelsschule kamen ihr nun zugute.
Читать дальше