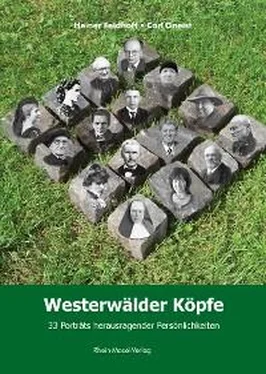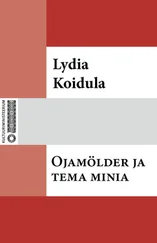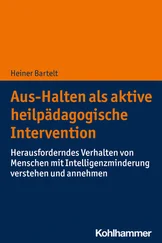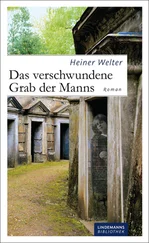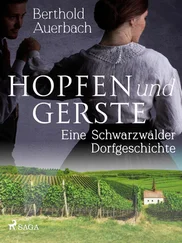Boden verliert dabei die Schutzlosen und Belasteten der Zwanziger Jahre nicht aus seinem fürsorglichen Blick. Der Kreis erwirbt zwei Villen und gestaltet sie als Kindergenesungsheim und Müttererholungsheim um. Schließlich wird auf Veranlassung des Landrats in Kirchen ein modernes katholisches Krankenhaus errichtet, das bis in die Jetztzeit seine Aufgaben erfüllt. Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 trifft vor allem den schwerindustriell geprägten Oberkreis hart. Die Arbeitslosigkeit steigt in ungeahnte Höhen, ein wesentlicher Grund für die Wahlerfolge der Nazis im Kreis. Viele verzweifelte Westerwälder wandern wieder einmal wie im 18. und 19. Jahrhundert nach Nord- und Südamerika aus. Engagiert stemmt sich Landrat Boden gegen die Stilllegung der Erzgruben mit Hunderten von Arbeitern. Wegen der »Grube Bindweide« richtete er sogar einen Appell an den Reichspräsidenten Hindenburg persönlich – vergeblich.
Die Machtergreifung der NSDAP bedeutet für Boden einen tiefen Riss in seinem sonst so makellosen Lebenslauf. Im Zuge der sogenannten »Gleichschaltung « wird er aus seinem Amt geworfen, wegen angeblicher Untreue wie viele andere Amtsträger angeklagt und in einem infamen, wochenlangen Schauprozess sogar zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Anders als viele andere der Verwaltungselite biedert sich Boden aber niemals bei den Nazis an. Es hilft ihm sicher, dass er tief in seinem katholischen Glauben verankert ist. Boden zieht sich für die zwölf dunklen Jahre des »Tausendjährigen Reiches« mit seiner Familie nach Köln zurück und arbeitet als Rechtsanwalt und Gutachter.
Nach dem katastrophalen Ende des Weltkrieges suchen die alliierten Besatzungsmächte händeringend nach unbelasteten Fachleuten für die Organisation des zerstörten Landes. Wilhelm Boden macht nun eine geradezu atemberaubende Karriere. Zuerst wird er 1945 von den Amerikanern per Federstrich wieder als Landrat des Kreises Altenkirchen eingesetzt, doch schon nach wenigen Wochen ernennen ihn die Franzosen, die diese Zone von den Amerikanern übernahmen, erst zum Oberpräsidenten, dann zum Regierungspräsidenten von Koblenz. Wieder einmal bestehen seine Aufgaben vorwiegend darin, die Wohnungsnot und den Hunger zu bekämpfen. 1947 heben ihn die Franzosen auch noch in das Amt des Ministerpräsidenten von »Rhéno-Palatin«, dem neu gegründeten Rheinland-Pfalz. Doch obwohl er dann die ersten demokratischen Parlamentswahlen gewinnt als Spitzenkandidat der auf den Trümmern der Zentrumspartei gegründeten CDU, gelingt es ihm nicht, eine neue Regierung zu bilden gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und auch seiner eigenen Partei. Das politische Revier der Strippenzieher und Fallensteller ist dem passionierten Jäger und Waldgänger Boden nicht sehr vertraut. Resigniert gibt er den Regierungsauftrag zurück und das Amt des Ministerpräsidenten auf. Seine letzten Berufsjahre verbringt er hochgeachtet und hochgeehrt mit dem Bundesverdienstkreuz als Chef der Landeszentralbank.
Die Glanzzeit seines Lebens aber waren die Jahre als junger Landrat in Altenkirchen, als er auf allen möglichen Gebieten Erstaunliches leistete in den wilden Jahren der ersten deutschen demokratischen Republik. In seinem Haus in Birnbach, nahe Altenkirchen, stirbt er am 18. Oktober 1961.
CG
Carmen Sylva, 1843-1916, Königin, Schriftstellerin, Schloss Monrepos

Eine dichtende Königin, wie aus dem Märchenbuch
Es gibt noch da und dort eine Straße, einen Park oder ein Altenheim, die ihren Namen tragen, aber ihre Werke werden nicht mehr aufgelegt und sind vergessen. Und doch war sie einst in ganz Europa berühmt als »dichtende Königin«. Als sie 1890 Queen Victoria besuchte, trug sie auf einem Sängerfest in Wales eigene Dichtungen vor und wurde von der Menge bejubelt. Berichte über sie füllten die Boulevardblätter jener Zeit. Ihre Bücher wurden in verschiedene europäische Sprachen übersetzt, dafür sorgte sie oft schon selbst, denn sie sprach fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch. Eine spektakuläre Erscheinung, die Königin von Rumänien, geborene Elisabeth zu Wied, die sich als Dichterin »Carmen Sylva« nannte.
In diesem Namen verbirgt sich ihre Herkunft aus dem Westerwald: »Waldgesang«, lateinisch carmen sylvae, was sie wegen des besseren Klangs abänderte. »Carmen das Lied und Sylva der Wald / Von selbst gesungen das Waldlied schallt.«
Im Schloss Monrepos, über der Stadt Neuwied mit Blick auf den vielbesungenen Rhein gelegen, kommt sie als Tochter des fürsten Hermann zu Wied und seiner Frau Maria, geborene von Nassau, zur Welt. Sie durchlebt eine von strenger Erziehung geprägte Kindheit. Wenn sie aber in die Wälder um Monrepos darf, wird sie zum wilden Naturkind. Ihre Sprachbegabung fördert ein eigener Hauslehrer, – und sie bekommt sogar einige Klavierstunden von Clara Schumann, die als Starpianistin durch die deutschen Adelshäuser tingelt. Zu Füssen ihres weitgereisten Onkels Maximilian zu Wied sitzend, lauscht sie seinen Erzählungen über das Leben der nordamerikanischen Indianer.
Als sich kein passender hochadliger Ehemann anbietet, droht sie als junge Frau den Eltern an, Lehrerin zu werden, um etwas Nützliches für die Menschen zu tun. Dieser für eine Frau der damaligen Oberklasse ungewöhnliche Berufswunsch zeigt schon den Einfluss der Frauenemanzipation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Doch ist Elisabeth zu Wied alles andere als eine Suffragette. Zu sehr ist sie erfüllt von der überzeugung, die wesentliche Aufgabe einer Frau bestehe darin, zu lieben, zu pflegen, und zu dienen, zum Beispiel einem Ehemann und einer möglichst zahlreichen Kinderschar. Der Wunsch, Leben zu erzeugen und zu erhalten, erwuchs sicherlich auch aus frühen Erschütterungen. Ihre Kindheit wird überschattet von schweren Krankheiten in der Familie. Der geliebte jüngste Bruder Oskar, schon schwer geschädigt geboren, stirbt mit 12 Jahren. Der Vater Hermann zu Wied, ein hochgebildeter Privatgelehrter, leidet an Tuberkulose, und auch die Mutter Maria kränkelt oft, ist zeitweise sogar gelähmt.
Obgleich eine attraktive junge Frau mit einer – wie Zeitzeugen berichten – »süssen«, wohlklingenden Stimme, lässt sie sich auf dem europäischen Heiratsmarkt des Hochadels schwer vermitteln. Sie gilt als zu ernsthaft und gebildet. Schon nähert sie sich mit 26 Jahren als Hochadlige dem Status der »alten Jungfer«, da führt ihre Mutter Maria zu Wied 1869 eine arrangierte Begegnung mit Prinz Karl von Hohenzollern-Sigmaringen herbei, einem hohen Offizier der preußischen Armee, ehrenhaft und zurückhaltend gegenüber Frauen. Kurzentschlossen macht er ihr jedoch bei diesem ersten Treffen einen Heiratsantrag, vielleicht weil er Elisabeth schon einmal in seinen Armen aufgefangen hatte, als das junge Mädchen, eine Schlosstreppe runterstürmend, gestolpert war. Sie nimmt den Antrag ebenso entschieden sofort an. Wenige Wochen später wird die Ehe geschlossen.
Schon 1866 hatte ihr Mann als fürst Carol I. die ihm angetragene Regentschaft in Rumänien übernommen. Die Flitterwochen bestehen deshalb aus zwei Tagen im Schlafwagen nach Bukarest. Obgleich ihr lockerer rumänischer Hofstaat die sittenstrenge fürstin nach einigen Wochen verdächtigt, sie sei wohl frigide, gebiert Elisabeth schon elf Monate nach der Hochzeit eine Tochter, die abgöttisch geliebte Maria. Das Glück über die Erfüllung ihres fraulichen Lebensziels dauert nur kurz. Als sie mit ihrem Kind während einer Scharlach-Epidemie aus Pflichtgefühl ein Hospital besucht, infiziert sich die Kleine an eben diesem Erreger und stirbt 1874 im Alter von 3 Jahren. Den Schmerz über diesen Verlust verwindet die Königin nie, zumal sie kein Kind mehr zur Welt bringen kann, stattdessen mehrfach Fehlgeburten erleidet. Schreibend versucht sie, diese Wunde ihres Lebens zu heilen: Sie beginnt eine Karriere als Dichterin mit dem Pseudonym »Carmen Sylva«. Unermüdlich veröffentlicht sie Gedichte, Romane, Märchen, Theaterstücke, Aphorismen – in rasender Eile und kaum korrigiert, was sich ungünstig auf die Qualität ihrer Arbeiten auswirkt. Bald erwirbt sie sich jedoch mit ihren Werken einen gewissen Ruhm, wozu sicher auch ihr gesellschaftlicher Rang beiträgt. Denn 1881 hat sich Rumänien zu einem Königreich gemacht. Nun ist sie eine »dichtende Königin«, die sich offen zur Schriftstellerei bekennt – anders als die mit ihr befreundete österreichische Kaiserin Sissy, die ebenfalls schreibt, aber eine Veröffentlichung wegen der Hofetikette ablehnt.
Читать дальше