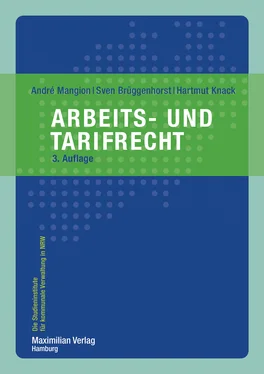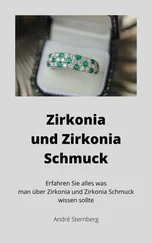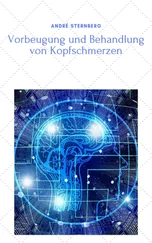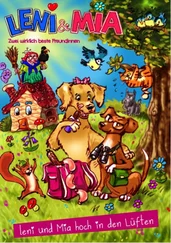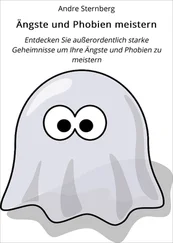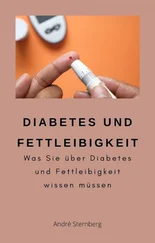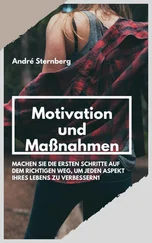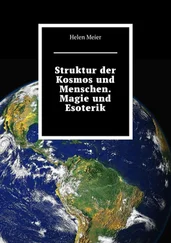Ein ohne Zustimmung des Personalrats geschlossener Arbeitsvertrag, also eine Einstellung, ist rechtsgültig. Allerdings darf der Neueingestellte so lange nicht in den Betrieb eingegliedert, also beschäftigt werden, bis der Personalrat seine Zustimmung erteilt hat. Ein teurer Spaß für den Arbeitgeber, denn er muss aufgrund des Arbeitsvertrags Lohnzahlungen leisten, erhält dafür aber keinen Gegenwert, weil der Arbeitnehmer nicht eingesetzt werden darf.
Eine ohne vorangegangene Anhörung des Personalrats ausgesprochene Kündigung hingegen ist unwirksam (siehe Kapitel 4.1.2).
Fraglich ist auch, aus welchen Gründen ein Personalrat denn überhaupt einer beabsichtigten Maßnahme der Dienststelle die Zustimmung verweigern darf. Hier gilt ausdrücklich ein Willkürverbot, das von der Rechtsprechung entwickelt wurde. Der Personalrat darf folglich seine Zustimmungsverweigerung nur mit Inhalten begründen, die einen Bezug zur beabsichtigten Maßnahme oder den einschlägigen Mitbestimmungstatbestand haben.
So dürfte ein Personalrat die beabsichtigte Neueinstellung eines Kollegen nicht mit der Begründung ablehnen, dass die Dienststelle zuvor einen Initiativantrag des Personalrats auf Senkung der Kantinenpreise abgelehnt hat. Ein zulässiger Verweigerungsgrund wäre zweifelsohne der Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften, z. B. gegen das AGG oder gegen Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten nach dem LGG (siehe auch Kapitel 4.2).
Sollte nun ein Personalrat einer mitbestimmungspflichtigen Angelegenheit die Zustimmung verweigern, so würde ein Verfahren in Gang gesetzt, das der § 66 LPVG detailliert beschreibt. Nach erfolgter Ablehnung innerhalb der Zweiwochenfrist (siehe Kapitel 4.1.2) wäre die Angelegenheit zunächst zwischen den Beteiligten nochmals zu erörtern. Kommt es dann zu keiner Einigung, könnten Dienststelle und Personalrat die sog. Einigungsstelle anrufen (§§ 66 Abs. 7, 67 LPVG). Abhängig davon, um welchen mitbestimmungspflichtigen Tatbestand es geht und wer wessen Antrag bzw. Initiative abgelehnt hat, entscheidet sich, ob die Einigungsstelle zur endgültigen Entscheidung befugt ist oder nur eine Empfehlung an den Rat (§ 66 Abs. 7 Satz 3 LPVG) abgibt.
In der kommunalen Praxis kommen jedoch Einigungsstellenverfahren in der Regel nicht allzu häufig vor. Es ist meist für alle Beteiligten angenehmer und zielführender, Meinungsverschiedenheiten bereits im Vorfeld des formellen Beteiligungsprozesses durch vertrauensvolle Gespräche auszuräumen.
4.2BETEILIGUNG NACH DEM LGG
Der Begriff der Gleichstellung ist zweifellos untrennbar mit dem Begriff der Gleichberechtigung von Frau und Mann verbunden. Wir sollten uns immer vor Augen halten, dass Gleichberechtigung der Geschlechter in unserem Land keine allzu lange Tradition hat. Das Wahlrecht für Frauen wurde gesetzlich erst im November 1918 eingeführt. Eine verfassungsrechtliche Verankerung der Gleichberechtigung sieht erst das Grundgesetz, das am 23.05.1949 in Kraft trat, in seinem Art. 3 Abs. 2 vor. Aktualität in der öffentlichen Wahrnehmung erhielt dieses Thema zuletzt mit dem Inkrafttreten des „Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ auf Bundesebene mit Wirkung vom 01.01.2016.
In vielen Kommunalverwaltungen begegnet man der Rolle und der Funktion der Gleichstellungsbeauftragen noch heute, im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert, teilweise mit Skepsis und Vorbehalten. Gelegentlich werden sogar Stimmen laut, die die Gleichstellungsarbeit für völlig überzogen halten und die Installation von „Männerbeauftragten“ fordern. Nachfolgend sollen die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten in Nordrhein-Westfalen skizziert werden, auch um diese Zweifel zu zerstreuen. Grundlage für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten ist das Landesgleichstellungsgesetz NRW vom 09.11.1999 (LGG).
In jeder Dienststelle des Landes und der Gemeinden und Gemeindeverbände mit mindestens 20 Beschäftigten ist ein „Gleichstellungsplan“ zu erstellen (siehe § 5 LGG). Darunter können Sie eine Strukturanalyse der Stellen und entsprechenden Stellenbesetzungen mit Frauen und Männern verstehen. Es wird detailliert ermittelt, welche Stellen mit welcher Wertigkeit (z. B. EG 1 bis EG 15 TVöD, BesGr A 6 bis A 16 LBesG) mit Frauen und Männern besetzt sind und ob die jeweilige Besetzung geschlechterparitätisch ist. Aus dieser Analyse werden dann die Maßnahmen abgeleitet, die zur Herstellung der Gleichstellung erforderlich sind. Solche Maßnahmen können beispielsweise die bevorzugte Einstellung, Fortbildung, Förderung und Beförderung von Frauen sein.
Einer Einstellung voran geht meist die Ausschreibung der zu besetzenden Stelle. Diese ist bei Ausbildungsstellen (§ 8 Abs. 3 LGG) und in Bereichen der Unterrepräsentanz von Frauen obligatorisch, also zwingend, vorgeschrieben.
Nun, werden dann nicht etwa Männer in unzulässiger Weise grundrechtswidrig benachteiligt, könnte man sich angesichts der vorangegangenen Ausführungen fragen. Tatsächlich enthält das LGG (siehe § 7 Abs. 1) eine Einschränkung dahingehend, dass Frauen nur bei „gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung“ zu berücksichtigen sind. Diese Einschränkung ist verfassungsrechtlicher Natur und entstammt den sog. hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums aus Art. 33 GG. Jüngste Versuche des Landesgesetzgebers, diesen Grundsatz durch eine abweichende Regelung im Landesbeamtengesetz (LBG) zu durchbrechen, wurden durch die Rechtsprechung gestoppt.
Doch was bedeutet das ganz konkret für die kommunale Praxis? Weibliche Bewerberinnen sind immer dann ihren männlichen Konkurrenten vorzuziehen, wenn sie mindestens ebenso qualifiziert sind. Herrscht also „Qualifikationsgleichstand“, ist die Bewerberin vorzuziehen.
Diese Regel gilt jedoch nicht für immer und ewig, sondern nur so lange, bis im jeweiligen Verwaltungsbereich mindestens Geschlechterparität hergestellt ist.
Zur Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung der Gleichstellung hat der Gesetzgeber die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten geschaffen und mit umfangreichen Rechten ausgestattet (§§ 15–21 LGG; bitte nachlesen!).
Besonders bedeutsam für die tägliche Praxis einer Personalstelle in der öffentlichen Verwaltung ist ganz sicher die Vorschrift des § 18 LGG. Danach ist die Gleichstellungsbeauftragte u. a. frühzeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören. Innerhalb einer angemessenen Frist, die in der Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, ist ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Auch sind ihr alle notwendigen Akten und Bewerbungsunterlagen vorzulegen.
Folge einer nicht oder nur fehlerhaft erfolgten Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten ist die Rechtswidrigkeit der Maßnahme (§ 18 Abs. 3 LGG). Die Gleichstellungsbeauftragte ist frei von Weisungen und hat ein unmittelbares Vortragsrecht beim Behördenleiter. Das bedeutet für die kommunale Praxis, dass sie sich in Gleichstellungsangelegenheiten jederzeit ohne Einhaltung des Dienstwegs an den Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landrat wenden kann.
Da der Gleichstellungsbeauftragten nach § 18 Abs. 4 LGG Gelegenheit zur Teilnahme an allen Besprechungen ihrer Dienststelle zu geben ist, die Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs betreffen, macht es Sinn, sie zu allen Auswahl- und Vorstellungsgesprächen einzuladen. Wenn Sie an Ihr Vorstellungsgespräch zurückdenken, werden Sie sich bestimmt an die Anwesenheit der Gleichstellungsbeauftragten erinnern.
Um die umfassende Information und Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten sicherzustellen, nehmen viele kommunale Dienststellen die Beteiligungen nach dem LPVG (siehe Kapitel 4.1) und die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten nach dem LGG zeitgleich in parallelen, meist schriftlichen Verfahren vor. Oftmals erfolgt vorab gar keine Analyse mehr, ob im vorliegenden, ganz konkreten Fall eine Unterrepräsentanz von Frauen vorliegt. Man folgt in der Praxis eher dem Grundsatz „Lieber einmal zu viel beteiligt als einmal zu wenig“. Man kann aus dieser Tatsache aber auch ableiten, dass der Schutzgedanke des LGG längst in den Köpfen einer Vielzahl von Personalentscheidern angekommen und dort verankert ist.
Читать дальше