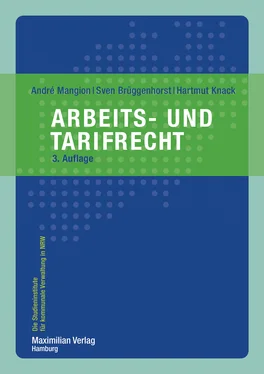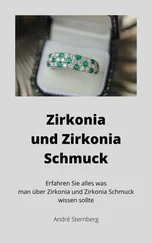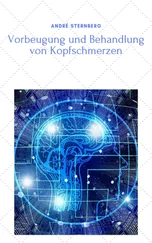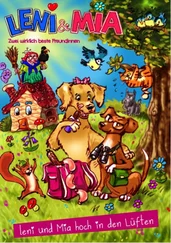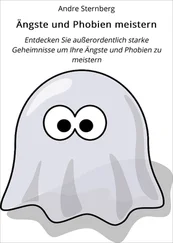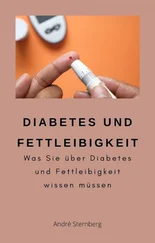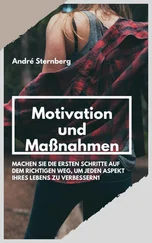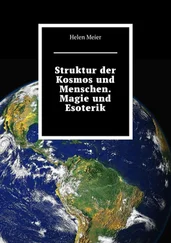Eine gesetzliche Regelung für das Günstigkeitsprinzip findet sich nur in § 4 Abs. 3 TVG und bezieht sich auf das Verhältnis von Tarifverträgen zu rangniedrigeren Rechtsquellen. Es ist aber von der Rechtsprechung für die Anwendung auf allen Ebenen des Arbeitsrechts anerkannt.
Anhand des folgenden Beispiels soll dies verdeutlich werden:
Der Bundesgesetzgeber hat in der Vorschrift des § 3 des Bundesurlaubsgesetzes für Arbeitnehmer einen Mindesturlaubsanspruch von 24 Werktagen pro Jahr (bei einer Sechstagewoche) festgelegt. Dies entspricht einer Dauer von vier Wochen.
In § 26 Abs. 1 TVöD haben die Tarifvertragsparteien für jedes Kalenderjahr einen Urlaubsanspruch von 30 Arbeitstagen (bei einer Fünftagewoche), somit einer Dauer von sechs Wochen, vereinbart.
Das Bundesurlaubsgesetz ist höherrangig als der TVöD, es enthält allerdings nur die Festlegung eines Mindestanspruchs, der – dem Günstigkeitsprinzip folgend – im Tarifvertrag für den Arbeitnehmer vorteilhafter gestaltet werden durfte.
FALL 2.3
Angenommen, ein Behördenleiter würde sich bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren außergewöhnlich gute Leistungen bedanken wollen, dürfte er ihnen dann einen über die Regelungen des Tarifvertrags hinausgehenden Urlaub gewähren, z. B. zwei Tage „Extra-Urlaub“?
Zumindest nach arbeitsrechtlichen Vorschriften wäre dies zulässig, denn die Arbeitnehmer würden durch diese Maßnahme ja begünstigt.
Als Faustforme l für die Anwendung des Günstigkeitsprinzips kann man sich den Ausspruch „ Der Großzügigkeit des Arbeitgebers sind keine Grenzen gesetzt “ einprägen.
3KOLLEKTIVES ARBEITSRECHT
3.1VERFASSUNGSRECHTLICHER AUFTRAG DES KOLLEKTIVEN ARBEITSRECHTS
Bevor die rechtliche Bedeutung und die Inhalte des kollektiven Arbeitsrechts dargestellt werden, ist zunächst eine Abgrenzung zum Individualarbeitsrecht geboten und sinnvoll. Aus dem Wortsinn des Substantivs „Individuum“ oder dem zugehörigen Adjektiv „individuell“ kann man ableiten, dass es sich bei dem „Individualarbeitsrecht“ um Rechtsbeziehungen zwischen Individuen, also zwischen Einzelnen, handelt. Ganz konkret geht es hier um die arbeitsvertraglichen Verhältnisse zwischen einem einzelnen Arbeitnehmer und einem einzelnen Arbeitgeber.
Demgegenüber beschäftigt sich das kollektive, also das gemeinschaftliche Arbeitsrecht, mit den Rechtsverhältnissen zwischen Gruppen von Arbeitnehmern und Gruppen von Arbeitgebern. Als Oberbegriff für beide Gruppen verwendet man im Arbeitsrecht das Wort „Koalition“. Eine Koalition ist laut Duden ein „Bündnis zur Durchsetzung gemeinsamer (politischer) Ziele“.
Die Zusammenschlüsse, also die Koalitionen von Arbeitnehmern zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele, nennt man Gewerkschaften. Schließen sich hingegen mehrere Arbeitgeber zu Koalitionen zusammen, um ihre Interessen zu bündeln, so nennt man diese meist Arbeitgeberverbände.
Das Recht, sich zu Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden zusammenzuschließen, nennt man Koalitionsfreiheit. Diese ist in Deutschland über Artikel 9 Abs. 3 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich geschützt. Das Koalitionsrecht ist ein selbstständiges Grundrecht, steht jedermann, also nicht nur deutschen Staatsangehörigen, zu und wird für alle Berufe gewährleistet. Es umfasst das Recht, eine Koalition zu gründen, eine Mitgliedschaft einzugehen oder zu beenden oder in der Koalition zu verbleiben. Ausdrücklich schützt es auch vor dem Zwang, einer Koalition beitreten zu müssen.
Grundrechte gelten als Abwehrrechte der Bürger gegenüber staatlichen Eingriffen. So garantiert Artikel 9 Abs. 3 GG nicht nur die Koalitionsfreiheit, sondern auch die Freiheit zum Abschluss von Tarifverträgen. Diese sog. Tarifautonomie ist sowohl vom Staat als auch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu respektieren.
Für Sie als Beschäftigte oder Beamte im öffentlichen Dienst bedeutet die Koalitionsfreiheit ganz konkret, dass es Ihre ganz persönliche Entscheidung ist, ob Sie einer Gewerkschaft beitreten möchten, ob Sie dort aktiv mitarbeiten oder nur eher passives Mitleid sein wollen oder ob Sie diese Gewerkschaft durch Kündigung Ihrer Mitgliedschaft wieder verlassen wollen. Niemand, auch nicht der Staat, kann und darf Ihnen vorschreiben, dass Sie Gewerkschaftsmitglied sein müssen oder nicht sein dürfen. Gleichermaßen verhält es sich für Ihren Arbeitgeber: Auch dieser kann – meist über die kommunalverfassungsrechtlich zuständigen Organe – frei entscheiden, ob er einem Arbeitgeberverband angehören möchte oder eben auch nicht. Auch wenn Ihr Arbeitgeber als Kommune selbst dem Staat zuzurechnen ist, ist er an dieser Stelle Grundrechtsträger und kommt in den Genuss der Koalitionsfreiheit.
Doch aus welchem Grund schließen sich Arbeitnehmer zu Gewerkschaften und Arbeitgeber zu Arbeitgeberverbänden zusammen, und warum ist das Koalitionsrecht sogar ein Grundrecht?
Die Hauptaufgabe von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ist der Abschluss von Tarifverträgen (siehe auch Kapitel 2.3, „Rechtsquellen“).
Diese Tarifvertragsparteien sind berechtigt, auf privatrechtlicher Ebene Tarifverträge zur eigenverantwortlichen Regelung des Arbeitslebens abzuschließen. Dabei sind jedoch gewisse Rahmenbedingungen in formeller wie in materieller Hinsicht zu beachten:
So bedarf der Abschluss eines Tarifvertrags gemäß § 1 Abs. 2 TVG zwingend der Schriftform .
Das Tarifvertragsgesetz (TVG) räumt in § 2 ausschließlich den dort aufgeführten Personen und Koalitionen das Recht zum Abschluss von Tarifverträgen ein:
•den Gewerkschaften
•den Vereinigungen von Arbeitgebern (also Arbeitgeberverbänden)
•Zusammenschlüssen von Gewerkschaften und von Vereinigungen von Arbeitgebern (sog. „Spitzenorganisationen“)
•einzelnen Arbeitgebern
Dieses Recht bezeichnet man in der Fachsprache auch als „ Tariffähigkeit “.
Nun stellen Sie sich einmal vor, Sie würden zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen Ihrer Verwaltung eine neue Gewerkschaft gründen, weil Sie mit der Arbeit der etablierten Gewerkschaften nicht zufrieden sind. Die Gewerkschaft hieße z. B. „Neue kommunale Bedienstetengewerkschaft“ (NkB) und hätte – Sie mitgerechnet – zehn Mitglieder. Müsste dann die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) als Spitzenverband der über 11.000 Städte und Gemeinden in Deutschland mit Ihrer „NkB“ beispielsweise in Verhandlungen über einen neuen Entgelttarifvertrag eintreten?
Möglicherweise wird Ihnen bereits Ihr „Bauchgefühl“ sagen, dass dies nicht der Fall ist. Ihrer „NkB“ fehlt nämlich eine Eigenschaft, die man als „Tarifmächtigkeit“ bezeichnet. Eine tariffähige Vereinigung, wie es die „NkB“ wäre, muss aufgrund ihrer Mitgliedergröße und ihres Organisationsgrads so leistungsfähig und „mächtig“ sein, dass sie auch tatsächlich auf den anderen Tarifvertragspartner Druck auszuüben vermag. Dies wäre hier wohl nicht der Fall: Eine Streikandrohung von zehn kommunalen Beschäftigten würde die VKA nicht ernsthaft unter Druck setzen.
Letztlich ist noch die Frage zu klären, für welchen tariflichen Geltungsbereich tariffähige Parteien Tarifverträge abschließen dürfen. Es geht also um die sog. „Tarifzuständigkeit“. Mit dem Begriff „tariflicher Geltungsbereich“ ist hier die betriebs- oder unternehmensbezogene, die räumliche oder regionale, die branchen- oder berufsbezogene Ebene gemeint. Die Tarifzuständigkeit wird meist in der Satzung der tariffähigen Vereinigung festgelegt.
Bezogen auf das Beispiel der „NkB“ würde das bedeuten, dass in deren Satzung die Tarifzuständigkeit für „die Interessenvertretung der Beschäftigten des allgemeinen inneren Verwaltungsdienstes bei den Kommunen in NRW“ festgelegt werden könnte. Sollte nun die „NkB“ beispielsweise einen Gehaltstarifvertrag für das Pflegepersonal an kommunalen Krankenhäusern abschließen, wäre dieser Tarifvertrag aufgrund fehlender Tarifzuständigkeit rechtsunwirksam.
Читать дальше