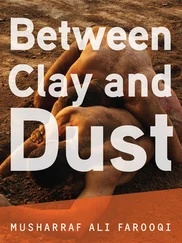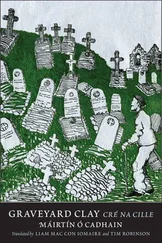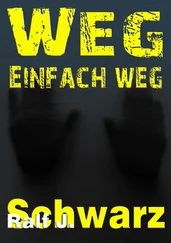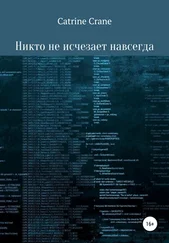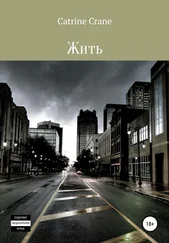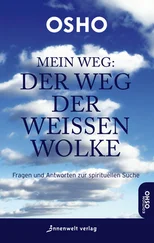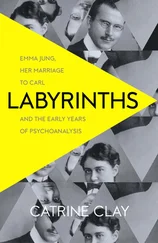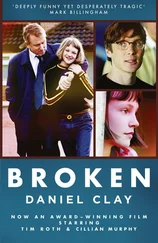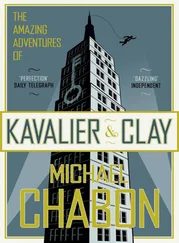Berni war zu jung, um den harten Arbeitsalltag seines Vaters richtig einschätzen zu können, aber er freute sich, mit welchem Stolz sein Vater seine Pflichten als Vorarbeiter erfüllte. Mit Kladde und Bleistift bewaffnet ging er nach dem Anlegen eines Schiffes an Bord, um mit dem Ersten Offizier bei einem Schnaps die Ladelisten abzugleichen und die Beladung zu planen. Manchmal durfte Berni seinen Vater an Bord begleiten. Viele der Offiziere kannten ihn schon und winkten ihm von oben zu, wenn er unten auf dem Kai stand und auf seinen Vater wartete. Er wusste, wie er sich bei solchen Gelegenheiten zu verhalten hatte: Er redete nur, wenn er angesprochen wurde, und lächelte freundlich, so dass ihm mit etwas Glück einer der Offiziere einen Pfennig zuwarf, den er geschickt und mit einer Verbeugung und einem „Danke schön!“ auffing.
Berni hatte Rainer also die Wahrheit gesagt, aber es nützte nichts: Drei Tage nacheinander wartete Rainer am Eingang der Schule auf Berni und forderte ihn heraus, und jedes Mal wiederholte Berni die gleiche Geschichte, bis er am vierten Tag die Nase voll hatte. Es war typisch für Berni, dass er von einem Moment zum anderen seine Geduld und Beherrschung verlor. Jeder, der ihn kannte, hätte seinem Kontrahenten sagen können, dass Berni kaum zu bändigen war, wenn es erst einmal so weit gekommen war. Also sagte er schließlich: „Na gut“, und: „Morgen früh, vor der Schule.“ Der einfältige Rainer konnte es kaum erwarten, Berni, der viel kleiner war als er, in die Finger zu kriegen und dem Naseweis eine ordentliche Abreibung zu verpassen.
Seit einiger Zeit nahm Berni jeden Morgen vor der Schule an einem freiwilligen Englischunterricht teil. Auch das war typisch für ihn: Er war ganz wild darauf, Neues zu lernen, wenigstens zu diesem Zeitpunkt seines Lebens, bevor die Hitlerjugend kam und ihn vereinnahmte. Die Schule hatte die Erlaubnis seiner Eltern eingeholt, und zumindest sein Vater war überrascht, dass Berni die zusätzliche Arbeit auf sich nehmen wollte. Aber Berni hatte seinen Entschluss gefasst, er wollte eine Fremdsprache lernen. Obwohl es bedeutete, eine Stunde früher in der Schule zu erscheinen. Sein Freund Herbert Behrens war auch mit dabei, dazu sechs andere aufgeweckte Kerle aus seiner Klasse. Die Lehrerin war eine Frau Payman, die mit einem ansässigen Geschäftsmann aus England verheiratet war.
Am nächsten Morgen erschien Berni, bereit zum Kampf, bereits eine halbe Stunde vor dem Englischunterricht in der Schule. Als er in den Klassenraum kam, gab ihm Rainer, der hinter der Tür gelauert hatte, einen kräftigen Schlag ins Gesicht. Das war ein schwerer Fehler: Berni war sofort außer sich vor Wut, und nur wenig später hatte Rainer eine Schnittwunde am Kinn, ein blaues Auge und eine blutige Nase. Die anderen Schüler feuerten die Kämpfenden lautstark an, als Frau Payman in die Klasse kam, gerade noch zur rechten Zeit: Der große Rainer lag, schon beinahe bewusstlos, am Boden. Es gab zwei Tafeln im Klassenraum, eine große, die an der Wand befestigt war, und eine kleinere, die daran lehnte. Sie benutzten die kleinere Tafel als Bahre, um Rainer zur Krankenstation der Schule zu tragen. Die Lehrerin musste den Zwischenfall melden, und wenig später hatte Berni vor dem großen hölzernen Schreibtisch im Zimmer des Rektors strammzustehen. Schulrektor Schweers, ein Autokrat alten Schlages, liebte militärisches Gebaren und Auftreten und pflegte einen unerschütterlichen Glauben an Zucht und Ordnung. Er weigerte sich, ein solches Betragen zu hinzunehmen, zumal es nicht das erste Mal war, dass Berni in einem Wutausbruch andere Jungs geschlagen hatte. Rektor Schweers bestellte die Eltern in die Schule, um seine Entscheidung mitzuteilen: Berni sollte von der Schule verwiesen und in eine Besserungsanstalt geschickt werden.
Vater und Mutter konnten es nicht fassen. Natürlich wussten sie, dass der sonst so unbeschwerte Berni bisweilen die Beherrschung verlor: Es kam vor, dass er den kleinen Karl Heinz knuffte, wenn der ihn zu sehr ärgerte, und manchmal meckerte er seine Mutter an. Aber im Grunde war Berni ein fügsamer Junge, der klaglos Besorgungen erledigte und im Haushalt half und an Tagen, wenn sich seine Mutter nicht wohlfühlte, die Treppe bohnerte oder die Wäsche mangelte. In der Schule nahm er nur selten an Raufereien teil und verausgabte sich stattdessen lieber beim Sport. Doch so sehr sich die Eltern beim Rektor für ihren Sohn einsetzten, es half nichts. Bis Herbert Behrens, ein ansonsten schweigsamer Junge, seinen Mut zusammennahm und die ganze Geschichte erzählte: dass nicht Berni den Kampf angefangen habe, sondern Rainer, und dass Berni dreimal versuchte habe, einer Rauferei aus dem Wege zu gehen, und dass Rainer ihn immer wieder herausgefordert habe, bis Berni schließlich darauf einging. Herbert rettete Berni die Haut und zementierte damit die Freundschaft zwischen den beiden sonst so unterschiedlichen Jungs. Doch später am Tag, als Berni daheim in die Küche kam, verabreichte ihm seine Mutter mit ihrem Holzlöffel eine tüchtige Abreibung. Sein Vater hingegen nahm Berni beiseite und gratulierte ihm: „Gut gemacht, mein Junge. Lass dich niemals unterkriegen.“ Als Berni Jahre später auf sein Leben zurückschaute und an die Worte seines Vaters dachte, war er überzeugt: „Ja, da hatte er recht. Und ich habe mich nie unterkriegen lassen.“
Berni trieb seit seinem fünften Lebensjahr Sport, zunächst bei Blau-Weiß Gröpelingen, gelegentlich ging er zum Turnen und Handballspielen auch zum Arbeiterverein VSK Gröpelingen. Aus diesen und anderen Vereinen wurde später TuRa Gröpelingen (heute: TuRa Bremen), und dort ist Bernis Mitgliedschaft seit 1933 registriert. Die erste Mannschaft des Vereins machte sich bald einen Namen und bestritt Spiele in ganz Norddeutschland. Die Jungs der Juniorenmannschaften durften manchmal mitfahren, um zuzuschauen und zu lernen, um die Atmosphäre zu erleben und davon zu träumen, es den Vorbildern eines Tages gleichzutun. Für Bernie war TuRa ein Verein fürs Leben und Sport sein Lebensinhalt schlechthin.
Obwohl zu Hause also das Geld knapp war, genoss Berni dennoch eine glückliche Kindheit. Er glaubt, dies seinen Eltern zu verdanken, die ihm alles gaben, was ein Junge braucht: Liebe, Disziplin und ausreichend Freiheit. Vielleicht liebte ihn seine Mutter ein bisschen „zu sehr“, und sie hatte sicherlich den größeren Einfluss auf ihn. Doch später wurde ihm klar, dass auch sein Vater erheblichen Anteil an seiner Entwicklung hatte. Als Berni klein war, nahm sein Vater ihn häufig zu Fußballspielen mit. Anschließend besprachen sie auf dem Heimweg in der Straßenbahn jede Kleinigkeit des Spiels: wer gut gespielt hatte und wer nicht, welche Mannschaft die bessere Taktik hatte, welcher Torhüter die besten Paraden gezeigt hatte – sie wälzten jeden Aspekt, der ihnen in den Sinn kam, wie zwei alte Hasen. Der Vater hatte selbst in seiner Jugend aktiv gespielt, und wäre der Erste Weltkrieg nicht dazwischengekommen, hätte er sicher weitergespielt, aber nach zwei Jahren in den Schützengräben hatte er die Begeisterung daran verloren.
An Sonntagen im Sommer ging die Familie gerne zum Bootfahren in den Bürgerpark oder unternahm eine Dampfschifffahrt auf der Lesum. Die Mutter packte ein Picknick ein, das sie zu viert am Ufer aßen, während sie den Booten und Schiffen zusahen, bevor sie mit dem Dampfer zurückfuhren. Das Schönste aber war, dass Berni jeden Sommer, seit er sieben war, für zwei Wochen zu seinem Onkel Hans, dem Bruder seines Vaters, in die Nähe von Hameln fahren durfte. Dorthin reiste er stets allein, vielleicht, weil nicht genug Geld da war, um gemeinsam zu fahren. Jedenfalls wurde Berni jedes Jahr von seinen Eltern zum Hauptbahnhof gebracht und am Zug verabschiedet. Dem Jungen war nicht bange, er war nur aufgeregt. In Hameln spielte er den ganzen Tag von morgens bis abends mit seinem Cousin Hansi, der später als Bomberpilot diente und über dem Ärmelkanal abgeschossen wurde. Nach zwei Wochen stieg er wieder in den Zug und reiste allein zurück nach Bremen. Berni sehnte sich nach Freiheit, und die bekam er auch.
Читать дальше