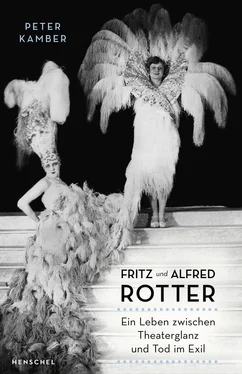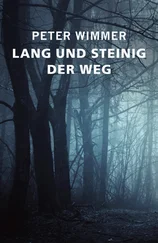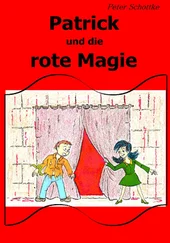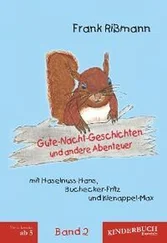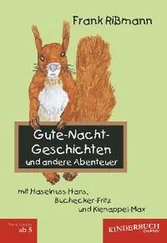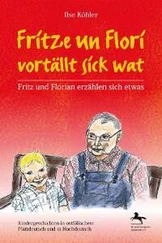Worin liegt also die Provokation der Rotters und ihrer Theaterarbeit? Ikonen der Berliner Zwanzigerjahre werden sie erst im Nachhinein. Nicht das Publikum ist es, das sie so nachhaltig ausgegrenzt. „Hierzulande muss man müssen, sonst darf man nicht“, schreibt Franz Hessel. 89
IM SPIEL BLEIBEN – KULTUR DER HYPERINFLATION
Zu Beginn der Spielzeit 1921/22 arbeitet auch Alfred Rotter eine Weile nicht mehr selbst als Regisseur, als ob er sich aus der Schusslinie nehmen möchte. Doch die Theaterkritik zielt nach wie vor direkt auf sie beide, auch wenn sie nur die Leitung ausüben. Als der Schauspieler und Regisseur Paul Wegener am 22. August 1921 im Residenz-Theater den Totentanz von Strindberg zur Aufführung bringt, heißt es in einer Kritik: „Man ahnte schon längst, dass die Rotters Pessimisten sind und sich eines Tages zu einer Weltanschaung, die der Grieche mit amphimelas , ‚ringsumschwarz‘, bezeichnete, bekennen würden. So nahm es nicht Wunder, dass sie mit diesem ‚Totentanz‘ […] auch ihrerseits einen Beitrag zu der allgemeinen Verdüsterung des Weltalls leisten wollten. […] Der Russe Tschechow hat gezeigt, dass man bereits lächeln kann, wo Strindberg noch errötet […].“ 90
Ein kleines Lob gibt es von Herbert Jhering für Georg Altmann, als der am 9. September 1921 mit Fräulein Josette – meine Frau die Saison am Kleinen Theater eröffnet: „In ihrem Bemühen, die Kritik mattzusetzen, verfielen die Rotters jetzt auf das gefährlichste Mittel: eine bessere Aufführung zu geben.“ Jhering fährt fort: „Wenn dieses Niveau festgehalten wird, ist das Kleine Theater wenigstens keine Gefahr mehr.“ 91Fritz Engel sekundiert im Berliner Tageblatt : „Wie gut geht’s uns, dass wir so totchick [sic] auftreten können.“ 92Im Stück spielt wieder Hans Albers mit.
Der Immer-noch-Revolutionär Oskar Kanehl folgt im Residenz-Theater mit Der König – und trifft wider Erwarten eine Ader bei Jhering, der im Stück eine „hinreißende Mischung von politischer Satire und erotischem Schwank“ sieht. „Dieses einzige Beispiel einer Operette ohne Musik, die wirkt, als ob Offenbach komponiert hätte. […] Im ganzen: die französischen Stücke bekommen den Rotters besser als die deutschen. Oder haben sie es nur noch nicht heraus, wie sie sie völlig verkitschen können?“ 93
Elsa Herzog, die Spezialistin für „Mode auf der Bühne“ beim Berliner Lokal-Anzeiger , nimmt diese Aufführung zum Anlass, um eine Verbindung zwischen der Ausstattung „bei den Rotters“ und der Inflation herzustellen:
„Unsere modischen Kostümdichterinnen haben in dieser Saison schon recht viel zu tun bekommen. […] [D]enn das Publikum, das diese Theater mit den unerhörten Eintrittspreisen besucht, hat ja auch ein Anrecht, für sein Geld etwas zu verlangen. Augenblicklich macht dort Flers-Caillavets König antimonarchische Propaganda. […] Da ist zunächst Olga Limburgs Ausstattung. Eine Bourgeoise […]. Sie stellt sich uns zunächst in einem blau-roten Mantelkleid in den französischen Farben aus Wollvelours vor, das über die drollige Mode dieses Winters aufklärt. […] Von besonderer Eleganz ist ihre ‚Courtoilette‘, in der sie beim König von Cerdanien vorgestellt wird. Sie ist aus zitronengelbem Chiffonsamt mit reich paillettierten Silberspitzen […]. Der Rock ist lang, weit und reifengestützt; die Stoffüberbleibsel sind für das Leibchen verwendet. Aber allzu viel ist leider nicht übriggeblieben […].“ 94
Das Rotter’sche Theater erreicht die Gesellschaftsspalten und macht, wenn nicht Kunst, so doch Mode zum Gespräch. Es wird für die Brüder Rotter die bis dahin vielleicht erfolgreichste Spielzeit. Anerkennung gibt es auch für Altmanns „satirisch überpuderten, leicht karikaturistisch eingefärbten“ Kammersänger von Frank Wedekind im Trianon-Theater , obwohl – oder gerade weil – an einer Stelle das Saallicht angeht – „Regiefeinheit“ – und die Titelfigur an der Rampe ins Publikum spricht: „Wir Künstler sind ein Luxusartikel der Bourgeoisie.“ 95Ergänzend wird im Programm des Abends noch Tod und Teufel desselben Autors gespielt.
Das weite Land von Arthur Schnitzler im Residenz-Theater 96lassen die Rotters, zumindest auf dem Papier, Arnold Korff inszenieren, der selber den Friedrich Hofreiter spielt. Es ist, als wollen sie der Kritik keinerlei Angriffsfläche mehr bieten. Und Alfred Kerr schreibt: „Der Rotter wächst mit seinen größeren Zwecken.“ Er spricht von einer „hoffnungsvolle[n] Wiederaufnahme des vor einem Jahrzehnt erschienenen Werks“, um zum Schluss zu kommen, dass es heute, zehn Jahre später, „noch immer seinen Wert“ hat. 97
Die hoffnungsvollen Frauengestalten in Das weite Land – Friedrich Hofreiters Frau Genia und dessen letzte flüchtige Geliebte – merken zu spät, das die Befreiung von Konventionen sie nicht davor schützt, getäuscht zu werden. „Man gleitet. Man gleitet immer weiter, wer weiß wohin. […] Ich lüge, ich heuchle. Vor allen Leuten spiel ich Komödie“, sagt die betrogene Genia. „Der Freiheit, die sich hier brüstet, der fehlt es am Glauben an sich selbst“, heißt es im Stück.
Fritz und Alfred Rotter setzen zwar deutlich weniger auf Lustspiele, doch als sie im Januar 1922 durch Georg Altmann Elga von Gerhart Hauptmann inszenieren lassen, 98spürt Emil Faktor vom Berliner Börsen-Courier auch dahinter eine Absicht und nutzt das für eine Generalabrechnung: „Bedenklicher ist das Rottertum an und für sich geworden, das auch in anderen Bühnenhäusern Berlins herumspekuliert […]. Die schlauen Rotters wissen […] Bescheid, und mag sein, dass sie sich sogar eines Tages entschließen, ihr ganzes Denken und Wollen nur der puren Kunst zu verschreiben. Es kann allmählich wieder das beste Geschäft werden. Vorläufig freilich sind sie nicht so weit.“ 99
Zielstrebig bringen die beiden Brüder auch 1922 weiterhin Stücke mit unkonventionellen Frauenrollen, als hätten sie sich den Satz aus Ludwigs Fuldas Der Lebensschüler (1915) ganz zu eigen gemacht: „Sprich vom Mann, und dir antwortet ein Gähnen; sprich vom Weib, und die ganze Welt horcht auf. Ja, glaube mir, Gert, dies ist ein weiblich gewordenes Jahrhundert.“ 100
Oscar Wildes bereits ältere Komödie Eine Frau ohne Bedeutung 101charakterisiert Emil Faktor als „Roman vom schuftigen Lord und seiner verlassenen Geliebten“ – doch es „riss das Publikum unaufhaltsam hin“. Ironisch fügt der Kritiker hinzu: „Man verging vor Spannung und Wonne. […] Die Regie des Herrn Kanehl, der als Lyriker ein Radikalinski ist, war pflaumenweich.“ 102
Im Kleinen Theater führt Altmann Das Weib auf dem Tiere auf 103, ein neues Drama von Bruno Frank, in dem eine „vielbegehrte, dem Mittelstand entstammende Stadtkokotte eines Tages den Geliebten“ erschießt. „Das für alle anderen Männer käufliche Weib fühlte sich von dem einen, dem zuliebe sie Geld zusammenraffte, schmählich hintergangen. […] Der Hinrichtung entzieht sie sich durch Gift […].“ 104
In der Nachwirkung bedeutsam ist Das kleine Schokoladenmädchen von Paul Gavault 105, wiederum ist Oskar Kanehl der Regisseur. Ralph Benatzky macht aus dem Stück 1932/33 für die Rotters eine Operette, Bezauberndes Fräulein , die dann aber – der noch zu schildernden Ereignisse wegen – nicht mehr aufgeführt wird: Die Uraufführung wird am 24. Mai 1933 in Wien sein, am Deutschen Volkstheater . Zu dem Zeitpunkt haben die Rotters keine Bühne mehr; Alfred ist tot und Fritz inkognito im Exil in Frankreich.
Über Das kleine Schokoladenmädchen schreibt die Vossische Zeitung , sie sei „die Tochter des Schokoladenkönigs, Millionenerbin, launisch, verwöhnt“. Hans Albers tritt in der Rolle eines armen Malers auf, „der mit allen Prachtgewändern der Rotter’schen Kleiderschränke garniert“ ist. Dass er sich „neckisch mit Lieblingsallüren vor seinem Publikum aufgebläht“ habe, missfällt dem Kritiker. „Wie er versucht, durch Exzentrikbeine Laune zu erzwingen, das ist schon nicht mehr Auflösung des Ensembles. Das ist schon mehr Untergang des Abendlandes.“ 106Jhering dagegen ist milder gestimmt und versteht auch die Komik des Schauspielers Albers besser, die er vom Film beeinflusst sieht: „Und Hans Albers? Die Reklame hat ihn zum deutschen Chaplin gemacht. Man sieht bei jeder Bewegung, wie der Regisseur ihm auf den Proben zugerufen hat: ‚Mehr Chaplin! […] Sie müssen an Chaplin denken.‘“ 107Jhering weiter:
Читать дальше