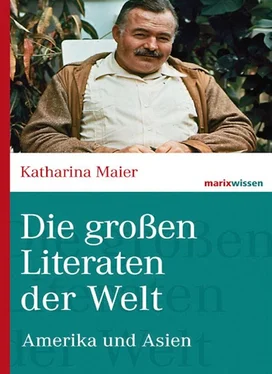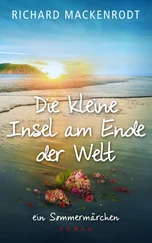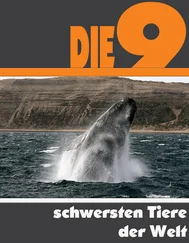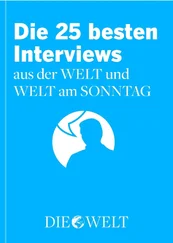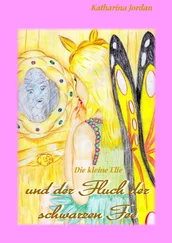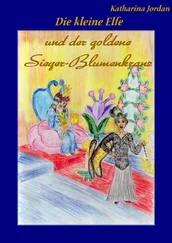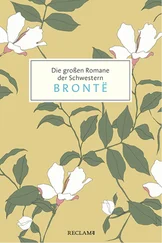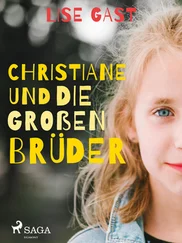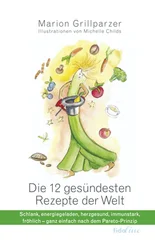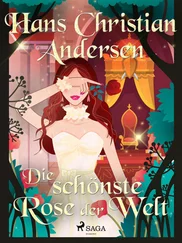3Clemens Treter. »Die Literatur der Ming- und Qing-Zeit«. in: Reinhard Emmerich (Hg.): Chinesische Literaturgeschichte . Stuttgart/Weimar: Metzler 2004. S. 225–87. hier: S. 244.
(1644–1694)
Bananenstauden – Die Entdeckung des Kleinen im haiku
Matsuo Bashō kann ohne Übertreibung der größte Lyriker des neuzeitlichen Japans genannt werden. Als Begründer der Gattung des haiku , des epigrammatischen Siebzehn-Silben-Gedichts, kann sein Einfluss auf die Weltliteratur kaum zu hoch eingeschätzt werden.
Das vielleicht berühmteste haiku Matsuo Bashōs ist das sogenannte Froschgedicht, das in zahlreichen Sprachen nachgedichtet und auch parodiert worden ist:
Alter Teich –
Ein Frosch springt hinein
Das Geräusch des Wassers .
Das japanische haiku 1ist eine Gedichtform, die in drei Versen zu (in der Originalsprache) 5–7–5 Silben den Blick auf das Kleine lenkt, auf das momentane Detail. Genau in dieser einfachen Ausschnitthaftigkeit will das haiku die Seele schulen in der erahnenden Erkenntnis des Ganzen. – Auf diese Formel kann nicht nur die Gattung des haiku und die Poesie ihres Begründers gebracht werden, sondern auch das Leben Matsuo Munefusas, der den Künstlernamen Bashö, d. i. ›Bananenstaude‹, trug. Das etwas eigenartig anmutende Pseudonym verdankte der japanische Lyriker seiner bashō-an , seiner Klause aus Bananenstauden im Fukagawa-Viertel in Edo (Tōkyō), in die er sich von 1681 an zurückzog, wenn er Ruhe und Frieden suchte. Bis zu diesem Zeitpunkt trug Matsuo Munefusa vielerlei Dichternamen, vermutlich, um sich von der Samurai-Familie, der er entstammte, abzugrenzen; schlieōlich hatte sich Bashö entschlossen, dem Leben des niederen Adels den Rücken zu kehren und statt dessen ein Dasein als wandernder Wahrheitssucher in genügsamer Einfachheit zu führen. Somit sind Leben und Werk des großen Lyrikers aufs Engste miteinander verflochten.
Bashō begann seine Wahrheitssuche mit einem Studium in Kyōtō, wo er von 1666 an bei angesehenen Meistern studierte, in erster Linie haikai und waka (die traditionellen japanischen Gedichtformen), die klassische chinesische Literatur 1und Kalligraphie. 1672 kam Bashōs erste Verssammlung Kai ōi (›Muschelwettstreit‹) heraus und im gleichen Jahr übersiedelte der Dichter nach Edo, wo er in dem Fischhändler Sugiyama Sampū einen Gönner fand. Bald etablierte sich Bashō als haikai -Meister und Lehrer und konnte ein voll und ganz der Poesie gewidmetes Leben unter Gleichgesinnten führen. Dichtung war für den großen Japaner ein Lebensstil und ein Weg zur Erlangung von Erleuchtung, den er kado nannte (d. i. ›der Weg der Dichtung‹). Edo und die bashō-an wurden zur Heimstatt des Wahrheitssuchers, doch er bereiste ganz Japan, um seine Studien der taoistischen und der Zen-Philosophie zu vertiefen (etwa verbrachte er längere Zeit in einem Zen-Kloster). Bashō reiste aber auch, um im Sinne des Zen durch persönliches, direktes Erleben der Erkenntnis nahe zu kommen; denn, so der haiku -Meister, der Dichter müsse das »was Kiefer ist, von der Kiefer lernen« und nicht den Fußstapfen der Altvorderen folgen, sondern sich aufmachen und das suchen, wonach auch jene auf der Suche waren. Im letzten Jahrzehnt seines Lebens unternahm Bashō, begleitet von seinen Schülern, fünf große Reisen durch Japan, aus denen seine beispiellosen haibun (Reisetagebücher) hervorgingen. In diesen Aufzeichnungen, von denen Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland ( Oku no hosomichi , 1689) das bedeutendste ist, hielt Bashō Begegnungen, Reflexionen und Eindrücke fest – in ausdrucksstarker Prosa, aber noch eindrucksvoller in dichten haikus , die bis heute zu den besten in japanischer Sprache gerechnet werden und lange Zeit als ideale Muster hochgehalten wurden. Bis zuletzt ließ sich Matsuo Bashō das für ihn so wichtige Reisen nicht nehmen; er starb auf seiner letzten Wanderschaft im Jahr 1964, die ihn bis nach Nagasaki führen sollte.
Nicht nur auf Reisen, sondern auch auf organisierten Dichtertreffen umgab sich Bashō mit Schülern und Freunden, mit denen zusammen er Kettengedichte ( renga ) verfasste und diese dann in Gedichtsammlungen herausgab. Die bekannteste dieser Anthologien ist Das Affenmäntelchen ( Sarumino , 1691), so benannt nach einen haiku Bashōs, das wiederum seine scharfe Aufmerksamkeit für die Details des Alltags und die mit ihnen verwobenen Gefühlsregungen offenbart:
Erster Winterregen!
Auch das Äffchen ersehnt sich
einen Regenmantel .
Im Kreise seiner Dichterfreunde und aus seinen Erfahrungen heraus entwickelte Bashō seinen eigenen shōfū -Stil, der sich von der allzu rigiden Poetik der alten haikai -Dichtung löste und trotz strenger Vorgaben große dichterische Freiheit erlaubte. Das Ziel des shōfū , und damit des haiku , ist, wie Irmela Hijiya-Kischnereit formuliert, die »mystisch-intuitive […] Anverwandlung aller Bereiche der Erscheinungswelt« 1. Das heißt, über die scharfe Beobachtung des Details und dessen poetische Verarbeitung in der festen Form des haiku soll für Dichter wie Leser ein Schritt hin zum Staunen, und so hin zur Erleuchtung, getan werden. Fugano-michi , der Weg der Eleganz, war das oberste Mittel des shōfū -Stils: eine ungewöhnliche Prägnanz der Aussage bei gleichzeitiger Geschlossenheit des Gedichtes, die doch einen Nachhall ( yoin ) im Leser erlaubt. Das bedeutet, das haiku soll in 17 Silben ein abgerundetes Ganzes bilden und gerade dadurch etwas anregen im Leser, das den Blick über den kleinen Ausschnitt, den das Gedicht präsentiert, hinauslenkt auf ein unbestimmtes Anderes. So soll das haiku in immer wandelbarer Gestalt ( ryūkō ) das Unwandelbare ( fueki ) offenbaren.
Zwei Menschenleben!
Und dazwischen ganz üppig –
die Kirschblütenzeit .
Ein solches haiku , das im Detail auf das Ganze verweist und damit auf die unauflösliche Verwobenheit von allem mit allem, besitzt Wahrhaftigkeit ( makoto ). 1
Die Kunst des haiku wurde zur Volkskunst in Japan, zum Volksspiel sozusagen, das einen scharfen Blick und das Staunen der Seele ausbilden soll. Auf die Lyrik des Westens im 20. Jahrhundert wiederum – als die Dichter am Rande der Verzweiflung nach neuen Ausdrucksformen in einer fundamentalen Sprachkrise suchten – hatte diese japanische Poesie des Sehens einen ungeheueren Einfluss.
Kai ōi (1672)
Oku no hosomichi ( Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland , 1689)
Sarumino ( Das Affenmäntelchen , 1691)
1Der Begriff entstand im 19. Jahrhunderts aus der Zusammenziehung der ursprünglichen Bezeichnung haikai no hokku (= Erstgedicht in einer Kettengedichtsequenz).
1Besonders die Werke des ›Dichterheiligen‹ Du Fu (712–770) mit ihrer melancholisch-reflexiven Grundstimmung und die weinseligen, lebensfrohen Verse des großen Li Bai (701–762) übten Einfluss auf Bashōs eigene Lyrik aus.
1Irmela Hijiya-Kischnereit: »Matsuo (Munefusa) Bashō«. in: Axel Ruckaberle (Hg.): Metzler Lexikon der Weltliteratur . Stuttgart/Weimar: Metzler 2006. Band 2. S. 119–20. hier: S. 120.
1vergl. Gero von Wilpert (Hg.): Lexikon der Weltliteratur. Band I . Stuttgart: Körner 1988. S. 122.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (JUANA INÉS DE ASBAJE Y RAMÍREZ DE SANTILLANA)
Читать дальше