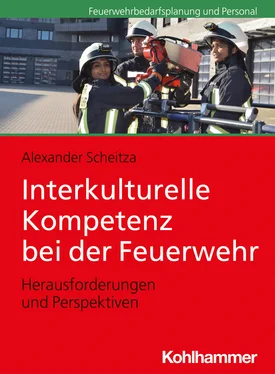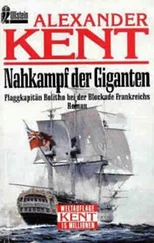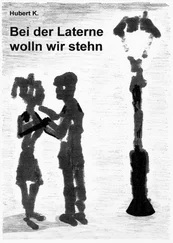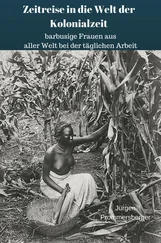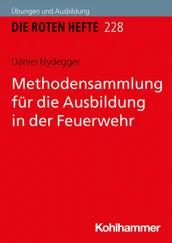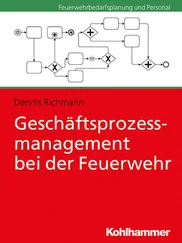Unbestritten bleibt die ebenso immense wie opferbereite Hilfeleistung der Freiwilligen wie der Berufsfeuerwehren bis hin zum verzweifelt-aussichtslosen Versuch der Bekämpfung von Feuerstürmen nach den alliierten Flächenbombardements deutscher Städte. Auch hier neigen die deutschen Feuerwehren ebenso wie die breite Öffentlichkeit dazu, die Schuld eher beim alliierten Bombercommand zu suchen als bei einem Regime, das sich geweigert hat, einen spätestens mit der Niederlage von Stalingrad am 02.02.1943 aussichtslos verlorenen Krieg zu beenden und stattdessen seine eigene Bevölkerung (und darunter eben auch die Feuerwehrmänner an der Heimatfront) zunehmend schutzlos den Vernichtungswellen der Bombenangriffe ausgeliefert hat. Dazu gehören fatalerweise auch Jungen und Mädchen. Leben und Gesundheit der Jungen werden in sogenannten Feuerwehrscharen im HJ-Streifendienst geopfert, während die Mädchen in neu gebildeten Frauenabteilungen ihren gefährlichen Einsatz versehen.
[25]1.7 Neuanfang nach dem 2. Weltkrieg: Zwischen Kontinuität und Verdrängung
Der Neuanfang der deutschen Feuerwehren erfolgt in vier verschiedenen, vom Alliierten Kontrollrat der Siegermächte verwalteten, Besatzungszonen. Österreich wird wieder in seine staatliche Eigenständigkeit entlassen und die nach der Konferenz von Jalta abzutretenden deutschen Ostgebiete sind nach dem Krieg anderen Staaten zugeschlagen worden. Deshalb kann auch der für 1937 in Danzig anberaumte 22. Deutsche Feuerwehrtag nach dem Krieg nicht an diesem Ort nachgeholt werden. Es soll noch bis 1953 dauern, bis sich die Feuerwehren der jungen Bundesrepublik wieder zu einem Deutschen Feuerwehrtag in Ulm treffen können.
Die Feuerwehren in der sowjetischen Besatzungszone, ab 1949 Staatsgebiet der DDR, übernehmen unter veränderten politischen Vorzeichen für ihre Feuerwehren weitgehend die zentralistischen Verwaltungsstrukturen, die unter dem NS-Regime geschaffen worden sind.
Auch in den westlichen drei Besatzungszonen etablieren sich die deutschen Feuerwehren vorerst nach den jeweiligen Vorgaben ihrer Besatzungsmächte. Besonders die Franzosen taten sich mit der Zulassung freiwilliger, selbstverwalteter Feuerwehren anfangs schwer, hatten sich doch in Frankreich während des 2. Weltkrieges Teile der französischen Resistance gar aus den Feuerwehren rekrutiert bzw. immer wieder Zuflucht bei den Feuerwehren gefunden. Nun hat man Angst, dass sich Teile der 1944 von der SS gebildeten NS-Untergrundorganisation »Werwolf« bei den deutschen Feuerwehren verstecken und von dort aus aktiv werden könnten (vgl. Schamberger, 2003).
Die pastellfarbige Verdrängungskultur des »motorisierten Biedermeier«, so die treffende Charakterisierung der bundesdeutschen Wirtschaftswunderjahre der Adenauer-Ära, wird nur allzu gerne auch von den Feuerwehren gepflegt (vgl. Homann, 1999). Man tut sich schwer, sich selbst den ganz persönlichen Anteil am Verlauf der Geschichte der NS-Zeit zu vergegenwärtigen und auch nach außen hin anzuerkennen. Tobias Engelsing, aktiver Feuerwehrkamerad und promovierter Historiker, skizziert wie bis in die 1990er Jahre hinein vor allem ältere Funktionäre an einer Aufarbeitung der Vergangenheit Anstoß nehmen und eine kritische Auseinandersetzung mit militärischen Traditionen verweigern (Engelsing, 1999).
1961 tritt Albert Bürger auf dem 23. Deutschen Feuerwehrtag in Bonn-Bad Godesberg erstmals – in Abstimmung mit dem Bundespräsidialamt – in der Uniform eines Zweisternegenerals der damals erst vier Jahre jungen Bundeswehr auf, nur aus preußisch-feuerwehrblauem Tuch geschneidert. »Hintergrund war das Bemühen, [26]die Stellung der deutschen Feuerwehren auf diplomatischen Empfängen und entsprechend internationalen Anlässen adäquat zu repräsentieren und ihren Vertretern einen ihrer politischen Gewichtung nach außen hin sichtbaren Ausdruck zu verleihen.« (vgl. Schamberger, 2003, S.154).
Wem drängt sich hier nicht ein historischer Vergleich zum organisatorischen Unterschied zwischen dem einst unter Napoleon militärisch organisierten Pariser Pompier-Corps und den frühen deutschen Feuerwehren in Baden und Württemberg auf? Dementsprechend irritiert – und auch nicht zuletzt vor dem Hintergrund des sich im darauffolgenden Jahr in der sogenannten »Kuba-Krise« bedrohlich eskalierenden »Kalten Krieges« zwischen den Machtblöcken – haben auch viele Vertreter der föderalistisch organisierten bundesrepublikanischen Feuerwehren auf das neue »militärische Outfit« von Albert Bürger reagiert. Darüber hinaus sind sicherlich bei vielen Kameraden manch‘ dunkle Erinnerung an die paramilitärisch-einheitliche Uniformierung der deutschen Feuerwehren unter dem NS-Regime geweckt worden, das damals gerade einmal 16 Jahre zurücklag. Bild 3zeigt ein typisches Foto einer Feuerwehr aus dieser Epoche.

Bild 3: Die Feuerwehr Lemgo 1970 (Quelle: Archiv Freiwillige Feuerwehr/Alte Hansestadt Lemgo) [zurück]
[27]1.8 Modernisierung: Wiederaufleben internationaler Kontakte und erste Frauen bei der Feuerwehr
Umso bedeutsamer erscheinen in diesem Zusammenhang auch die unter dem Dach des Weltfeuerwehrverbandes CTIF unter maßgeblichem Engagement von Albert Bürger forcierten internationalen Feuerwehrwettkämpfe. Diese bekommen beim erwähnten Feuerwehrtag in Bonn-Bad Godesberg einen hohen Stellenwert, führen sie doch auch die lokalen Feuerwehren in Deutschland aus der Isolation, beleben eine Auseinandersetzung mit internationalen Standards und stärken den völkerverbindenden Faktor des Feuerwehrwesens.
Der liberalen Ausbruchstimmung der späten 1960er und frühen 1970er Jahre öffnet sich die Feuerwehr nur langsam. Auf dem 24. Deutschen Feuerwehrtag in Münster 1970 muss sich Bundesjugendleiter Kurt Hog noch gegenüber konservativen Strömungen für eine längst überfällige moderne Jugendarbeit rechtfertigen (vgl. Hog, 1972). Anfang der 1970er Jahre werden die Feuerwehren der BRD noch vor eine weitere neue Herausforderungen gestellt, denn infolge der Überarbeitung der Brandschutzhilfeleistungsgesetze der einzelnen Ländern sprechen letztere jetzt nicht mehr ausschließlich von »Feuerwehrmännern«, sondern von »Feuerwehrangehörigen«, womit den Frauen juristisch der Weg für eine Mitarbeit im aktiven Brandschutz nicht mehr verwehrt werden kann (vgl. Schamberger, 2004). Fortan fanden die ersten Frauen, d. h. Mädchen, ihren Weg in die Jugendabteilungen. Heute ist es kaum mehr vorstellbar, dass sogar manchen von ihnen bei besonders strukturkonservativen Wehren auch später noch der Übergang in die Einsatzabteilungen verwehrt werden sollte. In den Feuerwehren der DDR waren die Kameradinnen schon längst eine Selbstverständlichkeit. Wer den Titel »Vorbildliche Freiwillige Feuerwehr« führen wollte, musste einen Frauenanteil von mindestens 25 % nachweisen.
Mit dem Fall der Mauer am 09.11.1989 bilden sich rasch Partnerschaften zwischen Feuerwehren aus BRD und DDR. Vom 14. bis 18. Juni können sie sich auf dem 26. Deutschen Feuerwehrtag in Friedrichshafen noch unter den Flaggen ihrer beiden deutschen Teilstaaten erstmals seit 40 Jahren wieder in Frieden und Freiheit treffen. Noch dreieinhalb Monate vor der offiziellen staatlichen Wiedervereinigung haben sie sich unter dem Dach ihres Spitzenverbandes zusammengeschlossen. Die Bildung von Landesfeuerwehrverbänden in den damals »Neuen Bundesländern« schließt sich nahtlos an.
Nach 45 Jahren kann das große Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte geschlossen und zugleich ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Tobias Engelsing fordert hierzu 1999: »Die Sozialgeschichte der ostdeutschen Freiwilligen Feuer[28]wehren seit 1945 ist noch zu schreiben. Noch leben die einstigen Wehrführer und Mannschaften, die Opfer der Bespitzler, die kalten Krieger der oberen Chargen und DDR-Bürger, die an ihren Bauern- und Arbeiterstaat glaubten und in der Feuerwehr mit den Folgen der Mangel- und Mißwirtschaft zu kämpfen hatten. Sie alle zu befragen und die Quellen zu sichern ist eine wichtige Aufgabe. Sie sollte, würde sich ihr jemand auf Orts- oder überregionaler Ebene stellen, von Seiten der Feuerwehrverbände gefördert werden.« (Engelsing, 1999, S.234).
Читать дальше