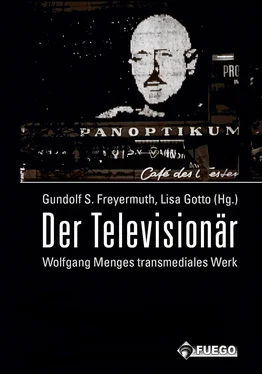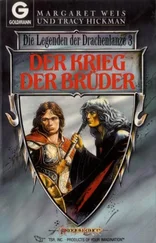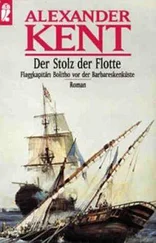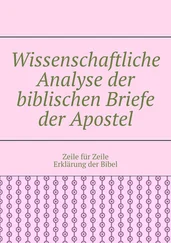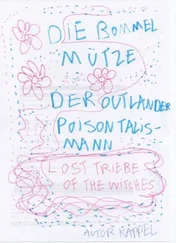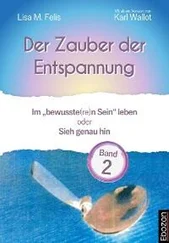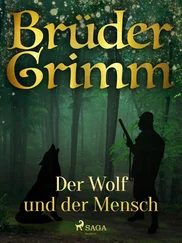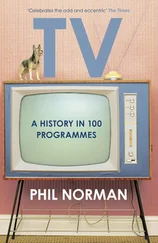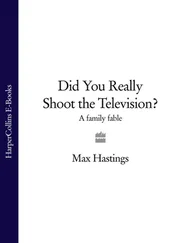Öffentliches Aufsehen und auch Anstoß erregte die Sendereihe bald durch ihre humoristisch verpackte, aber dennoch ungewohnt freizügige politische Kritik. Mit ihr bewies Wolfgang Menge zum ersten Mal »seine besondere Begabung [...], politische Zeitprobleme auf dem Wege spannender Unterhaltung bewusst zu machen«.56 Bereits nach einem halben Jahr gab es zu der Sendung eine Anfrage ihm Bundestag:57
»Da kriegte der Redakteur Albin Stuebs, auch ein Emigrant aus London [...], den Auftrag, von nun an sich die Sendung – wir haben die immer Freitag abends gemacht und Samstag wurde sie ausgestrahlt [...] – gefälligst vorher anzusehen. Der hat vorher immer dagesessen, hat sich tot gelacht über die Sendung, und von dem Moment an, wo er sie offiziell angucken sollte, um Böses zu verhindern, hat er sich überhaupt nicht mehr geregt, hat mit stummem Gesicht dagesessen. Er hat aber nie irgendwie eingegriffen [...]«58
Mit Adrian und Alexander erschrieb sich Wolfgang Menge zum ersten Mal eine gewisse Prominenz. Nach etwas mehr als zwei Jahren verließ er den NWDR wieder, um in Berlin – nach der Restitution des von den Nazis enteigneten Ullstein Verlags im Jahre 1952 – beim Aufbau der Berliner Morgenpost und der BZ mitzuarbeiten. Als freier Mitarbeiter aber blieb er dem Sender noch fast ein Jahrzehnt verbunden. In Berlin kaufte er, da das Hamburger Geschäft seines Vaters damals in Schwierigkeiten geraten war, seinen Eltern ein kleines Hotel. »Es war seine Idee, diese Pension ABC zu nennen, damit sie im Branchenverzeichnis ganz vorne steht.«59
4 Journalismus II: Korrespondent, Abschied
1954 ging Wolfgang Menge als Auslandskorrespondent für die – zwar gerade von Axel Springer erworbene, aber mit Autoren wie Sebastian Haffner und Erich Kuby immer noch überwiegend liberale – Tageszeitung Die Welt nach Ostasien. Zunächst aus Tokio60, dann aus der britischen Kronkolonie Hongkong61 schrieb er über gut drei Jahre hinweg politische Berichte, große Reportagen und auch Hörspiele. Während dieser Zeit lebte er im obersten Stockwerk des Hongkonger Foreign Correspondents Club – als einziger Bewohner des gewaltigen Gebäudes. Ein zentrales Thema war die Entwicklung in Mao-Tse-Tungs kommunistischem China.62
Das Hörspiel Das Wiedersehen etwa thematisierte das Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit, Liebe und Arbeit im Kommunismus chinesischer Prägung: Zwei junge Liebende vom Land werden dadurch getrennt, dass der Mann, der »Schmelzmeister Wei«, in eine aus dem Boden gestampfte Industriestadt umziehen muss. In dem halben Jahr seit ihrer Hochzeit hat das Paar sich nur zwei Tage sehen können. Nun darf die junge Hao ihrem Mann nachfolgen, weil beiden eine Wohnung in einem Neubau zugeteilt wurde. »Auf jedem Flur steht ein Lautsprecher... wir müssen ja die Vorträge gemeinsam hören können...«, schwärmt eine Mit-Bewohnerin.63 Doch als Hao am Bahnhof eintrifft, holt Wei sie nicht ab. Die Arbeit am Aufbau des sozialistischen Vaterlands geht vor. In der neuen, ihr noch unbekannten Wohnung muss Hao allein auf ihren Mann warten:
»Hao (für sich): Wie schön alles ist... (sie streicht über den Tisch) alles neu gestrichen... das Bett sogar aus Stahl... ein Küchenmesser ist auch da... nein, so was, ein Wasserklosett... (sie erinnert sich) einmal habe ich erst eins gesehen... im Kino in der Kreishauptstadt... und jetzt... für mich ganz allein... Aber das Schönste ist doch das neue Bildnis von Mao Tse-tung...«64
Während seiner Zeit als Korrespondent sammelte Wolfgang Menge auch erste Erfahrungen mit dem neuen Massenmedium Fernsehen:
»Ich war in Hongkong gewesen [...] und hatte dort für einen Freund bei ›movietone news‹, der von einer Segeltour nicht rechtzeitig zurückkommen konnte, eine Story über irgend so ein Schiff gemacht. Diese Sendung ist dann prompt auch bei uns im Fernsehen ausgestrahlt worden.«65
Primär aber verstärkte der Aufenthalt in der britischen Kronkolonie Wolfgang Menges angelsächsisch geprägte Weltläufigkeit. Während seiner Auslandsjahre in den 1940er und 1950er Jahren erschuf sich der junge Autor in seinen Arbeits- und Schreibweisen wie auch als Person so britisch, wie er es als geborener Berliner und in Hamburg Aufgewachsener nur konnte.
Ende 1956 geschah dann dreierlei. Zum Ersten intensivierte sich der Briefwechsel, den Wolfgang Menge mit einer jungen Frau aufgenommen hatte. Marlies Lüder, aus dem Osten Berlins stammend, betreute in Hamburg die Mitgliederzeitung der Ölfirma Esso, fühlte sich in der Stadt jedoch unwohl und suchte einen Au-Pair-Job bei einer britischen Familie, zur Not auch in Hongkong. Zwar hatte man sie gewarnt, dass Wolfgang Menge »nicht sonderlich sympathisch«66 sei, doch nachdem ihr die Einreise in die USA verweigert worden war – »wegen Kommunismusverdacht«, da ihre Familie erst kurz zuvor aus der DDR nach Westdeutschland gezogen war –, musste sie jede Chance nutzen. Bevor er ihr helfen könne, schrieb Wolfgang Menge an Marlies Lüder zurück, müsse er erst einmal wissen, wie sie aussehe: »Ob ich hübsch sei, was er für sich nicht hoffe, oder hässlich, was er für mich nicht hoffe, oder irgendwas dazwischen, was das Praktischste wäre.«67
Zum Zweiten bat ihn die Chefredaktion der Welt, in Asien Reaktionen auf zwei bedrohliche Zeitgeschehnisse zu sammeln: den Volksaufstand in Ungarn und die Suezkrise in Ägypten. »Das hatte ich ganz knapp gemacht. Nur Zitate von Politikern und aus Zeitungen. Ausschließlich Dokumente, nichts von mir.«68 Als er Wochen später die Zeitung erhält, ist er der einzige Korrespondent, dessen Beitrag nicht erschienen ist. Auf Nachfrage erhält er vom stellvertretenden Chefredakteur die Antwort: »Sehr geehrter Herr Menge, ich weiß nicht, warum Sie sich wundern. Sie hätten sich vorstellen können, dass das keinen Platz hatte, denn all die darin vertretenen Ansichten waren denen der Chefredaktion diametral entgegengesetzt.«69 Menge erkannte: Nun, ein paar Jahre, nachdem Springer die Welt übernommen hatte, fing das ›Einmischen‹ ein. Politische Tendenz, d.h. Meinung wurde wichtiger als Fakten.
Zum Dritten aber erhielt der Fernost-Korrespondent nach mehreren Anläufen und als erster westdeutscher Journalist die Genehmigung zu einer Fahrt mit der transsibirischen Eisenbahn von Peking nach Moskau. Im Frühjahr 1957 trat er die 13 000 Kilometer lange Reise an. [Abb. 9] In vierzehn Tagen reiner Fahrzeit – unterbrochen von einem mehrtägigen Aufenthalt in Peking – führte sie ihn von Hongkong beziehungsweise Kanton über Peking und Moskau nach (Ost-) Berlin und schließlich Hamburg. Seine Erlebnisse in Rotchina und der UDSSR schilderte Wolfgang Menge in einer Serie von Einzelberichten.70

Am umfangreichsten und vollständigsten scheint die überlieferte Hörfunk-Fassung, die unter dem Titel Land des müden Lächelns ab dem 7. Mai 1957 an vier Abenden vom NDR gesendet wurde.71 Sie beweist Wolfgang Menge am unmittelbaren Ende seiner Karriere als Auslandskorrespondent als nicht nur ironischen Beobachter, sondern auch – in der ebenso geschickten wie komplizierten Verschränkung der Zeitebenen – als meisterhaften Erzähler. Der Bericht beginnt mit der Rückkehr, der Ankunft in Ostberlin, die den Reisenden als unerhörten Einzelnen inmitten kommunistischer Kollektive einführt. Rückblickend wird dann Spannung aufgebaut, indem Menge schildert, wie schwierig es für westliche Journalisten ist, nach China zu gelangen, und wie unzulänglich die meisten bisherigen Reiseberichte sind. Als er dann überraschend eine Einreisegenehmigung erhält, mag er es kaum glauben:
»China, das meistumstrittene Land der Welt sollte nun von mir angesehen werden, ich sollte es wirklich wahrnehmen und endlich wahrhaft empfinden. Würde es anders sein, als ich es mir nach tausend Erzählungen, Gesprächen, Büchern und Berichten vorstellte?«72
Читать дальше