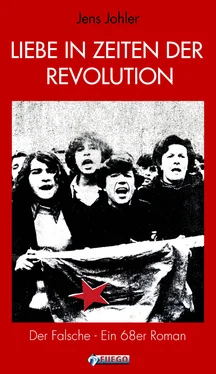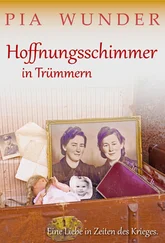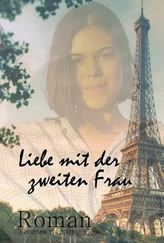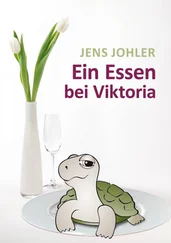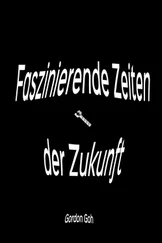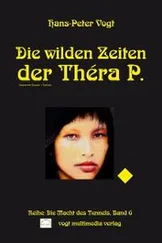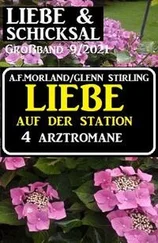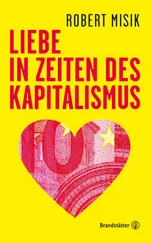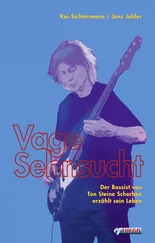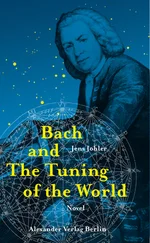»Ist es Ihre Sache, darüber zu entscheiden? « »Ich entscheide darüber, ob Sie den Schlüssel kriegen oder nicht.« »Dann seien Sie doch bitte so nett und entscheiden Sie sich dafür.« »Ich denke nicht daran.« »Können Sie denn nicht mal ein Auge zudrücken?« »Ich? Niemals.«
Nun gut, der Pförtner war beschränkt und dumm, aber es gab ja zum Glück noch Vorgesetzte, denen er gehorchen musste. Ich rief Herrn Axelroth, den Schauspieldirektor, an, aber es war überhaupt nicht die Rede davon, Herrn Meister in seine Schranken zu weisen. Kein Wort. Im Gegenteil. »Wieso arbeiten Sie am Sonntag?« fragte Herr Axelroth. »Das tun die anderen Kollegen doch auch nicht.« Ein klarer Punktsieg für Herrn Meister! Und ein Beispiel dafür, dass das kunstfeindliche, gewerkschaftliche Denken sich längst bis in die höchsten Ränge der Stadttheaterhierarchie hinaufgeschlichen hatte.
Solche und ähnliche Erfahrungen mit Pförtnern, Regisseuren, Kollegen und Direktoren – aber auch die wöchentliche Lektüre des Spiegel, der von Studentenunruhen, außerparlamentarischer Opposition und antiautoritärer Revolte berichtete – führten dazu, dass Antonia und ich über den autoritären Geist nachzudenken begannen, der an unseren Theatern herrschte, über deren feudalistische Strukturen und die Notwendigkeit der Demokratisierung. Freilich auch über den berufsbedingten Masochismus der Schauspieler und ihre sklavische Unterwerfung unter – ebenfalls berufsbedingt – sadistische Regisseure. Nicht alle Regisseure seien sadistisch, behaupteten wir, aber die, die es nicht seien, wären in der Regel auch nicht gut. Denn wenn der Regisseur schon der Vorgesetzte des Schauspielers sei und somit existentiell Macht über ihn verkörpere, dann sei es nur konsequent, wenn er diese Macht gleich bis zur vollständigen Dressur des Schauspielers ausnutze, anstatt so zu tun, als könne man von gleich zu gleich miteinander reden und arbeiten. Man sei eben nicht gleich. Das liege am System, an den Strukturen, und es gebe nur einen Ausweg aus diesem Dilemma: Mitbestimmung der Schauspieler und kollektive Regie.
Diese Gedanken schrieben wir nieder und schickten das getippte Manuskript an eine Zeitschrift, die es auch abdruckte, und zwar in großer Aufmachung und an gebührender Stelle. Das war ja was! Wir hatten etwas geschrieben, und man nahm es ernst! Man setzte sich auch damit auseinander! Vielleicht wäre unser Name bald in aller Munde!
Er war auf jeden Fall im Munde unserer Kollegen, die wir mit unserer Nestbeschmutzung ein wenig unvorbereitet getroffen hatten. Sie steckten nun die Köpfe zusammen und tuschelten über uns. Wir sahen es, wenn wir zur Probe kamen oder uns in die Kantine wagten. Aber, von zwei oder drei jüngeren Kollegen abgesehen, sprach uns niemand offen auf den Artikel an. Sie waren böse auf uns, sie sahen uns als Verräter. Und was hatte ich auch erwartet? dass sie »ja« sagten, »ja, ihr habt recht! Kriecher sind wir und Masochisten und obendrein noch schlechte Schauspieler, Knattermimen –, aber jetzt, wo ihr uns das so glänzend formuliert bewusst gemacht habt, jetzt werden wir uns ändern! Kommt, lasst uns Mitbestimmung einführen und kollektive Regie erkämpfen, heute noch!« Ja, ich glaube, das hatte ich erwartet. Ich war nicht nur erstaunt und verwundert, sondern beleidigt, dass sie das nicht taten. Sie wollten nichts mehr von uns wissen. Dafür bekamen wir jetzt allerlei Aufforderungen ins Haus geschickt, Solidaritätserklärungen zu unterschreiben und natürlich auch zu spenden und zu unterstützen.
Im Juni, kurz vor Beginn der Theaterferien, hatte ich ein Gespräch mit Herrn Lafrenz, einem bulligen, brutal-jovialen Menschen, der von der Bühnengenossenschaft, also auch von uns, bezahlt wurde und damals der mächtigste Theateragent im Lande war. Er empfahl mir unumwunden, meinen Namen zu ändern, »denn mit dem Namen kann ich sie natürlich nicht mehr vermitteln«. Diese und ähnliche Erfahrungen lockerten nicht nur unsere Bindung an den Theaterbetrieb, sondern an den Schauspielerberuf schlechthin. War Kunst nicht ohnehin elitär? Musste man nicht die Trennung zwischen Künstler und Publikum aufheben? War nicht jeder Mensch ein Künstler, nicht nur wir, sondern auch der Bühnenarbeiter, der Requisiteur, die Putzfrau und der Pförtner, also auch Herr Meister? Und mussten wir nicht unser privilegiertes Talent in den Dienst der einfachen Leute stellen, der Arbeiter, Angestellten, Hausfrauen und so weiter, damit auch sie ihre schöpferischen Kräfte entfalten konnten, und wenn nicht sie, weil es für sie vielleicht bereits zu spät war, dann doch ihre Kinder?
Aus der Frontstadt Berlin – es war inzwischen 1968 – schrieb Gerhard Krepp, den Antonia von der Schauspielschule her kannte, flammende Briefe: Wir würden noch die Revolution verpassen, wenn wir nicht alle Brücken hinter uns abbrächen und sofort kämen! Kommt! rief er brieflich aus, die Revolution braucht jeden Mann und jede Frau. Wer hier jetzt nicht dabei gewesen ist, der hat an seiner Zeit vorbeigelebt!
Es war allerdings auch so, dass unsere Verträge nicht verlängert wurden, weil ein neuer Intendant an das Theater kommen und seine eigene Mannschaft mitbringen würde. Und ein anderes Engagement war nicht in Sicht. Oder, um die Wahrheit zu sagen: Ich war es, der kein Engagement hatte, Antonia hatte eins oder hätte eins haben können, und beinahe hätten wir es sogar geschafft, zusammen an das Theater zu kommen, aber...
Es war in Bamberg. Oder Regensburg. Der Name des Theaterleiters ist mir entfallen. Antonia hatte sich beworben und, was immer schon eine gute Sache war, ein sogenanntes Vorsprechen bekommen. Sie fuhr hin, ich fuhr mit. Wir wollten nur gemeinsam an ein Theater gehen, um unser Training und natürlich auch unsere Liebe nicht aufs Spiel zu setzen. Meine Erfahrung mit Judith K. hatte mir gereicht: Lässt man die große Liebe seines Lebens ans Theater in einer anderen Stadt, dann geht sie todsicher mit Lars Hermann ins Bett. Oder mit Liz Brighton.
Antonia sprach in Bamberg (oder Regensburg) die Rollen vor, die ich mit ihr einstudiert hatte, und der Intendant, Herr Dr. Soundso, war sehr angetan. Er wollte sie vom Fleck weg engagieren. Antonia sagte, sie würde sein Angebot sehr gern annehmen, aber sie hätte noch einen Pferdefuß, nämlich mich. Wir seien Partner, wir arbeiteten zusammen und – ja, und dann erzählte sie so begeistert von unserem Training und allem, was wir dabei herausgefunden hatten, von Mitte, Stimmigkeit, Kunst des Bogenschießens, jo-frutti und so weiter, dass der Intendant immer neugieriger und sogar richtig animiert wurde und sagte, er habe zwar keinen Platz mehr im Ensemble, aber ich könne ihm ja auch noch vorsprechen, wenn ich schon mal da sei. Ich sprach ihm die Rollen vor, die Antonia mit mir einstudiert hatte, den Jim aus der Glasmenagerie, den Dauphin aus der Lerche, den Schüler aus dem Faust – und es gefiel dem Mann nicht schlecht, wie er sagte, aber deswegen hatte er immer noch kein Geld und keine Vakanz für mich. »Okay«, sagte ich, »dann komme ich umsonst. Sie müssen mir aber ein paar gute Rollen geben.«
Das sei unmöglich. Er habe die ganze Spielzeit schon verplant. »Aber wie wäre es mit Regieassistenz?«
Ich hatte schon einige Male Regieassistenz gemacht und wußte, wie das ging. »Okay«, sagte ich, »aber unter einer Bedingung.«
»Ja, bitte?«
»Dass ich auch eine eigene Regie bekomme.«
Es war Größenwahn. Der Mann sah mich zum ersten Mal und sollte mir gleich eine Inszenierung anvertrauen. Ja, woher! Ich traute sie mir ja selbst kaum zu. Außerdem waren wir eigentlich gegen die Position des Regisseurs, das hatten wir doch gerade öffentlich verkündet! Galt der Protest nicht mehr, wenn man selbst ein Zipfelchen Macht erwischen konnte?
Ich glaube, in meinem Innersten betete ich darum, dass der Intendant nein sagte, damit ich nicht auf einmal dastand und mir überlegen musste, wie ich ein Stück inszeniere. Ich war ein guter Trainer oder Schauspiellehrer, aber eine ganze Schar von Schauspielern zu einem halbwegs erträglichen Provinztheaterkunststück abzurichten, das war etwas anderes. Vielleicht wäre es auch gut gegangen, man wächst ja mit der Aufgabe, und aller Anfang ist Hochstapelei, aber es kam sowieso nicht dazu. Herr Dr. Soundso sagte zwar immer noch nicht, »Da ist die Tür« oder »Gehen Sie doch bitte wieder dahin zurück, wo Sie hergekommen sind«, sondern wiegte bedenklich mit dem Kopf und leckte sich die Finger nach einer möglicherweise gar nicht so schlechten kostenlosen Arbeitskraft – denn wer sich etwas zutraut, der kann vielleicht auch was –, aber er scheute dann doch das Risiko, wie er sagte, was natürlich Unsinn war, weil ein Stadt- und Subventionstheaterintendant gar nicht weiß, was Risiko ist. Das war das Ende unserer Theaterlaufbahn. Aus Liebe zueinander und zu unserem Training folgten wir dem Lockruf von Gerhard Krepp, gingen nach Berlin und mischten uns unter die Genossen, um die Revolution zu machen.
Читать дальше