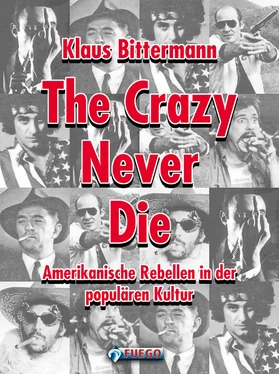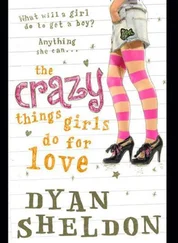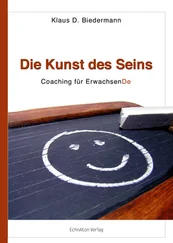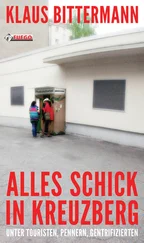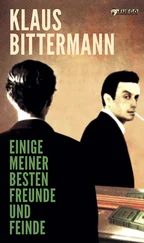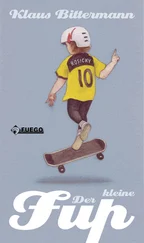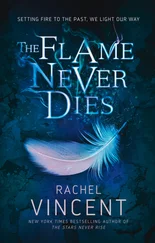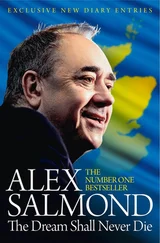Abbie erzählt in dieser Widmung eine kleine Geschichte, in der er einen ehemaligen Kommilitonen trifft, der inzwischen Leichenbestatter ist und Abbie fragt, warum die Leute, die Selbstmord begangen haben, immer so ein gewisses Grinsen im Gesicht hätten, das als »THE SHIT-EATIN GRIN« bezeichnet wird, so daß das Bestattungsunternehmen alles mögliche tun müßte, um den Gesichtsausdruck der Leichen seriöser und dem Anlaß der Beerdigung angemessener aussehen zu lassen. »Diese Geschichte«, schreibt Abbie Hoffman, »ist für dich, Lenny, von allen Yippies.«
Nur Hunter S. Thompson mochte Lenny Bruce nicht, was vermutlich daher kam, daß Thompson auf Lenny Bruce vermutlich erst stieß, als der schon abgebaut hatte, falls er überhaupt jemals eine Show von ihm gesehen hat, denn in seiner rücksichtsvollen und charmanten Art fand er, Lenny Bruce hätte festgebunden werden müssen, »und zwar aus keinem anderen Grund als ihn aus dem Weg zu räumen, damit ein Besserer den Ball übernehmen kann«. Und: »Bruce ist ein Schwindler, aber sogar das könnte ich ihm verzeihen, wenn er lustig wäre.« Aber auch Thompson war nicht immer lustig, er vertrug nur die Drogen besser und war so schlau, mit Heroin erst gar nicht anzufangen. Vielleicht wußte er Lenny Bruce auch deshalb nicht sonderlich zu schätzen, weil er die spezifisch jüdische Sozialisation und Atmosphäre innerhalb der jüdischen Gemeinde nicht nachvollziehen konnte und sie ihn auch nie interessiert hat, anders als bei Abbie Hoffman, der in der Lenny-Bruce-Show wahrscheinlich jede Menge Déjà-vus erlebte und genau wußte, wovon Lenny Bruce sprach.
Der von Hunter S. Thompson sehr geschätzte Lionel Olay bezeichnete Lenny Bruce als »unpolitischen Revolutionär«, aber abgesehen von der bewußt gewählten Contradictio in adjecto, es stimmt nicht, denn so wenig er Revolutionär war, so sehr war er politisch, nur nicht in einem vordergründigen Sinn, er war nicht politisch wie es ein Politiker ist, vielmehr transformierte er wie in dem Sketch über die Marines in Norfolk während der Kuba-Krise Politik in Psychologie, d.h. er zeigte, was die Krise im einfachen Mann auslöst und was der tun würde, wenn ihm die Entscheidung überlassen werden würde, nämlich gegen seine eigene Obsession vorgehen, gegen die »Nigger«, die doch nur das eine wollten, während ihm die Kubaner ziemlich egal waren.
In seinem vorletzten Auftritt, von dem ein paar Minuten im Internet zu sehen sind und bei dem er ziemlich sympathisch und verschmitzt dreinguckt, also gar nicht so aufgedunsen, wie von vielen Leuten beschrieben, und in dem er einen sehr souveränen und lockeren Eindruck macht, betritt er die Bühne und schwenkt das Mikro wie ein Weihwasserzepter, um die Gläubigen zu segnen, und dann erzählt er von den Nachstellungen durch die Polizei und wie die Cops quasi die Rolle von Lenny Bruce übernehmen und vor Gericht aufführen, was Lenny Bruce nur in Nachtclubs tut. In gewisser Weise war ihm an dieser Art der Verbreitung seiner »Ideen« mehr gelegen als an der Anerkennung seiner Kollegen, die ihm zu seinem Recht verhelfen wollten, sie ungestört vortragen zu dürfen, womit Lenny Bruce jedoch die Geschäftsgrundlage entzogen worden wäre.
Bei der Lektüre des letzten Absatzes von »Portnoys Beschwerden« wußte ich sofort, das ist auch ein gutes Ende für einen Aufsatz über Lenny Bruce, dem das Buch wie ein Maßanzug paßt, weil in diesem Ende auf eine Weise, für die man keinen Literaturnobelpreis bekommt, die Renitenz und die Kamikazehaltung Lennys zur Welt beschrieben ist, die eben so gar nicht zu seinem nachträglichen Ruf als Streiter für die Freiheit der Rede passen, und wer weiß, vielleicht stammt diese Passage sogar aus einem Sketch von Lenny Bruce: »›Hier spricht die Polizei. Sie sind umstellt, Portnoy. Wir raten Ihnen herauszutreten und ihrer Pflicht gegenüber der Gesellschaft nachzukommen.‹ – ›Die Gesellschaft soll mich am Arsch lecken, du Polyp!‹ – ›Ich zähle bis drei. Sie kommen jetzt raus, und zwar mit erhobenen Händen, oder wir kommen rein und knallen Sie ab wie’n tollwütigen Hund. Eins.‹ – ›Schieß doch, du Scheißbulle, ist mir scheißegal. Ich habe den Rasen betreten ...‹ – ›Zwei.‹ – ›... so lange ich lebte, habe ich wenigstens gelebt!‹«
Die Schönheit der Melancholie
Eine Liebeserklärung an den Mann mit dem schläfrigen Blick Robert Mitchum
»Ich habe ein Schild an meiner Tür: Vertreter, Schauspieler und Agenten unerwünscht. Ich gehe nicht auf Parties, weil mir das Hinkommen oder Weggehen zu anstrengend ist.« Robert Mitchum
Der romantische Verlierer
»In diesem Frühjahr fühlte ich mich zum ersten Mal müde. Daran merkte ich, daß ich alt wurde. Vielleicht lag es an dem miesen Wetter, das wir in Los Angeles hatten, oder an den lausigen Fällen, die ich zu bearbeiten hatte. Meistens jagte ich getürmten Ehemännern hinterher und anschließend hinter ihren Frauen, weil sie nicht zahlen wollten. Vielleicht war ich doch deswegen müde, weil ich wirklich alt wurde. Das einzige, was mir Spaß machte, war Joe DiMaggio zuzusehen, wenn er für die New York Yankees Baseball spielte«, sagt die Stimme Philip Marlowes aus dem Off in der Eröffnungsszene von »Farewell My Lovely«. Robert Mitchum blickt müde aus dem Fenster einer Absteige auf eine Straße in Los Angeles, eine Zigarette qualmt in seinem Mundwinkel, Neonlicht flackert, während sein altes, schlecht rasiertes Gesicht auftaucht und lapidar von der Katastrophe eines Lebens Zeugnis ablegt.
Bevor es den Film überhaupt gab, hat Eric Burdon die trostlose und verzweifelte Atmosphäre dieser Szene in »Hotel Hell« eingefangen, einem intensiven Song mit einer traurigen spanischen Trompete, der von der Einsamkeit eines Mannes handelt, »far away from home«, ein ganz wesentliches mythisches Element in der populären Kriminalliteratur, die Metapher für ein verpfuschtes Leben, weil man aus guten Gründen nie etwas von Familie und Eigenheim hören wollte, aber manchmal eben etwas schwach und sentimental wird. »Alles, was ich anfasse, wird zu Scheiße. Ich habe einen Hut, einen Mantel und eine Kanone. Das ist alles. Ich brauche dringend eine Lebensversicherung und ein Häuschen auf dem Land«, sagt Mitchum später zu Lt. Nulty, aber er weiß, daß dieser Zug für ihn längst abgefahren ist.
Mitchum strahlt eine unendliche Melancholie aus, von der ich sofort ergriffen war, als ich den Film zum ersten Mal sah, denn die Desillusionierung und die Vergeblichkeit, die sich in Mitchums Gesicht widerspiegeln, sind Zustände, von denen ich glaubte, niemand könne sie besser verstehen als ich. Und ich schätze, es gab eine Menge Leute, die das ebenso sahen, jedenfalls Mitte/Ende der Siebziger (der Film kam 1975 in die Kinos), als bereits absehbar war, daß der Aufbruch einer rebellischen Jugend in eine neue Zeit immer mehr unter die Räder des Imperiums geriet, weil diese Jugend sehr deutlich spürte, daß sie keine Chance hatte, nicht mal wenn sie sie nutzte, jedenfalls galt das für diejenigen, die keine Lust hatten, sich auf den langen Marsch durch die Institutionen zu begeben. Das Gefühl, einem repressiven gesellschaftlichen Monolith gegenüberzustehen, der sich keinen Millimeter bewegte und der keine Konzessionen machte, gegen den man dennoch möglichst heroisch bestehen wollte, war der Grund, weshalb die film noirs von Melville oder eben auch »Farewell My Lovely« gerne geguckt wurden, und sie wurden nicht geguckt von Leuten, die Vergnügen dabei fanden, auf den RAF-Fahndungsfotos die Gesichter der Gesuchten durchzustreichen, wenn sie verhaftet oder erschossen worden waren. In diesen Filmen entdeckte man instinktiv eine innere Verwandtschaft zu den Protagonisten, zu den Gaunern, Profis, Private Eyes, zu den Losern, die aus unterschiedlichen Gründen gegen alles waren, was das System repräsentierte, und die aus innerer Überzeugung taten, was getan werden mußte, auch wenn sie dabei Kopf und Kragen riskierten. Wir hatten keine Ahnung, was das wirklich bedeutete, aber es war völlig klar, das waren die coolen Jungs, mit denen man sich identifizieren konnte.
Читать дальше