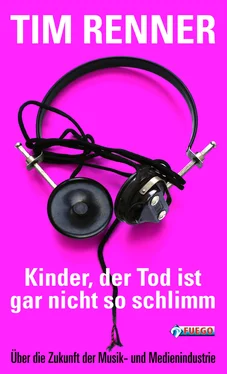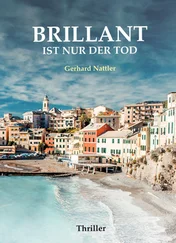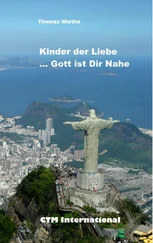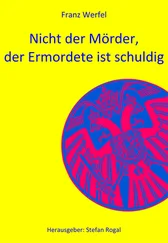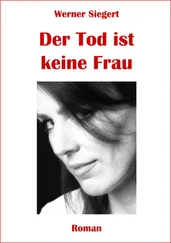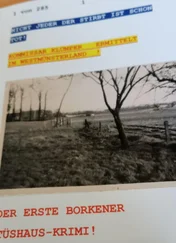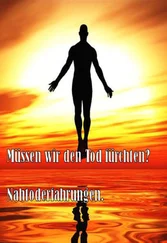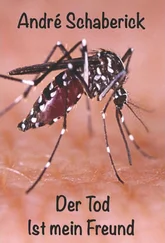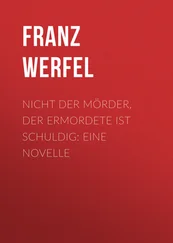Die Entwicklung der CD und des dazugehörigen Players zeigt beispielhaft, wie entscheidend Bequemlichkeit und Emotionalität für den Konsumenten und damit für den Erfolg einer Markteinführung sind: Gerade weil sich in der einfachen äußeren Benutzbarkeit des CD-Systems die zugrunde liegende technische Komplexität nicht spiegelte, gelang die extrem schnelle Markteinführung mit gewaltigen Verkaufserfolgen. Im ersten Jahr produzierte PolyGram 376.000 CDs – dann explodierte die Nachfrage. 950 Millionen CD-Player und Milliarden bespielter CDs wurden bis heute verkauft.
Das Phänomen Digitalisierung erreichte durch die CD zum ersten Mal massiv den Massenmarkt; aber nicht als Furcht einflößender Datenmoloch, sondern als hörbarer, spürbarer Qualitätssprung für den Nutzer. Die CD war unempfindlicher als Vinyl, die Titel ließen sich einfach anwählen – eigentlich konnte man kaum noch etwas falsch machen. Die CD war zwar eine technische Innovation, eine »kalte« Entwicklung, eigentlich nur die Umwandlung von Musik in zahllose Nullen und Einsen, aber sie wurde »warm«, also emotional verkauft. Ihr Inhalt – Musik – war dabei entscheidend. Und die Künstler: Herbert von Karajan gab auf zweifache Weise den Standard vor. Bereits im Frühjahr 1981 hatte der Dirigent der Berliner Philharmoniker als erster Künstler eine CD-Demonstration erhalten. Er liebte das neue Format. Und er erzählte bereitwillig jedem von seiner jungen Liebe. »Eine technologische Errungenschaft«, schwärmte von Karajan, »vergleichbar dem Übergang von der Gaslampe zu elektrischem Licht.«
Gleichzeitig gab es zwischen Philips und Sony Diskussionen über die Größe der CD. Ursprünglich war der Disc-Durchmesser von Philips auf 115 Millimeter festgelegt worden – das entsprach einer Spielzeit von 66 Minuten. Doch auf Betreiben von Sony wurde er auf 120 Millimeter und 78 Minuten Maximalspielzeit nach oben korrigiert. Der Grund: Sony-Präsident Norio Ahga, ein ehemaliger Opernsänger und Klassikfanatiker, verlangte, dass Beethovens Neunte, seine Lieblingssymphonie, in der Einspielung von Karajan auf der CD Platz finden müsse. Und diese Einspielung dauerte nun mal 72 Minuten. Die Auswirkungen waren dramatisch: Sony-Mitarbeiter hatten bisher ihre Demo-CDs bei Vorführungen locker aus der Brusttasche gezogen, um die praktischen Ausmaße der neuen Schallplatte zu verdeutlichen. Die vergrößerte CD passte nun aber nicht mehr in normale Brusttaschen. Also erhielten alle Sony-Mitarbeiter Hemden mit größeren Brusttaschen. Und dieses neue Maß wurde dann wiederum als Herrenhemden-Standard in Japan eingeführt.
Nur die Plattenfirmen weigerten sich, die CD als neues Speichermedium für Musik zu akzeptieren und als Chance zu begreifen. Und das, obwohl ihnen bereits das Wasser bis zum Hals stand, weil die Umsätze mit Vinyl wegbrachen. PolyGram-Chef Jan Timmer reagierte, übernahm die Führung und kündigte ein 500-Tage-Programm an, innerhalb dessen er für sämtliche Territorien CD-Fabriken bauen ließ und damit den Markt vor sich hertrieb.
Gleichzeitig entwickelte der damalige Chef von Philips, Cor van der Klugt, gemeinsam mit Sony-Präsident Akio Morita eine bauernschlaue Verhandlungstaktik: Auf einem US-Meeting mit den Chefs der großen Musikfirmen, denen 3 US-Cent Lizenz pro CD zu hoch erschienen und die einen Boykott planten, sollte das weitere Vorgehen besprochen werden. Als alle Manager zusammensaßen, erklärte van der Klugt: »PolyGram hat zwei Anwälte mitgebracht. Jeder, der einen CD-Boykott zum Thema macht, erhält umgehend eine gerichtliche Vorladung und wird verhaftet, sobald er diesen Raum verlässt. Denn es ist in den USA illegal, einen Boykott auszusprechen.« Die Musikchefs waren überrumpelt, der Schachzug gelang, es kam nie zu einem Boykott.
Kurz darauf sah Philips davon ab, den Plattenfirmen Lizenzen für die Nutzung des CD-Patentes zu berechnen. Stattdessen wurden von allen Presswerken (die meist den Muttergesellschaften gehörten und diese Gebühr als Bestandteil der Fertigungspreise einfach aufschlugen) 3 US-Cent pro Disc eingeholt. Gleichzeitig pendelte sich der Preis für eine CD fast 100 Prozent über dem einer LP ein. Nun begann die Skepsis der Musikmanager zu weichen.
Während die CD rasend schnell vom Spielzeug für Klassik-Snobs zum Spielzeug für Rock-Snobs, also zum Musikalltag von Millionen wurde, begann die Musikindustrie mit wachsender Begeisterung, ihre zuvor ängstlich geschützten Master in digitaler Form ans Volk zu verteilen.
Das Paradies – erschaffen durch Emile Berliner und Fred Gaisberg
Ich kam gerade rechtzeitig zum 100. Geburtstag der Schallplatte in den PolyGram-Konzern. 1987 wurden Emil Berliner und seine Erfindung gefeiert. Wir bekamen einen Ersttagsbrief mit den Jubiläumsbriefmarken der Deutschen Bundespost und eine Festschrift geschenkt. In der konnten wir nachlesen, dass Emil mit 14 die Schule abgebrochen hatte, um dann mit 19 Jahren vor dem preußischen Wehrdienst nach Amerika zu fliehen. Die Lektüre eines physikalischen und meteorologischen Lehrbuchs des Freiburger Professors Johannes Müller brachte Emile – um amerikanischer zu erscheinen, hatte er mittlerweile ein »e« an seinen Vornamen gehängt – dazu, sich mit elektronischen und akustischen Phänomenen zu beschäftigen. Die Begeisterung dürfte durch Nachbarstochter Cora gesteigert worden sein. Berliner, der seine Brötchen eigentlich als Buchhalter verdiente, musste für seine akustischen Experimente nach Feierabend auch Strippen durch die Zimmer ihrer Familie ziehen. Die geduldigen Adlers von nebenan ließen ihn gewähren und schließlich ihre Tochter heiraten. Ergebnis der hormongetriebenen Forschung war die Erfindung des Telefonmikrofons. Das Patent verkaufte er Alexander Graham Bell und ermöglichte diesem die Massenproduktion des Telefonapparats. Seinen Brüdern Joseph und Jacob baute er daheim in Hannover eine eigene Fabrik. Mit Telekommunikation verdienten die Berliners 20.000 Mark Startkapital, um im Jahr 1892 die Grammophon Gesellschaft zu gründen.
Thomas Alva Edison hatte derweil den Phonographen erfunden, um Stimmen aufzuzeichnen. Einige Hundert Exemplare tourten ab 1877 über die amerikanischen Jahrmärkte und versetzten das Volk in Staunen. Edison selbst hatte längst das Interesse verloren und wendete sich der Erfindung der Glühbirne zu. Emil Berliner hingegen setzte statt auf das Büro und die Tonaufzeichnung fürs Diktat lieber auf den Hausgebrauch. Sein 1887 zum Patent angemeldetes Grammophon verwendete anstelle von Walzen leicht austauschbare Platten und war deutlich billiger zu produzieren.
Das »Vaterunser«, gesprochen vom Straßenhändler John O’Terrel, hieß der erste Bestseller. Dieser Hit war geplant, die Technik hingegen noch nicht ganz ausgereift und Berliners Kalkül, dass das Vaterunser jedermann mitsprechen könne und deshalb die Aussetzer auf der Platte nicht so sehr stören würden, ging auf. Die Software diente lediglich als Mittel zum Verkauf der Ware Grammophon. Das Niveau der ersten Schallplatten war deshalb eher niedrig und das Image der Hardware litt darunter. Im Volksmund hieß das Grammophon plötzlich »des Spießers Wunderhorn«. Um das zu ändern, brauchte es den ersten künstlerischen Leiter, also den Urvater aller späteren Artist & Repertoire Manager, den die junge Grammophone-Gesellschaft sich leistete.
Er hieß Fred Gaisberg und kam als 21-Jähriger von der Columbia Phonograph. Die Firma war von einem ehemaligen Gerichts- und Kongress-Stenographen gegründet worden. Das sagte viel darüber aus, worum es ihr bei der neuen Aufnahmetechnik eigentlich ging. Gaisberg versuchte sich als Pianist auf ersten, eher lustlos wirkenden Musikaufnahmen, stieß aber bei Columbia Phonograph auf wenig Interesse. So zog er es vor, fasziniert von den neuen Möglichkeiten des Grammophons, bei Emil Berliner erst einmal die Tontechnik zu erlernen. Der junge Musiker erlangte schnell dessen Vertrauen und wurde 1898 nach London geschickt, wo er die Grammophone Company Ltd. anmeldete und das erste Tonstudio aufbaute. Die räumliche Trennung hatte einen guten Grund. Berliner wusste, dass er auf dem europäischen Kontinent nicht auf Dauer ausschließlich mit amerikanischem Repertoire reüssieren konnte. Gaisberg hatte ihn sogar davon überzeugt, dass sie Aufnahmen von authentischen Künstlern aus allen Ländern bräuchten, in denen sie seine Erfindung auf den Markt bringen wollten. Musik, die von einer Scheibe wie der Schallplatte kam, war schon abstrakt genug – wenigstens die Interpreten und ihre Lieder sollten den ersten Konsumenten Vertrautes vermitteln. So zog Gaisberg von London aus quer über den europäischen Kontinent, durch Russland, Indien bis in den Fernen Osten. Er nahm Heurigenlieder in Wien, Fandangos in Madrid, Chansons in Paris, Tablas in Hyderabad, Pipamusik in Shanghai und Opernarien in Berlin und Leipzig auf.
Читать дальше