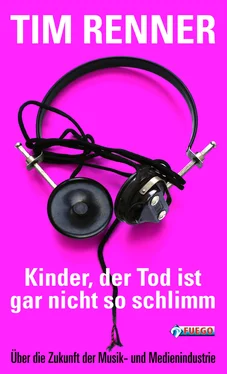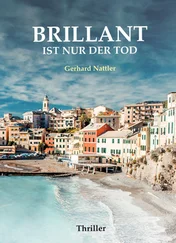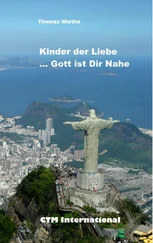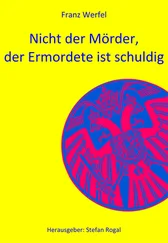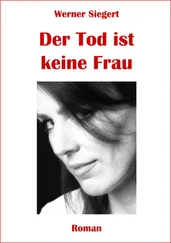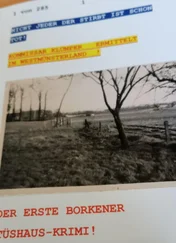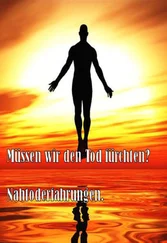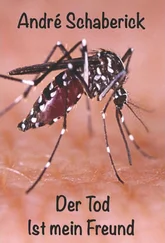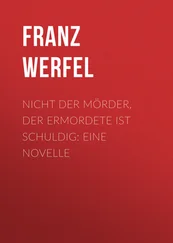Immer nach Talent und Repertoire suchend, kam er 1902 selbstverständlich auch in die legendäre Mailänder Scala. Dort war ein junger, bislang wenig bekannter Tenor namens Caruso in einer Inszenierung der Oper Germania zu sehen. Fred Gaisberg war hingerissen, eine solche Stimme war selbst ihm noch nicht untergekommen. Er bot dem jungen Mann nach seinem Auftritt hinter der Bühne enthusiastisch gleich mehrere Schallplattenaufnahmen an. Doch Enrico Caruso war ein selbstbewusster Künstler und schätzte, obwohl er erst am Anfang der Karriere stand, seinen Wert durchaus richtig ein. 100 englische Pfund für zehn kurze Arien forderte er. Eine unglaubliche Summe für die damalige Zeit und für ein Format, das sich noch in der Markteinführung befand. Gaisberg versuchte, sich im Mutterhaus rückzuversichern, bekam aber eine deutliche Abfuhr gekabelt. Wie viel Apparate man wohl mehr verkaufen würde, wenn dieser Caruso und nicht irgendein anderer italienischer Viehhirte oder Fischer in den Aufnahmetrichter singen würde ...
Fred Gaisberg war zu stolz und zu überzeugt, um sich auf diese Diskussion einzulassen. Kurz entschlossen bezahlte er Caruso aus eigener Tasche. In nur zwei Stunden sang dieser ihm alles ein. Besonders die Arie E lucevan le stelle aus Puccinis Tosca sorgte für Furore, und das nicht nur in Italien. Der Intendant der Metropolitan Opera in New York bekam eine Aufnahme in die Hand und engagierte Enrico Caruso vom Fleck weg. Die erste musikalische Weltkarriere begann und mit ihr setzte die Schallplatte zum Quantensprung an. Sie emanzipierte sich vom Abspielgerät, wurde plötzlich in den Zeitungen und den besseren Kreisen als Kulturträger entdeckt und geachtet. Zu verdanken hat sie das dem unbeirrbaren Glauben einer einzelnen Persönlichkeit, seinem Glauben an Regionalität und Qualität.
Joseph und Jacob Berliner, die für ihren Bruder die Platten in einem Kuhstall neben ihrer Telefonfabrik pressten, wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Nach Caruso boomte der Markt. Ein neues Presswerk musste her, um den Bedarf an den aus England von Fred Gaisberg angelieferten Aufnahmen zu decken. 1907 wurden in Hannover bereits 36.000 Exemplare am Tag gepresst. Auch in Amerika zog mit etwas Verspätung der Markt an, aber dafür dann umso kräftiger. Die junge Schallplattenindustrie wurde in den frühen zwanziger Jahren der größte Player im amerikanischen Entertainment-Business. 1921 wurden bereits für 106 Millionen US-Dollar Tonträger umgesetzt. Der scheinbar so mächtige Film kam im Vergleich auf nur 93 Millionen.
Die Freude währte nicht lange. Ohne dass es die im Expansionstaumel befindliche Industrie gemerkt hätte, wurde in Amerika eine Technik entwickelt, die es dem Konsumenten ermöglichte, Musik zu konsumieren, ohne dafür zu bezahlen. Das Teufelsding hieß Radio. Es war, wie später das Internet, ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt worden, und ab 1922 mit zwei großen Netzwerken, der Radio Corporation of America (RCA) und dem Columbia Broadcasting System (CBS) plötzlich in jedem Haushalt zu empfangen. CBS wurde von einem Künstlermanager und Konzertveranstalter, einem verkrachten, ehemaligen Violinisten namens Sarnoff Judson gegründet, weil er Angst hatte, dass durch Radiokonzerte das Livegeschäft leiden würde. Das tat es nicht, dafür aber umso mehr die Schallplattenindustrie, die nicht so entschlossen wie Judson handelte. Durch die Weltwirtschaftskrise geriet sie weiter unter Druck und ging in den frühen dreißiger Jahren in die Knie: Nur noch 6 Millionen US-Dollar – 5,7 Prozent von der Herrlichkeit zwölf Jahre zuvor – betrug der Umsatz mit Tonträgern in den USA im Jahr 1933.
Die Radiokonzerne RCA und Erzrivale CBS schluckten ab 1934 fast vollständig den traurigen Rest. Einerseits geschah das als strategisches Investment, andererseits weil die Schallplattenfirmen gerade so günstig zu haben waren. Irgendwoher mussten schließlich auch die Aufnahmen von den Künstlern kommen, die man senden wollte.
Lange blieb das Radio-Oligopol nicht allein. Mitten in die Krise hinein, der Logik des antizyklischen Handelns folgend, wurde in England die Firma Decca gegründet. Für ihren amerikanischen Ableger warb man A&R Jack Kapp ab, der es leid war, als geduldeter Subventionsempfänger der CBS seine Arbeit zu verrichten. Er holte nicht nur Künstler wie Guy Lombardo, Louis Armstrong und Bing Crosby peu à peu von seinem früheren Label Brunswick zu Decca hinüber, sondern entwickelte mit seinem englischen Chef Sir Ted Lewis eine Idee, die das Ende der Krise bringen sollte. Zur großen Verblüffung von RCA und CBS bot der kleine, neue Konkurrent seine Platten für nur 35, statt der üblichen 75 Cent an. Die radikale Politik, den Preis um mehr als die Hälfte abzusenken, bescherte Decca einen so gigantischen Erfolg, dass die beiden Riesen nachziehen mussten. Der Konsument belohnte das Entertainment-Angebot, das er sich wieder leisten konnte. Kurz vor dem Krieg hatte sich der amerikanische Markt mit 44 Millionen US-Dollar Umsatz mehr als versiebenfacht. Bis 1947 wuchsen die Umsätze in den USA auf 224 Millionen US-Dollar. Der Markt diversifizierte – neben RCA, CBS und Decca entstanden Capitol (spezialisiert auf Country und Rhythm & Blues), MGM (als Ableger der Filmgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer) und Mercury (als Tochterfirma eines Kunststoffherstellers, der sein Presswerk auslasten wollte) sowie viele kleine spezialisierte Labels. Der Musikmarkt stand stabil neben Film, Radio und dem noch neuen Medium Fernsehen. Während das Entertainment-Geschäft im Nachkriegseuropa zum Erliegen kam, entstand unter dem Dach der CBS die nächste technische Revolution: Schallplatten hatten damals alle einen Durchmesser von 30 Zentimetern, aber eine maximale Spielzeit von nur fünf Minuten pro Seite. Zudem war Schellack, das Material, aus dem sie bestanden, schwer und zerbrechlich. Besonders genervt zeigte sich davon ein gewisser Dr. Peter Goldmark. Der in die USA ausgewanderte Österreicher war ein glühender Klassikfan und sah nicht ein, weshalb er für eine vollständige Symphonie durchschnittlich 32-mal aufstehen sollte, um die Seite zu wechseln oder die nächste Platte aufzulegen. Er brauchte ein Material, das eine engere Rillenführung erlaubte und fand es 1948 im Kunststoff Vinylite. Als Chef der CBS-eigenen Labors entwickelte er einen Spezialmotor für geringere Abspielgeschwindigkeit, baute einen neuen Tonarm, optimierte die Nadel als Abnehmer und erfand gleich noch das Kondensatormikrophon, um die klangliche Qualität seiner neuen Vinylplatte auch ausreizen zu können. Quasi im Alleingang begründete Dr. Goldmark die High Fidelity. 45 Minuten Spieldauer pro Schallplatte und ein Frequenzumfang von 30 Hz bis 15.000 Hz boten dem Konsumenten ein völlig neues Klangerlebnis und bescherten der Schallplattenindustrie ihren zweiten Boom. Die Langspielplatte war geboren und mit ihr das für die Anbieter von Musikaufnahmen wunderbare Prinzip, dem Kunden zehn, zwölf Songs eines Interpreten verkaufen zu können, obwohl dieser vielleicht nur drei oder vier bestimmte Lieder haben wollte.
Die neue Technik machte das Geschäft mit der Musik auch für die Hardwarehersteller wieder attraktiv. Siemens hatte bereits während des Krieges die Deutsche Grammophon in Hannover erworben, Philips stieg 1950 mit der Phonogram ein, kaufte amerikanische Labels wie die Mercury hinzu und fusionierte dieses Bouquet zusammen mit der Siemens-Tochter Deutsche Grammophon und deren Pop-Label Polydor 1972 zur PolyGram, der größten Plattenfirma der Welt. Das war zuvor lange Zeit die Electric and Musical Industries Ltd., kurz EMI, gewesen, eine Vereinigung aus dem englischen, von Fred Gaisberg kontrollierten Arm der Grammophone und der Columbia Phonograph, seinem früheren Arbeitgeber. EMI verstand sich, wie ihr Name schon sagte, ursprünglich als Mischunternehmen, verkaufte aber 1954 zur Konsolidierung die Grammophon- und Radioproduktion an den Konsumartikel- und Waffenfabrikanten Thorn, der 25 Jahre später auch die restliche EMI erwarb. Die Decca, das Wunderkind der Rezession, fand bei Telefunken unter dem verkoppelten Namen Teldec eine neue Heimat.
Читать дальше