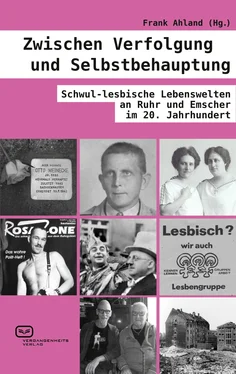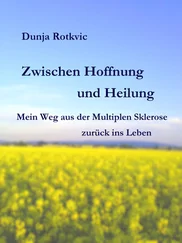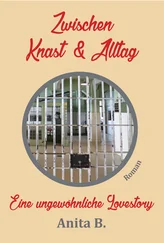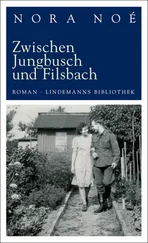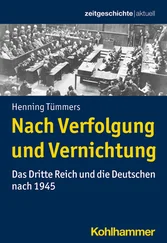Zur Verwunderung der Geheimen Staatspolizei wurde zunächst gegen Sträter verhandelt, am 19. Juni 1936 begann der Prozess. „Sträter als erster Angeklagter” überschrieb die National-Zeitung vom 20. Juni ihren Artikel. Doch nach vier Verhandlungstagen konnten die Leserinnen und Leser der Essener Volkszeitung am 29. Juni Details über „Das Ende eines unerquicklichen Prozesses” erfahren. Der Hauptbelastungszeuge Peter Roleff, der drei Monate zuvor den Bühnenbildner Paul Sträter beschuldigt hatte, erschien am 23. Juni vor der III. Strafkammer des Landgerichts Essen und widerrief sein belastendes Geständnis. 43In Anwesenheit der Presse und der Gestapo-Beamten Nohles und Schweim behauptete der Ballettmeister, „daß ihm gerade dieses Geständnis, und zwar dieses allein, von dem vernehmenden Beamten der Staatspolizei durch Schläge pp. erpresst worden sei”. 44
In einem internen Bericht der beiden Beamten, die sich bloßgestellt sahen, kam ihr Unmut über den gesamten Hergang des Verfahrens zum Ausdruck. Sie erhoben schwere Vorwürfe über die Zusammensetzung der Strafkammer, besonders über das Verhalten des Vorsitzenden Kammerpräsidenten Thiel und die „Art seiner schlappen Verhandlungsführung”. Den Anwürfen gegen die Staatspolizei sei Präsident Thiel nicht energisch entgegengetreten. In seinen Ausführungen über die Methoden der Verhöre des Kommissars Nohles erklärte der Zeuge Peter Roleff, „er sei von Nohles mehrmals über den Tisch hinweg auf den Kopf geschlagen worden. Hierbei sei der Schreibtisch umgefallen.” 45Zwar widersprach die Protokollantin der Staatspolizei, die das Verhör des Peter Roleff niedergeschrieben hatte, in ihrer Vernehmung den Aussagen des Ballettmeisters. Sie verneinte auch die Frage des Kammerpräsidenten Thiel, „ob Kommissar Nohles während der Vernehmung des Roleffs geboxt bzw. so geschlagen hätte, daß der Tisch umgefallen sei”. 46Die beiden Kriminalkommissare weiter: „Es sei bezeichnend für die Art der Verhandlungsführung des Präsidenten Thiel, daß […] man von dem Verfahren gegen Sträter in ein anderes gekommen wäre!” Jedem Außenstehenden war klar, daß mit diesem anderen Verfahren nur eines gegen die Staatspolizei und deren Vernehmungsmethoden gemeint sein konnte.
Den sich anbahnenden Freispruch Sträters aufgrund des „Umfalles” des Zeugen Roleff versuchte die Staatsanwaltschaft mit dem Antrag zu verhindern, das Verfahren zu vertagen. Der Staatsanwalt versuchte, die Verhandlung gegen Sträter, wie ursprünglich wohl auch vorgesehen, zusammen mit dem „demnächst kommenden großen Prozeß gegen Homosexuelle” führen zu lassen. Die Herausnahme, die sich als „Fehler erwiesen hätte”, sei aus „rein objektiven Gründen erfolgt”, so der Staatsanwalt in seinem Antrag zur Vertagung, „da man Sträter nicht für einen typischen Homosexuellen gehalten habe”. Angemerkt sei hier die Aussage des als weiterem Zeugen vernommenen Intendanten der Essener Bühnen. Noller erklärte vor Gericht, „daß Künstler in ihren Aussagen nicht immer mit den Maßstäben des reinen Verstandes zu messen seien, sondern dass sie von der künstlerischen Fantasie stark beeinflußt würden […], so daß sie zuletzt selber nicht mehr zwischen Wahrheit und Dichtung zu unterscheiden wüßten”. 47Diese Aussage Nollers soll unter den Angestellten der Essener Bühnen große Empörung ausgelöst haben, vermerkte die Gestapo in ihrem Bericht. Auch der Hinweis der Staatsanwaltschaft, „daß derartige Verfehlungen nach der heutigen strengen Auffassung in unserem Staate aus gesundheitlichen und moralischen Erwägungen heraus empfindlich geahndet werden”, und die Beantragung einer Gefängnisstrafe von neun Monaten brachten Kammerpräsident Thiel nicht davon ab, den Angeklagten Paul Sträter freizusprechen.
„Unwahre Behauptungen über angebliche Geständniserpressungen”
Wie sehr sich die Essener Gestapo-Leitstelle blamiert hatte, dokumentierte die Berichterstattung der lokalen und überregionalen Presse. Die Schlagzeilen über „Das Ende eines unerquicklichen Prozesses” und die Umstände, die durch den „Umfall” des „unerklärlichen Zeugen Roleff” einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurden, sollten von der Geheimen Staatspolizei nicht einfach hingenommen werden. 48Am 26. Juni erging ein Schutzhaftbefehl gegen Paul Sträter. Seine Ehefrau wandte sich an den Oberbürgermeister, der ihr versicherte, er „verlange Freilassung von Sträter”. In seiner Chronik fuhr er fort: „Ich rufe die Gestapo an. Kommissar Nohles weicht aus, sagt, es lägen gegen Sträter noch andere Sachen vor.” Und den „erregten” Kommissar Schweim zitiert er mit den Worten: „Die Gestapo sei bloß gestellt und das lasse er sich nicht gefallen, er glaube nicht an Sträters Unschuld”. Schweim verwies darauf, dass der Polizeipräsident von Essen, SS-Brigadeführer Zech, „seine Auffassung teile”. Der Oberbürgermeister antwortete, „das Vorgebrachte gehe Roleff an, nicht Sträter. Ich warte bis zum Urteil, dann muß ich für meinen Angestellten eintreten.” Am selben Tag ließ der Oberbürgermeister sich von Stadtrechtsrat Russel berichten: „Sträters Freispruch sei ganz sicher”, aber er sei von der Gestapo nicht freigelassen worden. Im „Schutzhaftbefehl” heiße es, dass „durch die Beeinflussung der Öffentlichkeit das Ansehen der Staatspolizei durch unwahre Behauptungen über angebliche Geständniserpressungen” und somit „die Staatssicherheit erheblich gefährdet” sei. Trotz intensiver Bemühungen anderer Gestapo-Dienststellen, neue Erkenntnisse über Sträter zu erlangen, blieben die Ermittlungen ohne Erfolg.
Oberbürgermeister und Intendant versuchten in den Sommermonaten, durch Eingaben und Entlassungsgesuche an die Essener Gestapo die Freilassung Sträters zu erreichen. Nach einem Gespräch mit dessen Anwalt notierte der OB am 31. Juli in seiner Chronik: „In sechs Tagen werde ich Oberleitung der Gestapo [Himmler] bitten, sich zu entscheiden, da Sträter eventuell ersetzt werden muss, [und da er] auch in Antwerpen nötig ist.” Schließlich zeigte das Engagement um die Entlassung aus der Schutzhaft Wirkung. Einen Auftrag an Sträter, Entwürfe für die Königlich Flämische Oper in Antwerpen zu erstellen, nahm der Präsident der Reichstheaterkammer zum Anlass, sich in einem Schreiben an Kriminalkommissar Schweim für die Freilassung zu verwenden. Anfang September 1936 wurde Paul Sträter aus der Schutzhaft entlassen.
Die Geheime Staatspolizei hielt es in den folgenden Jahren in Schreiben an den Präsidenten der Reichstheaterkammer in Berlin „noch nicht für ratsam”, „Sträter an einem Theater der öffentlichen Hand zu beschäftigen”. 49Obwohl im August 1938 in der Gestapo-Außenstelle Braunschweig erneut der Verdacht der homosexuellen Betätigung aufkam, blieb Paul Sträter unbehelligt. 50Noller nahm Sträter später mit an die Staatsoper Hamburg.
„Verantwortungslose Volks- und Staatsfeinde”
Anders erging es den 14 Personen, deren Schicksal mit dem Essener Theaterskandal in Verbindung stand. Sie mussten am 25. September 1936 vor der I. Großen Strafkammer des Landgerichts Essen ihre Urteile entgegennehmen. Im Gegensatz zum ersten Prozess fand dieser unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Bericht des Deutschen Nachrichtenbüros wird sicher auch die Zustimmung der Essener Gestapo gefunden haben. Die Namen der 14 Angeklagten aus den „verschieden-sten Volksschichten und Berufskreisen” wurden nicht mehr genannt. Darunter befanden sich der ehemalige Operettenspielleiter und Regisseur Otto Zedler und der Tänzer Peter Roleff. Zedler wurde zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und Roleff, der in der Urteilsbegründung als „der typische Homosexuelle” bezeichnet wurde, zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren verurteilt. Laut Essener Anzeiger vom 26. September bezeichnete der Vorsitzende der Strafkammer „die Straftaten als dekadente, anormale Erscheinungsformen, die den gesunden Volkskörper schwer bedrohen […]. Wir alle wissen, zu welchen Zersetzungs- und Verfallserscheinungen die Zustände vergangener Zeiten führten, da ein Magnus Hirschfeld und andere ‚Wissenschaftler’ darauf drängten, den § 175 überhaupt aufzuheben […]. Im neuen Reich werden diese Kreise als das bezeichnet und behandelt, was sie sind, als verantwortungslose Volks- und Staatsfeinde, mit denen rücksichtslos aufgeräumt werden muss und wird.” In der folgenden Ausgabe wurde die National-Zeitung zitiert, die sich über die Urteile ausließ und bedauerte, „daß das Essener Gericht in seiner Urteilsfindung dem ausdrücklichen Willen des nationalsozialistischen Staates und des deutschen Volkes, in schärfster Form der Gefahr der Volksverseuchung entgegenzutreten, in offensichtlich ungenügender Form begegnet sei”. Das Blatt empörte sich: „Hier liegen doch Straftaten vor, die diejenige, welche sie begangen haben, einwandfrei als verantwortungslose Volks- und Staatsfeinde charakterisieren, so daß mit ihnen wirklich rücksichtslos aufgeräumt werden müßte.” 51
Читать дальше